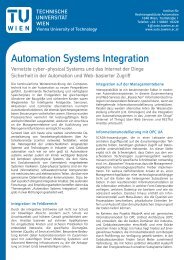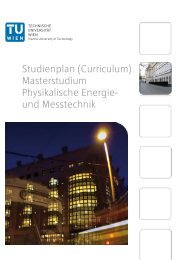frei.haus – Druckversion - Technische Universität Wien
frei.haus – Druckversion - Technische Universität Wien
frei.haus – Druckversion - Technische Universität Wien
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
TU|<strong>frei</strong>.<strong>haus</strong> – <strong>Druckversion</strong> der Ausgabe Nr. 25 (Jänner 2013)<br />
abgeschossen oder dem Wildtierforschungsinstituts am Wilheminenberg privat übergeben.<br />
Es wurde also kein Tier für die Studie getötet.<br />
Während in der Luft das radioaktive Iod schon nach kurzer Zeit nicht mehr nachweisbar ist,<br />
lässt sich in Schilddrüsen die erhöhte Konzentration auch nach Wochen noch messen. "Für<br />
die Tiere sind diese minimalen Konzentrationen an radioaktivem Iod gesundheitlich<br />
unbedenklich, aber uns gibt das Iod eine neue, hocheffiziente Möglichkeit in die Hand,<br />
Atomwaffentests nachzuweisen", sagt Georg Stein<strong>haus</strong>er.<br />
Stopp für Atomwaffentests<br />
Mit dem Nachweis von Atomwaffentests beschäftigt sich auch die CTBTO (Comprehensive<br />
Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation), eine internationale Organisation mit Sitz in <strong>Wien</strong>. Sie<br />
wacht über den Kernwaffenteststopp-Vertrag, der weitere Kernwaffenexplosionen verhindern<br />
soll. Die CTBTO betreibt ein weltweites Netzwerk an Messstationen, die Atom-Explosionen<br />
gegebenenfalls nachweisen sollen. Dieser Nachweis wird heute einerseits durch seismische<br />
Detektoren geführt, mit denen die Erschütterung durch die Explosion gemessen wird,<br />
andererseits durch Messungen von Radionukliden in der Luft. "Der von uns vorgeschlagene<br />
Biomonitor Schilddrüse ist ungefähr eine Größenordnung empfindlicher als die derzeit von<br />
der CTBTO betriebenen Messstationen", sagt Stein<strong>haus</strong>er.<br />
Factbox: Georg Stein<strong>haus</strong>er<br />
Georg Stein<strong>haus</strong>er studierte Chemie an der TU <strong>Wien</strong>. Seine Arbeit auf dem<br />
Gebiet der Radiochemie führte ihn an das Atominstitut, wo er am Reaktor als<br />
Strahlenphysiker arbeitete. Bekannt wurde Stein<strong>haus</strong>er durch eine Vielzahl von<br />
Medienauftritten, ganz besonders nach dem Reaktorunglück von Fukushima<br />
war seine Expertise äußerst gefragt. Seit Mitte Jänner 2013 arbeitet er an der<br />
Colorado State University in Fort Collins (USA).<br />
Der Molekül-Baukasten: Strukturen, die sich selbst<br />
zusammenbauen<br />
Elise Richter Stipendium für Emanuela Bianchi: Sie<br />
untersucht Partikel, die sich automatisch zu kristallartigen<br />
Strukturen zusammenfügen – ein neues<br />
Hoffnungsgebiet für die Materialforschung.<br />
Florian Aigner<br />
(Büro für Öffentlichkeitsarbeit)<br />
Sie sind winzig, sie sind vielseitig, sie könnten in der<br />
Materialwissenschaft bald eine besonders wichtige Rolle<br />
spielen: "Patchy Colloids" sind mikroskopisch kleine Partikel,<br />
die aneinander andocken und sich ganz von selbst zu<br />
Emanuela Bianchi<br />
komplizierten Strukturen formieren können. Nun zeichnet<br />
sich eine völlig neue Methode ab, solche Partikel her-zustellen. Emanuela Bianchi forscht seit Jahren<br />
an diesem Thema, sie wurde dafür 2012 mit einem Elise Richter Stipendium ausgezeichnet.<br />
31