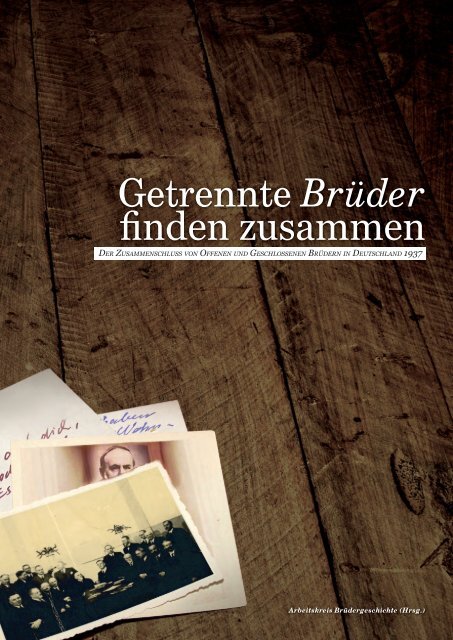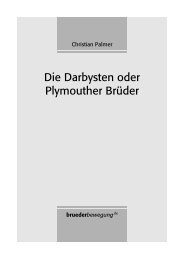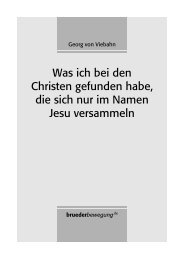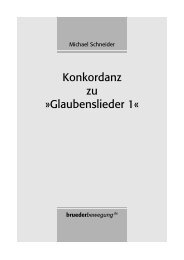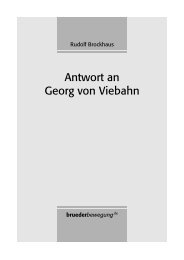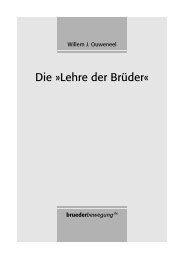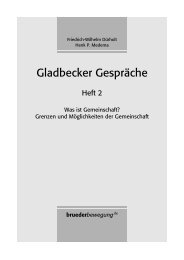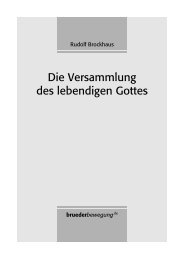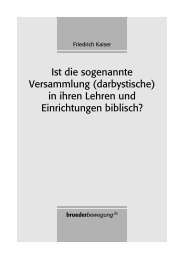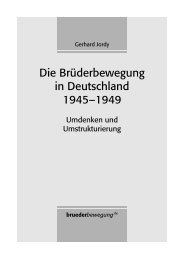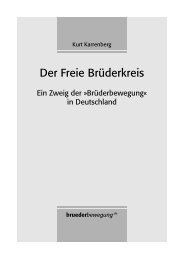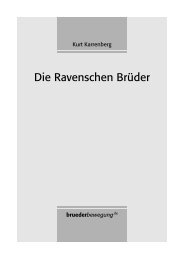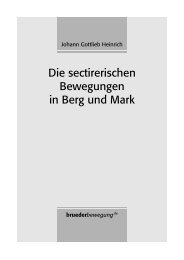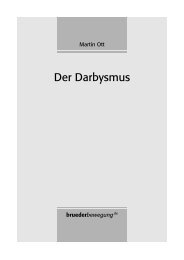Getrennte Brüder finden zusammen - bruederbewegung.de
Getrennte Brüder finden zusammen - bruederbewegung.de
Getrennte Brüder finden zusammen - bruederbewegung.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Getrennte</strong> <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong><br />
fi n<strong>de</strong>n <strong>zusammen</strong><br />
DER ZUSAMMENSCHLUSS VON OFFENEN UND GESCHLOSSENEN BRÜDERN IN DEUTSCHLAND 1937<br />
Arbeitskreis <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>geschichte (Hrsg.)
Vorträge <strong>de</strong>r Ge<strong>de</strong>nkveranstaltung am 24. November 2012<br />
in <strong>de</strong>r Evangelisch-Freikirchlichen Gemein<strong>de</strong> Bad Lausick<br />
Herausgeber: Arbeitskreis »Geschichte <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung«<br />
(www.brue<strong>de</strong>rgeschichte.<strong>de</strong>)<br />
2., durchgesehene Ausgabe<br />
© 2012: die Autoren<br />
Lektorat und Satz: Michael Schnei<strong>de</strong>r<br />
Umschlaggestaltung: www.antwortzeit.<strong>de</strong><br />
Veröffentlicht im Internet unter<br />
http://www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/getrenntebrue<strong>de</strong>r.pdf<br />
<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong> .<strong>de</strong>
Inhalt<br />
Gerd Goldmann:<br />
Einführung ........................................................................4<br />
Andreas Liese:<br />
1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung ..................................6<br />
Joachim Heim, Jürgen Goldnau:<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Chemnitz .................................................26<br />
Lothar Jung:<br />
Auswirkungen am Beispiel <strong>de</strong>r Werke in Rehe, Lützeln und Burgstädt ......................29<br />
Andreas Schmidt:<br />
»Was haben wir damit zu tun?«<br />
Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung damals und heute ........................ 32<br />
Jurek Karzelek:<br />
Einflüsse <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« auf Osteuropa vor und nach 1937 ........................39<br />
Ralf Kaemper:<br />
Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung<br />
in <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung ................................................ 41<br />
Fares Marzone:<br />
Die IBCM-Konferenzen als Einheit stiften<strong>de</strong> Einrichtung<br />
<strong>de</strong>r weltweiten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung ..................................................... 51<br />
Neil Summerton:<br />
Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in weltweiter Sicht .............................................. 55
Einführung<br />
Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n in Deutschland haben ein weltweit einmaliges Erbe: Vor 75 Jahren, am 16. November<br />
1937, wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Berliner Hohenstaufenstraße <strong>de</strong>r Zusammenschluss <strong>de</strong>r von John Nelson<br />
Darby herkommen<strong>de</strong>n »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« mit <strong>de</strong>n von Georg Müller herkommen<strong>de</strong>n »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« besiegelt. Diese bei<strong>de</strong>n größten Richtungen <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung hatten sich nach einem<br />
Streit im Jahr 1848 getrennt.<br />
Die Bibel ist ein<strong>de</strong>utig: Die Einheit <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r Gottes ist Geschenk und Gebot gleichzeitig. Mit<br />
dieser Erkenntnis ist die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung angetreten. Deswegen freuen wir uns, dass Gott 1937 <strong>de</strong>n<br />
Weg zur Einheit <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in Deutschland geebnet hat und dass ihre Leiter mutig darauf<br />
eingegangen sind.<br />
Wir verkennen allerdings nicht, dass <strong>de</strong>r Zusammenschluss auch durch Umstän<strong>de</strong> geför<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>,<br />
die im historischen Rückblick fragwürdig erscheinen. Dazu gehört die Angst vor <strong>de</strong>m nationalsozialistischen<br />
Staat, <strong>de</strong>r die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n durch das Verbot <strong>de</strong>r »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« im April<br />
1937 schockiert hatte. Auch <strong>de</strong>r anschließend gegrün<strong>de</strong>te Bund (BfC) ist nicht unumstritten. Und<br />
überhaupt vermisst man im Rückblick eine gründliche biblische Reflexion <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« zum Staat.<br />
Durch die Weimarer Zeit und mit <strong>de</strong>m aufkommen<strong>de</strong>n Nationalsozialismus wur<strong>de</strong>n die alten traditionellen<br />
Bil<strong>de</strong>r in Frage gestellt. Fast schon verzweifelt klammerte man sich an die Auffor<strong>de</strong>rung, <strong>de</strong>r<br />
Obrigkeit untertan zu sein. Für viele war das <strong>de</strong>r einzige Aspekt, ohne dass sie erkannten, wie <strong>de</strong>r<br />
politische Zeitgeist auch sie verän<strong>de</strong>rte und ihre Einigungsbemühungen begleitete.<br />
Trotz dieses unangenehmen Beigeschmacks erkennt man bei <strong>de</strong>n Leitern <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Strömungen<br />
ein ernstes geistliches Bemühen um die Einheit. Es ist eindrucksvoll, wie schnell sie theologische<br />
Unterschie<strong>de</strong>, die fast ein ganzes Jahrhun<strong>de</strong>rt gepflegt wor<strong>de</strong>n waren, überbrücken konnten: »Die<br />
Aussprache hat ergeben, dass zwischen bei<strong>de</strong>n Gruppen in Deutschland keine Meinungsverschie<strong>de</strong>nheiten<br />
mehr bestehen. Alles, was in <strong>de</strong>r Vergangenheit trennend zwischen uns gestan<strong>de</strong>n hat, sehen<br />
wir als für immer abgetan an.« So wird das entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Gespräch in <strong>de</strong>r »Kasseler Erklärung«<br />
<strong>zusammen</strong>gefasst.<br />
Allerdings ist es auch beschämend, dass es <strong>de</strong>s staatlichen Drucks und mancher fragwürdiger Begleiterscheinung<br />
bedurfte, um die Einheit zustan<strong>de</strong> zu bringen. Offensichtlich war das alles viel wirksamer<br />
als das wun<strong>de</strong>rbare göttliche Geschenk <strong>de</strong>r Einheit und sein liebevolles Gebot, die Einheit <strong>de</strong>s<br />
Geistes zu bewahren durch das Band <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns. Hier können wir aus <strong>de</strong>r Geschichte lernen und<br />
uns in unserer Zeit, in <strong>de</strong>r wir alle Freiheiten genießen, geistlich neu auf die Einheit <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« hin<br />
orientieren. Nehmen wir <strong>de</strong>n Impuls von Bad Lausick auf, um uns zu fragen, wie unser Beitrag dazu<br />
heute aussehen könnte!<br />
Deshalb bin ich dankbar für die vorliegen<strong>de</strong> Dokumentation, die sich bemüht, die Fakten im Licht<br />
<strong>de</strong>r geschichtlichen Forschung darzustellen, was <strong>de</strong>r Historiker Dr. Andreas Liese übernommen hat.<br />
Lothar Jung beschreibt Auswirkungen <strong>de</strong>s Zusammenschlusses am Beispiel einiger Werke <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«<br />
in Deutschland, und Joachim Heim und Jürgen Goldnau geben einen interessanten Bericht über<br />
die Entwicklung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Chemnitz ab 1937.<br />
Um nicht nur historische Fakten zu sammeln, son<strong>de</strong>rn aus <strong>de</strong>r Geschichte zu lernen, haben Andreas<br />
Schmidt und Ralf Kaemper theologische Fragestellungen, die bei <strong>de</strong>r Vereinigung <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«<br />
und in ihrem gesellschaftlichen Umfeld eine wichtige Rolle gespielt haben, bearbeitet und in die<br />
heutige Zeit projiziert.<br />
Andreas Schmidt beschäftigt sich mit <strong>de</strong>r angesprochenen Frage nach <strong>de</strong>n geistlichen Maßstäben<br />
bei <strong>de</strong>r Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung. Er zeigt auf, dass die »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« gewohnt<br />
waren, sich »von dieser abgefallenen Welt zu lösen und in einen abgegrenzten Raum zurückzuziehen«.<br />
Deshalb war es für sie sehr schwer, eine angemessene biblische Orientierung zu <strong>fin<strong>de</strong>n</strong>, als <strong>de</strong>r<br />
»nationale Aufbruch« plötzlich das ganze Leben politisierte. Wie aber orientieren wir uns heute,<br />
angesichts vieler Möglichkeiten, die uns angeboten wer<strong>de</strong>n?
Gerd Goldmann: Einführung 5<br />
Ralf Kaemper behan<strong>de</strong>lt eine Kernfrage <strong>de</strong>r weltweiten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung, nämlich das Spannungsfeld<br />
zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung. Einheit be<strong>de</strong>utet nach <strong>de</strong>r Schrift die Einheit aller Kin<strong>de</strong>r<br />
Gottes. Was aber, wenn man mit nieman<strong>de</strong>m mehr Abendmahl feiern und mit nieman<strong>de</strong>m mehr<br />
<strong>zusammen</strong>arbeiten kann außer mit Geschwistern aus <strong>de</strong>m eigenen Kreis, weil <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren angeblich<br />
»Böses« anhaftet, von <strong>de</strong>m man sich abson<strong>de</strong>rn muss? Wenn sich also die Einheit nur im eigenen<br />
Kreis o<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>m eigenen »Bo<strong>de</strong>n« verwirklicht und damit die an<strong>de</strong>ren ausgrenzt? Diese Haltung,<br />
die 1937 überwun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>, wird theologisch hinterfragt.<br />
Die <strong>de</strong>utsche <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung steht im weltweiten Kontext. Das zeigten bereits die Reaktionen<br />
<strong>de</strong>r ausländischen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« auf <strong>de</strong>n Zusammenschluss von 1937. Während die internationalen »Geschlossenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« die vereinigten <strong>de</strong>utschen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« im Juli 1938 aus ihrer Gemeinschaft ausschlossen,<br />
zeigten sich die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« durch die Englän<strong>de</strong>r Edmund H. Broadbent und George<br />
Henry Lang zur Zusammenarbeit bereit. Die <strong>de</strong>utschen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« hielten sich <strong>de</strong>mnach zu <strong>de</strong>n »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n«.<br />
Deswegen haben wir drei beson<strong>de</strong>re internationale Gäste eingela<strong>de</strong>n, die unsere Analysen und<br />
Überlegungen in einen weltweiten Rahmen stellen. Da ist zunächst <strong>de</strong>r Englän<strong>de</strong>r Dr. Neil Summerton,<br />
vermutlich momentan <strong>de</strong>r beste Kenner <strong>de</strong>r weltweiten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung. Neil macht einige<br />
Anmerkungen zum Thema Einheit und Abson<strong>de</strong>rung bei <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n«, beschäftigt sich<br />
aber vor allem mit aktuellen Herausfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r weltweiten Bewegung <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«.<br />
Zusammen mit Dr. Fares Marzone organisiert er seit 20 Jahren die internationalen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>konferenzen<br />
IBCM, die sehr viel zur Einheit und I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r weltweiten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n beigetragen haben.<br />
Fares berichtet als Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Organisationskomitees über die Auswirkung dieser Konferenzen<br />
auf die Einheit <strong>de</strong>r weltweiten Bewegung. Die I<strong>de</strong>e, durch weltweite und regionale Konferenzen anerkannter<br />
Leiter die Einheit zu för<strong>de</strong>rn, haben bei<strong>de</strong> <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> konsequent und mit hohem Einsatz verfolgt.<br />
Außer<strong>de</strong>m haben wir unseren polnischen Nachbarn Jurek Karzelek eingela<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r über die<br />
Einflüsse <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« auf Osteuropa vor und nach 1937 sprechen wird.<br />
Der Arbeitskreis »Geschichte <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung«, <strong>de</strong>r diese Tagung veranstaltet, arbeitet daran,<br />
das in <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung oft mangelhafte Geschichtsbewusstsein zu för<strong>de</strong>rn, in<strong>de</strong>m er geschichtliche<br />
Abläufe erforscht, <strong>de</strong>r Gegenwart zugänglich macht und versucht, Lehren für Gegenwart und<br />
Zukunft zu ziehen. Dazu verfügt er über ein eigenes Archiv, das beim Forum Wie<strong>de</strong>nest gepflegt wird.<br />
Dr. Gerd Goldmann<br />
Leiter <strong>de</strong>s Arbeitskreises<br />
»Geschichte <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung«
1 Vgl. dazu u. a. die Darstellung bei Jordy, B<strong>de</strong>. 1–2.<br />
Andreas Liese<br />
1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung<br />
1. Einleitung<br />
1937 als das Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung zu bezeichnen ist nicht übertrieben. Das<br />
Verbot <strong>de</strong>r »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, oft auch als »Christliche Versammlung« bezeichnet, die Gründung<br />
<strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s freikirchlicher Christen (BfC), die Vereinigung <strong>de</strong>s BfC mit <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n«<br />
o<strong>de</strong>r Kirchenfreien christlichen Gemein<strong>de</strong>n (KcG) – all das rechtfertigt durchaus dieses Urteil.<br />
Zum Zusammenschluss <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Richtungen sind nun drei Anmerkungen notwendig. Mit dieser<br />
Vereinigung war zum ersten Mal in einem Land die unselige Trennung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-<br />
Gruppen been<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n, obwohl sich nicht alle »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« diesem Schritt anschlossen.<br />
Darüber hinaus fällt auf, dass dieses be<strong>de</strong>utsame Ereignis auf <strong>de</strong>r einen Seite später von <strong>de</strong>n Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen<br />
um das Zusammengehen von »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« und Baptisten überlagert wur<strong>de</strong>, auf <strong>de</strong>r<br />
an<strong>de</strong>ren Seite aber die Vereinigung von 1937 we<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« im BEFG noch vom Freien<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>kreis in Frage gestellt wur<strong>de</strong>. Gera<strong>de</strong> Letzterer begrüßte in verschie<strong>de</strong>nen Verlautbarungen<br />
diesen Zusammenschluss, während das Zusammengehen mit <strong>de</strong>n Baptisten strikt abgelehnt wur<strong>de</strong>.<br />
Auch die Gründung <strong>de</strong>s BfC wur<strong>de</strong> als eine For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s NS-Staates, <strong>de</strong>r man sich nicht entziehen<br />
konnte, verteidigt. Nur die 1945 wie<strong>de</strong>r offiziell erlaubten »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« lehnten <strong>de</strong>n BfC,<br />
beson<strong>de</strong>rs aber auch die Vereinigung mit <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« ab.<br />
Im Folgen<strong>de</strong>n soll es zum einen darum gehen, wie die Ereignisse <strong>de</strong>s Jahres 1937 historisch rekonstruiert<br />
wer<strong>de</strong>n können, zum an<strong>de</strong>ren soll nach <strong>de</strong>ren Beurteilung gefragt wer<strong>de</strong>n.<br />
2. Die »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« bis 1937<br />
2.1. Innere Entwicklung 1<br />
Neben Anfängen in Süd<strong>de</strong>utschland und vor allem im Rheinland (Julius Anton von Poseck) ist die<br />
Entstehung von <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n hauptsächlich mit <strong>de</strong>m Namen Carl Brockhaus (1822–1899) verbun<strong>de</strong>n.<br />
Maßgeblich durch ihn beeinflusst entstand 1853 die wichtigste <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>versammlung in Elberfeld.<br />
Aufgrund seiner Reisetätigkeit kam es in Deutschland innerhalb eines kurzen Zeitraums überall<br />
zur Gründung von <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>versammlungen. Sehr früh entwickelten sich bestimmte Strukturen <strong>de</strong>r<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung: 2 sog. Lehrkonferenzen, an <strong>de</strong>nen möglichst die aktiven <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> aus verschie<strong>de</strong>nen<br />
Versammlungen teilnahmen; damit wur<strong>de</strong> eine gewisse Einheitlichkeit <strong>de</strong>r Lehre bewirkt. Dazu kam<br />
die Einrichtung <strong>de</strong>s sog. Reisebrü<strong>de</strong>rtums: <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>, die sich nach Ansicht <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren im örtlichen<br />
und regionalen Bereich bewährt hatten (Beteiligung an <strong>de</strong>n Bibelgesprächen in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>, <strong>de</strong>n<br />
sog. Wortbetrachtungen; Übernahme von Predigtdiensten und Engagement in <strong>de</strong>r Seelsorge), gaben<br />
ihre Berufe auf und übten überregionale Gemein<strong>de</strong>dienste aus. Der bekannteste Bru<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r im<br />
»Werk <strong>de</strong>s Herrn« arbeitete, war natürlich Carl Brockhaus. Zeitschriften, hier ist v. a. <strong>de</strong>r Botschafter<br />
<strong>de</strong>s Heils zu nennen, dienten <strong>de</strong>r brü<strong>de</strong>rspezifischen Belehrung und <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>r Bewegung.<br />
Entschei<strong>de</strong>nd war aber das grundlegen<strong>de</strong> Selbstverständnis: Die »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« (so ihre Fremdbezeichnung)<br />
kamen getrennt von allen »menschlichen Systemen« – wozu man nicht nur die großen Kirchen,<br />
son<strong>de</strong>rn auch die klassischen Freikirchen zählte – allein zum Namen Jesu <strong>zusammen</strong>. Den<br />
Höhepunkt stellte das sonntägliche Abendmahl (»Brotbrechen«) dar; hier war man am »Tisch <strong>de</strong>s<br />
Herrn«. Da <strong>de</strong>r Verfall <strong>de</strong>s christlichen Zeugnisses unmittelbar nach <strong>de</strong>r apostolischen Zeit eingetreten<br />
war und entsprechend <strong>de</strong>r Theologie Darbys auch keine Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>s ursprünglichen<br />
2 Bis heute legen beson<strong>de</strong>rs die »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« großen Wert darauf, dass es sich bei ihnen um eine Bewegung<br />
han<strong>de</strong>lt.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 7<br />
Zustan<strong>de</strong>s möglich war (Verfallstheorie), konnte es in <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« auch keine<br />
festen Ämter geben. Es existierten lediglich bestimmte Dienste, zu <strong>de</strong>nen aber keiner offiziell berufen<br />
wur<strong>de</strong>. Das erklärt auch die scheinbare Organisationslosigkeit. Sieht man genauer hin, sind informelle<br />
Organisationsstrukturen zu erkennen, die aber bekanntlich schwer zu greifen sind.<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod Carl Brockhaus’ wuchs sein Sohn Rudolf sehr schnell in eine führen<strong>de</strong> Rolle hinein<br />
und wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r informelle Nachfolger seines Vaters. 3 Unter seiner Führung fand eine lehrmäßige<br />
Festigung statt; hier wäre zum einen auf die literarische Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit Autoren <strong>de</strong>r Freien<br />
evangelischen Gemein<strong>de</strong>n hinzuweisen, in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Abson<strong>de</strong>rungsstandpunkt weiter ausgebaut wur<strong>de</strong>,<br />
zum an<strong>de</strong>ren wur<strong>de</strong> die Lehre vom »Tisch <strong>de</strong>s Herrn« in einer Diskussion mit Vertretern <strong>de</strong>r<br />
»Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« präzisiert. Letztlich lief es darauf hinaus, dass nur bei <strong>de</strong>n »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n«,<br />
die von allen menschlichen Systemen getrennt und von allem lehrmäßigen und praktischen<br />
Bösen abgeson<strong>de</strong>rt waren, <strong>de</strong>r Tisch <strong>de</strong>s Herrn war; an<strong>de</strong>re Gemeinschaften feierten das Abendmahl<br />
höchstens als Erinnerungsmahl. Damit hatten die »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« eine einheitliche Lehrauffassung<br />
erhalten, die sie allerdings von <strong>de</strong>n übrigen Christen, die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« eingeschlossen,<br />
trennte.<br />
Der Tod Rudolf Brockhaus’ 1932 wur<strong>de</strong> als gravieren<strong>de</strong>r Einschnitt empfun<strong>de</strong>n. Viele meinten, er<br />
hinterlasse eine Lücke, die kaum zu schließen sei. An seine Stelle traten jetzt u. a. sein Neffe Ernst<br />
Brockhaus, <strong>de</strong>r vielfältige Aufgaben übernahm (überörtliche Kassen, Herausgabe <strong>de</strong>r Mitteilungen aus<br />
<strong>de</strong>m Werke <strong>de</strong>s Herrn usw.), und sein Sohn Wilhelm Brockhaus, <strong>de</strong>r allein verantwortlicher Schriftleiter<br />
<strong>de</strong>s Botschafters wur<strong>de</strong>. Dazu kam Fritz von Kietzell, seit 1928 Schriftleiter <strong>de</strong>r Jugendzeitschrift Die<br />
Tenne und verantwortlich für Kontakte mit <strong>de</strong>n Behör<strong>de</strong>n.<br />
Aber nach 1932 häuften sich Klagen über eine Verflachung <strong>de</strong>s Gemein<strong>de</strong>lebens, die Verweltlichung<br />
und <strong>de</strong>n Formalismus in <strong>de</strong>n Versammlungen. 4 Den vorläufigen Höhepunkt stellte ein offener<br />
Brief Kietzells an Wilhelm Brockhaus dar, in <strong>de</strong>m er die Frage stellte, ob Gott die »Christliche Versammlung«<br />
wirklich noch mit seiner beson<strong>de</strong>ren Kraft begleite. 5 So entwickelte sich die Vorstellung,<br />
dass ein Gericht Gottes zu erwarten sei.<br />
Parallel zu diesen Entwicklungen entstand die sog. Stündchenbewegung. Die Anfänge liegen in<br />
Essen-Dellwig; <strong>de</strong>r dortigen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>versammlung gehörte <strong>de</strong>r promovierte Jurist Hans Becker an. Man<br />
begann hier in kleinem Kreis mit intensivem Bibelstudium. 1932 zog Becker nach Dortmund um, wo<br />
die gemeinsamen Bibelstudien ihre Fortsetzung fan<strong>de</strong>n. Später begann man mit mehrtägigen überregionalen<br />
Treffen. Der Teilnehmerkreis war sehr heterogen; führend waren neben Becker <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> wie<br />
Carl Koch, Walter Vogelbusch u.a., die dann später im BfC an führen<strong>de</strong>r Stelle tätig waren. Aber auch<br />
spätere »Nichtbündler«, also <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>, die nicht <strong>de</strong>m BfC beitraten, nahmen an diesen Treffen teil. Zu<br />
erwähnen wären hier u. a. Wilhelm Stücher, Gerhard Löwen und Felix Brockhaus.<br />
Die eigentlichen Initiatoren – neben Becker auch Walter Vogelbusch, Walter Engels u.a. – begriffen<br />
sich als Erneuerungsbewegung. Es ging primär um eine intensive Erforschung <strong>de</strong>r Lehre <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«.<br />
Man wollte tiefer in dieses Gedankengut eindringen und studierte die Schriften – hier v. a.<br />
Beiträge <strong>de</strong>s Botschafters – intensiv. Man begann auch, Literatur aus an<strong>de</strong>ren Kreisen zu verwen<strong>de</strong>n.<br />
Das Ganze wirkte auf viele sehr intellektuell und stieß beson<strong>de</strong>rs bei <strong>de</strong>n Reisebrü<strong>de</strong>rn (v. a. bei <strong>de</strong>n<br />
Älteren) auf Kritik. Eine öffentliche Aussprache über Ansichten von »Stündchenleuten« zur Heilssicherheit<br />
<strong>de</strong>s Christen, die <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r älteren <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> nicht entsprachen, brachte keine Annäherung<br />
<strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Seiten. 6<br />
3 Zu Rudolf Brockhaus vgl. die Kurzbiografie von Ulrich Brockhaus in Perspektive 7 (2007), Heft 5, S. 25–28 (auch<br />
online unter www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/brockhausbrockhaus.pdf).<br />
4 Vgl. dazu Hans Neuffer, [Gedanken über die im Laufe <strong>de</strong>r Zeit im Kreise <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> aufgetretenen Schä<strong>de</strong>n], geschrieben<br />
im Anschluss an die Konferenz in Siegen 1932, www.bru<strong>de</strong>rbewegung.<strong>de</strong>/pdf/neuffer.pdf.<br />
5 Achiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Jordy, 1933–1945, Fritz von Kietzell an Wilhelm Brockhaus, 1936.<br />
6 Vgl. das Protokoll <strong>de</strong>r Siegener Besprechung von 1936, abgedruckt bei Menk, S. 43–47.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 8<br />
Auch auf diesen Konflikt ging Kietzell in seinem oben erwähnten Brief ein. Gleichzeitig ließ er<br />
erkennen, dass er sich <strong>de</strong>n Positionen <strong>de</strong>r »Stündchenleute« annäherte. In Herbst 1936 begann dann<br />
ein Austausch von offenen Briefen, <strong>de</strong>r mit einem Brief Beckers und einer Antwort Kaupps en<strong>de</strong>te. Es<br />
zeigte sich, dass die Kluft nicht mehr zu überbrücken war.<br />
2.2. Die »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« im NS-Staat 7<br />
Dass »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« sich nicht auf die Politik – wozu u. a. auch die Ausübung <strong>de</strong>s Wahlrechts gehörte –<br />
einlassen sollen, weil sie als Himmelsbürger »Fremdlinge« in dieser Welt seien, wur<strong>de</strong> in einer Abhandlung<br />
von Fritz von Kietzell 1928, die sowohl im Botschafter als auch in <strong>de</strong>r Tenne erschien, nachdrücklich<br />
betont. 8 Noch 1933 verteilte man ein kurzes Traktat von Darby, in <strong>de</strong>m er die Teilnahme an<br />
Wahlen ablehnte.<br />
Doch schon im Herbst 1933 begann sich die Praxis zu verän<strong>de</strong>rn. Im November wur<strong>de</strong> eine »Vertrauliche<br />
Mitteilung« herausgegeben, die in <strong>de</strong>n einzelnen Versammlungen verlesen wer<strong>de</strong>n sollte.<br />
Hier hieß es u.a., dass man Gott für die Bewahrung vor <strong>de</strong>n Schrecken <strong>de</strong>s Kommunismus danke und<br />
<strong>de</strong>shalb <strong>de</strong>n Wunsch <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Regierung nach einer »tatkräftigen Unterstützung«<br />
erfüllen müsse. Aufgrund <strong>de</strong>r zeitlichen Ansetzung <strong>de</strong>r Versendung dieses Rundschreibens – nach<br />
<strong>de</strong>m Austritt Deutschlands aus <strong>de</strong>m Völkerbund und vor <strong>de</strong>n Wahlen im November – interpretierten<br />
einige dieses Schreiben als Auffor<strong>de</strong>rung zum Wählen. Genau dies unterstrich Ernst Brockhaus, ein<br />
Mitunterzeichner, in einem Briefwechsel mit Wilhelm Stücher: Diesmal habe eine ganze Reihe von<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n die Auffassung vertreten, eine Teilnahme an <strong>de</strong>n Wahlen sei durchaus erwünscht.<br />
Auch an weiteren NS-Scheinwahlen wur<strong>de</strong> teilgenommen. Die Mitgliedschaft in einer NS-Organisation<br />
wie beispielsweise <strong>de</strong>r »Deutschen Arbeitsfront« stellte für viele kein Problem dar. Ebenso<br />
sind Mitgliedschaften in <strong>de</strong>r NSDAP nachweisbar. 9 Diese verän<strong>de</strong>rten Praktiken schlugen sich aber<br />
nicht in einer Revision <strong>de</strong>r bisherigen Lehre <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« an diesem Punkt nie<strong>de</strong>r. Offiziell galt immer<br />
noch die darbystische Abson<strong>de</strong>rung von Politik und Kultur. 1935 fertigte Kietzell eine »Denkschrift«<br />
für Behör<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Staates an. In dieser beschrieb er die geschichtliche Entwicklung <strong>de</strong>r »Christen<br />
ohne Son<strong>de</strong>rbekenntnis«. Hinsichtlich <strong>de</strong>s Verhältnisses zum Staat wur<strong>de</strong> lediglich auf die einschlägigen<br />
Bibeltexte verwiesen, die zum Untertansein auffor<strong>de</strong>rn. Eine Verhältnisbestimmung zum<br />
NS-Staat erfolgte nicht.<br />
3. Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« bis 1937<br />
Da in <strong>de</strong>r Frage <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>s Zusammengehens <strong>de</strong>r »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« mit <strong>de</strong>n »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« immer wie<strong>de</strong>r Vorgänge in England aus <strong>de</strong>n 1840er Jahren eine Rolle spielten, soll auf diese<br />
hier kurz eingegangen wer<strong>de</strong>n. 10<br />
In Plymouth, <strong>de</strong>r größten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>versammlung in England, kam es zu Spannungen. Ein führen<strong>de</strong>r<br />
Bru<strong>de</strong>r, Benjamin Wills Newton, hatte dort die Leitung <strong>de</strong>r Gottesdienste übernommen, außer<strong>de</strong>m<br />
hatte sich eine Gruppe von <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n herausgebil<strong>de</strong>t, »die neben Newton <strong>de</strong>n Predigtdienst versah«. 11<br />
Für Darby stellte dies aber eine Wie<strong>de</strong>reinführung <strong>de</strong>s Klerikalismus dar. Da er und Newton in dieser<br />
Frage keinen Konsens herstellen konnten, trennte sich Darby En<strong>de</strong> 1845 von <strong>de</strong>r Versammlung in<br />
Plymouth und grün<strong>de</strong>te mit ca. 50–60 Personen eine zweite <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>versammlung. 12<br />
7 Vgl. zu diesem Punkt Liese, verboten.<br />
8 Die Tenne 6 (1928), S. 147.<br />
9 So war Edgar Claus, führen<strong>de</strong>r Angehöriger <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>versammlung in Leipzig, seit 1933 Mitglied <strong>de</strong>r NSDAP.<br />
10 Vgl. zum Folgen<strong>de</strong>n die Darstellungen bei Geldbach, Coad und Rowdon.<br />
11 Geldbach, S. 41.<br />
12 Ebd., S. 42f.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 9<br />
Weitere Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen entstan<strong>de</strong>n, als Darby und an<strong>de</strong>re seiner Anhänger Newton einer<br />
christologischen Irrlehre bezichtigten. 13 Zum Schisma <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung kam es dann, als zwei<br />
Glie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r »alten« Plymouth-Versammlung (d. h. <strong>de</strong>r Newton-Gemein<strong>de</strong>) nach Bristol umzogen.<br />
Nach ihrer Zulassung zum Abendmahl beschuldigte Darby die Bethesda-Versammlung (so benannt<br />
nach <strong>de</strong>m dortigen Versammlungsraum) unter <strong>de</strong>r Führung von Georg Müller und Henry Craik, dass<br />
sie Parteigänger Newtons und somit Anhänger eines Irrlehrers aufgenommen hätten. 14 Nach <strong>de</strong>m<br />
Austausch von Erklärungen trennte sich Darby mit einem Rundschreiben, <strong>de</strong>m sog. »Bethesda Circular«,<br />
15 von <strong>de</strong>r Versammlung in Bethesda, was praktisch einer Exkommunikation <strong>de</strong>r ganzen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>versammlung<br />
gleichkam. Der Hauptvorwurf lautete, die Bristol-Versammlung habe durch die Aufnahme<br />
von Personen aus <strong>de</strong>r Newton-Versammlung in Plymouth diese »Irrlehre« nicht nur unterstützt,<br />
son<strong>de</strong>rn sie habe sich auch mit diesem Gedankengut i<strong>de</strong>ntifiziert. Alle nun, die kirchliche<br />
Gemeinschaft mit <strong>de</strong>r Bethesda-Versammlung hätten, wür<strong>de</strong>n sich ebenfalls mit <strong>de</strong>m Bösen, also<br />
letztlich mit <strong>de</strong>r Ketzerei Newtons i<strong>de</strong>ntifizieren.<br />
Dieses Rundschreiben bewirkte, dass sich die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in zwei Richtungen spaltete. Diejenigen<br />
Versammlungen, die Darbys Position in dieser Angelegenheit teilten – und das waren damals<br />
die meisten –, bezeichnet man als Exclusive Brethren. Die Gruppen, die <strong>de</strong>n Standpunkt <strong>de</strong>r Bethesda-<br />
Versammlung teilten, wur<strong>de</strong>n Open Brethren genannt. Letztere ließen weiterhin Personen zum Abendmahl<br />
zu, die nach Feststellung einer örtlichen Versammlung eine persönliche Integrität als Christ<br />
besaßen – unabhängig davon, welcher <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>versammlung sie angehörten. 16 »Exklusive« Versammlungen<br />
ließen vor allem die Glie<strong>de</strong>r »offener« Versammlungen nicht teilnehmen; eine Abendmahlsteilnahme<br />
von Christen aus <strong>de</strong>n Denominationen war in Ausnahmefällen möglich. 17<br />
Auch betonten die Open Brethren das Prinzip <strong>de</strong>r Selbständigkeit einer örtlichen Gemein<strong>de</strong>. 18 Dagegen<br />
vertraten die Exclusive Brethren die Ansicht, dass die Entscheidung einer Versammlung – hier<br />
beson<strong>de</strong>rs die Exkommunikation eines Mitglieds – auch für alle an<strong>de</strong>ren Versammlungen weltweit<br />
13 Ebd., S. 44. Es ging um spekulative Überlegungen hinsichtlich <strong>de</strong>r Menschheit Jesu.<br />
14 Ebd., S. 44ff. In welchem Ausmaß die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> Woodfall, um <strong>de</strong>ren Abendmahlsteilnahme es ging, Anhänger <strong>de</strong>r<br />
Lehren Newtons waren, wird in <strong>de</strong>r Literatur kontrovers dargestellt. Miller, S. 58f. meint, dass Müller und Craik<br />
»einige von Newtons ergebenen Freun<strong>de</strong>n und Anhängern« trotz Protesten »gottesfürchtiger Männer« aus <strong>de</strong>r<br />
Bethesda-Gemein<strong>de</strong> in die Abendmahlsgemeinschaft aufgenommen hätten; auch Trotter schließt sich in einem<br />
ausführlichen Brief, <strong>de</strong>r die Trennung von 1848 behan<strong>de</strong>lt, dieser Version an (abgedruckt bei Gardiner, S. 6–56).<br />
Neatby, S. 157 schreibt, dass im April 1848 Kapitän Woodfall und sein Bru<strong>de</strong>r – gute Freun<strong>de</strong> Newtons – in <strong>de</strong>r<br />
Bethesda-Gemein<strong>de</strong> um Abendmahlsgemeinschaft nachgesucht hätten, wogegen es Opposition gegeben habe;<br />
Kapitän Woodfall wur<strong>de</strong> zugelassen, weil er sich auf Reisen befun<strong>de</strong>n hatte und man ihm unterstellte, dass er über<br />
<strong>de</strong>n Stand <strong>de</strong>r Streitigkeiten unwissend sei. Sein Bru<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong> von Anhängern Darbys, die auch die Einwän<strong>de</strong><br />
gegen die Abendmahlszulassung vorgebracht hatten, auf seine »Rechtgläubigkeit« hin überprüft und schließlich<br />
auf ihr Zeugnis hin zugelassen. Rowdon, S. 261 spricht ebenfalls davon, dass die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> Woodfall – einer <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n<br />
habe Newton prinzipiell unterstützt – von <strong>de</strong>njenigen, die Einwän<strong>de</strong> gegen die Abendmahlsteilnahme gehabt<br />
hätten, überprüft und auf ihre Empfehlung hin zugelassen wor<strong>de</strong>n seien. Coad, S. 156 weist darauf hin, dass man<br />
sich in <strong>de</strong>r »Heimatversammlung« Newtons in Plymouth Anfang 1848 mit einer Erklärung von seinen Lehren<br />
distanziert habe; bezüglich <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> Woodfall weist auch er auf die Tatsache hin, dass Kapitän Woodfall während<br />
<strong>de</strong>r Plymouth-Kontroversen auf <strong>de</strong>m Festland gewesen sei; sein Bru<strong>de</strong>r sei von Darbys Anhängern befragt wor<strong>de</strong>n,<br />
die daraufhin bekanntgaben, dass er frei von Häresie sei.<br />
15 Abgedruckt in The Collected Writings of J. N. D., Bd. 15, S. 164–167.<br />
16 Vgl. Geldbach, S. 47.<br />
17 So wur<strong>de</strong>n 1921 bei einem internationalen Treffen von »führen<strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« empfehlen<strong>de</strong> Hinweise ausgesprochen,<br />
unter welchen Umstän<strong>de</strong>n Christen aus <strong>de</strong>n Denominationen am Abendmahl teilnehmen könnten (»Baseler<br />
Brief«, abgedruckt bei Menk, S. 234f.).<br />
18 Karrenberg, S. 274.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 10<br />
bin<strong>de</strong>nd sei. 19 Damit hatten sich in <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung zwei völlig entgegengesetzte ekklesiologische<br />
Prinzipien herausgebil<strong>de</strong>t.<br />
In Deutschland entstan<strong>de</strong>n Versammlungen <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« (auch das stellte eine Fremdbezeichnung<br />
dar) En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts in verschie<strong>de</strong>nen Gegen<strong>de</strong>n. Zu <strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utendsten Gemein<strong>de</strong>n<br />
wur<strong>de</strong>n u. a. die Gemeinschaft Berlin-Hohenstaufenstraße und die in Bad Homburg. In<br />
Berlin wur<strong>de</strong> 1905 auch die Allianz-Bibelschule gegrün<strong>de</strong>t, die dann 1919 nach Wie<strong>de</strong>nest im Oberbergischen<br />
verlegt wur<strong>de</strong>. An ihr lehrten Christoph Köhler und Johannes Warns. Wichtig ist, dass<br />
diese bei<strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>gründungen durch Kontakte zu <strong>de</strong>n Open Brethren in England entstan<strong>de</strong>n;<br />
diese Verbindungen blieben dann auch bestehen.<br />
Analog <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« verstan<strong>de</strong>n sich auch die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« als Bewegung<br />
und schreckten vor festen Gemein<strong>de</strong>strukturen zurück. Da man das allgemeine Priestertum<br />
praktizierte, gab es auch keine fest angestellten Prediger. Verstärkt wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bewegungscharakter<br />
durch die Betonung <strong>de</strong>r Selbständigkeit <strong>de</strong>r örtlichen Gemein<strong>de</strong>. 20 Diese Auffassung begünstigte bis<br />
in die dreißiger Jahre hinein <strong>de</strong>n relativ lockeren Verbund <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«. 21<br />
Aber Ernst Lange muss konstatieren, dass trotz <strong>de</strong>s offiziellen Anspruchs, die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«<br />
besäßen keine Organisation, auch sie eine informelle gehabt hätten. 22<br />
Später erkannten die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« ebenfalls die Notwendigkeit minimaler überörtlicher<br />
Strukturen. Auch bei ihnen wur<strong>de</strong>n Lehrkonferenzen durchgeführt. Zur wichtigsten wur<strong>de</strong> die Konferenz<br />
in Berlin (Hohenstaufenstraße), da hier übergemeindliche Angelegenheiten besprochen wur<strong>de</strong>n.<br />
23 Nach Theodor Küttner, einem führen<strong>de</strong>n Vertreter <strong>de</strong>r Leipziger Versammlung <strong>de</strong>r »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, betrug 1936 die Gesamtzahl <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« 8000 bis 10.000 Personen. 24<br />
Zu <strong>de</strong>n führen<strong>de</strong>n Figuren <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in <strong>de</strong>n 20er und 30er Jahren gehörten neben <strong>de</strong>m<br />
schon erwähnten Johannes Warns (Leiter <strong>de</strong>r Bibelschule Wie<strong>de</strong>nest) Heinrich Neumann (Berlin-<br />
Hohenstaufenstraße), Christian Schatz, Albert von <strong>de</strong>r Kammer und Ernst Lange. Letzterer betätigte<br />
sich ab 1933 als Publizist, <strong>de</strong>r sich beson<strong>de</strong>rs für die Zusammenarbeit <strong>de</strong>r freikirchlichen Christen<br />
einsetzte.<br />
Im Verhältnis zum Staat plädierte man dafür, sich <strong>de</strong>r Obrigkeit als einer »göttlichen Ordnung«<br />
unterzuordnen und ihr zu gehorchen, sofern die Anordnungen mit <strong>de</strong>r Bibel in Übereinstimmung<br />
seien. 25 Be<strong>de</strong>utsam ist, dass in <strong>de</strong>n Handreichungen, <strong>de</strong>r wichtigsten Zeitschrift, die Beteiligung an<br />
Wahlen befürwortet wur<strong>de</strong>; seine Stimme sollte man allerdings <strong>de</strong>m Vertreter »einer staatserhalten<strong>de</strong>n<br />
Richtung« geben. 26<br />
Wie die »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« nahmen auch die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« im Oktober 1933 Kontakt<br />
mit <strong>de</strong>r Regierung auf und erhielten vom zuständigen Referenten <strong>de</strong>s Reichsministeriums <strong>de</strong>s Inne-<br />
19 Vgl. Geldbach, S. 120.<br />
20 Warns, S. 20. Im Gegensatz zu <strong>de</strong>n »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« benutzte man für die örtlichen Gruppen durchaus<br />
<strong>de</strong>n Begriff »Gemein<strong>de</strong>«. Vgl. dazu die »Kurze Darlegung über kirchenfreie christliche Gemein<strong>de</strong>n«, in: Kretzer,<br />
S. 122–124.<br />
21 Vgl. Jordy, Bd. 2, S. 136: An <strong>de</strong>r Unabhängigkeit <strong>de</strong>r einzelnen Gemein<strong>de</strong>n voneinan<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Berliner<br />
Konferenz 1925 ausdrücklich festgehalten, ihre Übereinstimmung war mehr i<strong>de</strong>eller Natur.<br />
22 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Ernst Lange, Vertrauliche Bemerkungen zu <strong>de</strong>n »Gedanken«, 15. Oktober 1937,<br />
S. 2.<br />
23 Staatsarchiv Leipzig, PP-V 4872, Bl. 5, Vernehmung Theodor Küttner, 19. Februar 1936. Vgl. auch die »Kurze Darlegung«,<br />
in: Kretzer, S. 124: Die »an sich selbständigen Gemein<strong>de</strong>n« wür<strong>de</strong>n durch Konferenzen und hier beson<strong>de</strong>rs<br />
durch die »Arbeitskonferenz« in Berlin, auf <strong>de</strong>r »wichtige Fragen <strong>de</strong>r Lehre und <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>ordnung beraten«<br />
wür<strong>de</strong>n, <strong>zusammen</strong>gehalten.<br />
24 Staatsarchiv Leipzig, PP-V 4872, Bl. 4ff., Vernehmung Küttner.<br />
25 Gegenseitige Handreichung aus <strong>de</strong>m Worte Gottes 2 (1914), S. 83–88, hier 85ff.<br />
26 Ebd.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 11<br />
ren zweimal die Zusicherung, dass keine Einglie<strong>de</strong>rung in die Deutsche Evangelische Kirche beabsichtigt<br />
sei. 27<br />
Schon 1933 benannten sie auf einer Konferenz vier verantwortliche Männer als Vertreter <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n<br />
gegenüber <strong>de</strong>n Behör<strong>de</strong>n (es han<strong>de</strong>lte sich um <strong>de</strong>n Prediger Heinrich Neumann aus Berlin,<br />
<strong>de</strong>n Kaufmann Christian Schatz aus Bad Homburg, <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>srat Werner Freiherr von Schleinitz aus<br />
Merseburg und Johannes Warns, Leiter <strong>de</strong>r Bibelschule in Wie<strong>de</strong>nest 28 ) und nannten sich jetzt »Kirchenfreie<br />
christliche Gemein<strong>de</strong>n«. Diese Bezeichnung wur<strong>de</strong> aber nicht von allen Gemein<strong>de</strong>n benutzt.<br />
Die vier genannten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> arbeiteten auch eine »Kurze Darlegung über kirchenfreie christliche<br />
Gemein<strong>de</strong>n« aus. 29 Nach einem knappen geschichtlichen Rückblick wur<strong>de</strong>n kurz die bekannten Prinzipien<br />
<strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« erläutert. Ausdrücklich erklärte man, dass man gegenüber <strong>de</strong>r Obrigkeit<br />
»zum unbedingten Gehorsam« verpflichtet sei und keine »staatsfeindliche Elemente« dul<strong>de</strong>; statt<strong>de</strong>ssen<br />
bete man regelmäßig für die Regierung. Politik fin<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n rein religiösen Versammlungen<br />
keinen Raum.<br />
Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« hatten damit versucht, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, ohne<br />
die grundsätzlichen Strukturen zu verän<strong>de</strong>rn: Sie existierten weiterhin als selbständige Gemein<strong>de</strong>n<br />
in einem losen Verband, <strong>de</strong>r mehr i<strong>de</strong>eller Natur war. Was aber bei<strong>de</strong> Gemeinschaften von 1933/34 30<br />
an unterschied, war das offizielle Vorhan<strong>de</strong>nsein von verantwortlichen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n, die als Repräsentanten<br />
<strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n gegenüber <strong>de</strong>m Staat auftraten.<br />
Einige Zeit später wur<strong>de</strong> noch eine weitere, ausführlichere Denkschrift erarbeitet, die die verschie<strong>de</strong>nen<br />
umlaufen<strong>de</strong>n ersetzen sollte. 31 In dieser bekun<strong>de</strong>te man die ein<strong>de</strong>utige Bereitschaft, alle Ziele<br />
<strong>de</strong>s Staates zu för<strong>de</strong>rn, und vertrat die Auffassung, dass <strong>de</strong>r Staat ein »totaler« sei: »ihm gehört alles,<br />
was wir auf Er<strong>de</strong>n besitzen«, so die Denkschrift. Daraus ergebe sich – wie man es schon im Ersten<br />
Weltkrieg gezeigt habe –, das Vaterland mit allen Kräften zu verteidigen. Mit dieser vorbehaltlosen<br />
Unterstützung <strong>de</strong>s NS-Staates unterschie<strong>de</strong>n sie sich nach außen von <strong>de</strong>n »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n«.<br />
Auch distanzierte man sich in dieser Denkschrift sehr klar vom »Kirchenstreit«, also vom Kampf <strong>de</strong>r<br />
Bekennen<strong>de</strong>n Kirche.<br />
Nach<strong>de</strong>m es schon in <strong>de</strong>n 20er Jahren zu einer klaren Abgrenzung gegenüber <strong>de</strong>n »Geschlossenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« gekommen war, unterzog Johannes Warns 1936 <strong>de</strong>ren ekklesiologische Auffassungen einer<br />
umfassen<strong>de</strong>n Kritik. 32 An <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Grün<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung, Darby als führen<strong>de</strong>m Vertreter<br />
<strong>de</strong>r »Geschlossenen« und Müller als Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, versuchte er die unterschiedlichen<br />
Konzeptionen zu ver<strong>de</strong>utlichen, wobei er Darbys Kirchenvorstellung als katholisch, Müllers<br />
dagegen als evangelisch bezeichnete. Diese Schrift markierte einen fundamentalen Unterschied zwischen<br />
»Geschlossenen« und »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« beson<strong>de</strong>rs im Hinblick auf die Ekklesiologie.<br />
An<strong>de</strong>rerseits berichtete Lange, dass er mehrfach von »geschlossenen« <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>versammlungen zu<br />
Predigtdiensten eingela<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n sei. 33 Und Franz Kaupp, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« angehörte,<br />
beantwortete Fragen in <strong>de</strong>n Handreichungen, also <strong>de</strong>r maßgeblichen Zeitschrift <strong>de</strong>r »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«.<br />
27 Oncken-Archiv Elstal, VEF-Akten, Johannes Warns / Christian Schatz, Rundbrief Nr. 9, 20. Januar 1934.<br />
28 Vgl. die »Kurze Darlegung über kirchenfreie christliche Gemein<strong>de</strong>n«, in: Kretzer, S. 124.<br />
29 Abgedruckt bei Kretzer, S. 122–124.<br />
30 An<strong>de</strong>re Dokumente sprechen davon, dass man erst 1934 die Nominierung <strong>de</strong>r vier <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> vollzog.<br />
31 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Fragenbeantwortung <strong>de</strong>r Berliner Konferenz von 1935.<br />
32 Johannes Warns, Georg Müller und John Nelson Darby.<br />
33 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Ernst Lange an Albert von <strong>de</strong>r Kammer, 23. März 1936; so predigte Lange z.B. in<br />
<strong>de</strong>r Düsseldorfer »Versammlung«.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 12<br />
4. Das Verbot <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« und die Gründung <strong>de</strong>s<br />
Bun<strong>de</strong>s freikirchlicher Christen 1937<br />
Bereits 1935 begann ein reichsweites Ermittlungsverfahren gegen die »Christliche Versammlung«, das<br />
1937 zu ihrem Verbot führte. 34 Den Auslöser dafür stellte die Beschlagnahmung eines Pakets mit<br />
christlichen Schriften in Plauen dar. Das sächsische Ministerium <strong>de</strong>s Innern und die sächsische Gestapo<br />
ermittelten u. a., dass <strong>de</strong>r Empfänger <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« angehörte. 35 Nach<strong>de</strong>m<br />
man das Reichsministerium <strong>de</strong>s Innern um eine Stellungnahme bezüglich <strong>de</strong>r Berechtigung <strong>de</strong>r Beschlagnahmung<br />
eingeschaltet hatte, gab dieses <strong>de</strong>n Fall an das Reichsministerium für kirchliche Angelegenheiten<br />
ab. Dieses führte dann das übliche Proce<strong>de</strong>re durch, um die Frage <strong>de</strong>r Staatsfeindlichkeit<br />
einer religiösen Gemeinschaft zu ermitteln und die Rechtmäßigkeit <strong>de</strong>r Beschlagnahmung zu klären.<br />
Zum einen erbat man vom preußischen Geheimen Staatspolizeiamt (Gestapa) einen Bericht über<br />
diese Gemeinschaft, zum an<strong>de</strong>ren bat man die Deutsche Evangelische Kirche um nähere Auskünfte.<br />
Das Gestapa vertrat in einem ausführlichen Bericht die Ansicht, dass keine Notwendigkeit »staatspolizeilicher<br />
Maßnahmen« bestehe. Die DEK zeichnete in ihrer Stellungnahme ein positives Bild <strong>de</strong>r<br />
Gemeinschaft.<br />
Im März 1936 schrieb dann jedoch <strong>de</strong>r zuständige Referent <strong>de</strong>s Gestapa <strong>de</strong>m Referenten Haugg vom<br />
Kirchenministerium, dass sich aufgrund <strong>de</strong>r Auswertung weiterer Berichte jetzt die Notwendigkeit<br />
eines Verbots zeige, da die »Christliche Versammlung« mit <strong>de</strong>n Darbysten i<strong>de</strong>ntisch sei. Mit <strong>de</strong>n<br />
»weiteren Berichten« dürften zum einen Berichte einzelner Stapostellen gemeint sein, die im Rahmen<br />
einer umfassen<strong>de</strong>n Sektenermittlung – im August 1935 vom preußischen Gestapa angeordnet –<br />
erstellt wor<strong>de</strong>n waren. Die Auswertung dieser Recherchen ergab, dass die »Christen ohne Son<strong>de</strong>rbekenntnis«/»Christliche<br />
Versammlung« und die Darbysten i<strong>de</strong>ntisch seien. Der Begriff »Darbysten«<br />
war aber negativ besetzt. So for<strong>de</strong>rte u.a. die Staatspolizeistelle (Stapostelle) Tilsit für die »Christliche<br />
Versammlung« (Darbysten) ein Verbot <strong>de</strong>r Gemeinschaft aufgrund ihrer Wahlenthaltung.<br />
Entschei<strong>de</strong>nd waren jedoch auch die Erkenntnisse <strong>de</strong>s Sicherheitsdienstes <strong>de</strong>r SS (SD), <strong>de</strong>r für die<br />
weltanschauliche Beobachtung von Gegnergruppen zuständig war und die Ergebnisse seiner Recherchen<br />
<strong>de</strong>r Gestapo ständig zur Verfügung stellte. 36 Welches Bild <strong>de</strong>r SD zu dieser Zeit von <strong>de</strong>r »Christlichen<br />
Versammlung« hatte, kann man einem Merkblatt vom Herbst 1937 entnehmen, das <strong>de</strong>n bisherigen<br />
Wissensstand <strong>zusammen</strong>fasste. Hier wur<strong>de</strong> darauf verwiesen, dass man in <strong>de</strong>r »Christlichen<br />
Versammlung« die Kultur als »weltlich« und unchristlich ansehe. Dem politischen Bereich stehe<br />
man völlig <strong>de</strong>sinteressiert gegenüber. Die Begründung für dieses Verhalten laute, dass man »die<br />
irdische Macht und ihre Gesetze [als ein] Produkt <strong>de</strong>s Satans« ansehe. Wehrpflicht, Kriegsdienst und<br />
<strong>de</strong>n Deutschen Gruß lehne man daher ab. Deshalb stelle diese Gemeinschaft ein »geeignetes Sammelbecken<br />
für unzufrie<strong>de</strong>ne Elemente und Marxisten« dar. 37 In diesen Ausführungen übernahm man,<br />
teilweise sogar wörtlich, Darstellungen <strong>de</strong>r konfessionskundlichen Literatur. Diese spiegelten mehr<br />
o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r die im offiziellen Schrifttum <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« geäußerten Standpunkte<br />
wi<strong>de</strong>r. Ergänzt wur<strong>de</strong> diese Beurteilung durch die Ermittlung einzelner örtlicher Vorkommnisse wie<br />
z. B. die Ablehnung <strong>de</strong>s Deutschen Grußes.<br />
Dass es sich hier teilweise um falsche Aussagen han<strong>de</strong>lte, wird daran <strong>de</strong>utlich, dass die »Geschlossenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« immer betont hatten, man habe sich <strong>de</strong>r Obrigkeit, die von Gott gegeben sei, unter-<br />
34 Vgl. zum Ganzen die ausführliche Darstellung bei Liese (mit Quellenangaben).<br />
35 In <strong>de</strong>n Quellen ist anfangs davon die Re<strong>de</strong>, dass <strong>de</strong>r Empfänger <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« angehöre, die<br />
unter <strong>de</strong>m Namen »Christlicher Verein für Wohltätigkeit und Mission e. V.« bekannt sei; die Angehörigen wür<strong>de</strong>n<br />
sich auch als »Christen ohne Son<strong>de</strong>rbekenntnis« bezeichnen. Der genannte Verein, von Einzelpersonen gegrün<strong>de</strong>t,<br />
half <strong>de</strong>n einzelnen Gemein<strong>de</strong>n, Versammlungsräume zu bauen.<br />
36 Vgl. dazu Dierker, S. 290f.<br />
37 Merkblatt <strong>de</strong>s SD über die »Darbysten« (Sektenerfassung, 1937), Zentrum für die Aufbewahrung historisch-dokumentarischer<br />
Sammlungen, Moskau, Fond 500-3-432, Bl. 49f., zitiert nach Liese, S. 249f.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 13<br />
zuordnen. Auch die Aussage über die Ablehnung <strong>de</strong>r allgemeinen Wehrpflicht war unzutreffend, da<br />
die »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« mehrheitlich nicht pazifistisch eingestellt waren.<br />
Als die »Christliche Versammlung« im April 1937 verboten wur<strong>de</strong>, geschah dies zunächst lediglich<br />
mit Hinweis auf die sog. Reichstagsbrandverordnung. Viele Angehörige <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung«<br />
fühlten sich daher als kommunistische »Volks- und Staatsfein<strong>de</strong>« gekennzeichnet. Wenn man<br />
das oben beschriebene Verhalten vieler »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« be<strong>de</strong>nkt, ist aus ihrer Perspektive die Empörung<br />
nachvollziehbar: Da sie sich <strong>de</strong>m NS-Staat nicht verweigert hatten, stellten sie genau das Gegenteil<br />
von »Volks- und Staatsfein<strong>de</strong>n« dar.<br />
Weil man das Versammlungsverbot nicht hinnehmen wollte, wur<strong>de</strong> man sofort aktiv. Kurze Zeit<br />
später fuhr eine Delegation unter <strong>de</strong>r Führung von Ernst Brockhaus nach Berlin, um mit <strong>de</strong>n für das<br />
Verbot Verantwortlichen Kontakt aufzunehmen. Im Reichskirchenministerium sprach man mit <strong>de</strong>m<br />
Referenten Haugg, <strong>de</strong>r aber nicht weiterhelfen konnte. Im Gestapa sprach man ebenfalls mit <strong>de</strong>m<br />
zuständigen Referenten. Es gelang dann, <strong>de</strong>n politisch Verantwortlichen, <strong>de</strong>n Dezernenten Haselbacher,<br />
fernmündlich zu sprechen. Der Delegation wur<strong>de</strong> geraten, Eingaben an die zuständigen Stellen<br />
zu schicken. Dies geschah dann auch. Man bekun<strong>de</strong>te seine Staatsbejahung, in<strong>de</strong>m man u. a. auf die<br />
Mitgliedschaften in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen NS-Organisationen hinwies.<br />
Parallel zu diesen Geschehnissen schaltete sich auch Hans Becker in die Bemühungen ein, um<br />
Grün<strong>de</strong> für das Verbot in Erfahrung zu bringen und eventuell auf eine Lockerung hinwirken zu können.<br />
Den Gesprächskontakt vermittelte <strong>de</strong>r Jurist Dr. Karl Bertrams, ein Cousin mütterlicherseits.<br />
Bertrams, zu diesem Zeitpunkt beim Reichskommissar für Preisbildung beschäftigt, hatte seine Karriere<br />
im Geheimen Staatspolizeiamt begonnen und war danach Leiter einer Stapostelle gewesen. Sein<br />
Vater, Karl Bertrams, ein Fabrikbesitzer, gehörte <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« in Waldbröl an.<br />
Der Sohn hatte aber keine Beziehungen mehr zu <strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n«.<br />
Karl Bertrams jun. kannte <strong>de</strong>n erwähnten Dezernenten Haselbacher aus seiner Schulzeit und war<br />
noch immer gut mit ihm bekannt. Bertrams verschaffte Becker einen Termin bei <strong>de</strong>m Gestapobeamten.<br />
Becker wies darauf hin, dass die meisten Angehörigen <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« nicht<br />
staatsfeindlich seien, da sie sich <strong>de</strong>n diversen Organisationen <strong>de</strong>s NS-Staates angeschlossen hätten.<br />
Nach diesem Gespräch sprach auch Bertrams bei Haselbacher persönlich vor und trat für die »Christliche<br />
Versammlung« ein, in<strong>de</strong>m er ebenfalls ihre staatsfeindliche Haltung bestritt.<br />
Bei<strong>de</strong> Interventionen, aber sicherlich auch die verschie<strong>de</strong>nen Eingaben konnten <strong>de</strong>r Gestapo offensichtlich<br />
die Sicht vermitteln, dass ihre Auffassung, die »Christliche Versammlung« in ihrer Ganzheit<br />
sei staatsfeindlich, nicht zutraf. Im Gegenteil: Es gab viele Angehörige <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung«,<br />
die sich durchaus loyal gegenüber <strong>de</strong>m nationalsozialistischen Staat verhielten und seinen<br />
Organisationen angehörten. Damit entfielen eigentlich die Grün<strong>de</strong>, die nach Ansicht <strong>de</strong>r Gestapo ein<br />
Verbot notwendig machten. Um es aber nicht aufheben zu müssen, begrün<strong>de</strong>te das Gestapa in einem<br />
Schreiben vom 3. Juni 1937, das an alle Stapostellen im Reich ging, die Notwendigkeit <strong>de</strong>s Verbots<br />
jetzt folgen<strong>de</strong>rmaßen: »Die ›Christliche Versammlung‹ ist verboten wor<strong>de</strong>n, weil sich unter <strong>de</strong>m<br />
Einfluss <strong>de</strong>r in ihr massgeblichen darbystischen Richtung, die jegliche positive Einstellung zu Volk<br />
und Staat verneint, verschie<strong>de</strong>ntlich Bibelforscher und Marxisten zu ihr gefun<strong>de</strong>n und sich als solche<br />
auch weiterhin betätigt haben.« 38 Zum einen wird hier in Übereinstimmung mit <strong>de</strong>r Einschätzung <strong>de</strong>s<br />
Sicherheitsdienstes noch einmal gesagt, dass die darbystische Lehre <strong>de</strong>r Abson<strong>de</strong>rung von <strong>de</strong>r Welt<br />
ein positives Verhältnis zum NS-Staat verhin<strong>de</strong>rte und damit als »volks- und staatsfeindliche« Haltung<br />
zu betrachten sei. Zum an<strong>de</strong>ren ist aufschlussreich, dass jetzt nicht mehr die ganze Gemeinschaft<br />
als darbystisch geprägt angesehen wur<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn dass diese Kennzeichnung nur noch einem Teil <strong>de</strong>r<br />
»Christlichen Versammlung« galt; allerdings – so die Ansicht <strong>de</strong>r Gestapo – habe diese Gruppe die<br />
»Christliche Versammlung« entschei<strong>de</strong>nd beeinflusst. Diese Ausrichtung <strong>de</strong>r »Christlichen Ver-<br />
38 Verfügung <strong>de</strong>s Geheimen Staatpolizeiamtes, 3. Juni 1937, zitiert nach Liese, S. 252.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 14<br />
sammlung« habe zu<strong>de</strong>m aus ihr ein »Sammelbecken« 39 für staatsfeindliche Gruppierungen wie Zeugen<br />
Jehovas und Marxisten gemacht. 40 Damit war aber ein Verbot <strong>de</strong>r ganzen Glaubensgemeinschaft<br />
notwendig gewor<strong>de</strong>n.<br />
Da nur ein – aber ein dominieren<strong>de</strong>r – Teil <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« staatsfeindlich war,<br />
erhielten die nach Ansicht <strong>de</strong>r Gestapo loyalen Kräfte die Möglichkeit, eine neue Glaubensgemeinschaft<br />
zu grün<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r oben genannten Verfügung <strong>de</strong>r Gestapo-Zentrale hieß es, dass »Dr. Hans<br />
Becker die Gründung eines ›Bun<strong>de</strong>s freikirchlicher Christen‹ mit <strong>de</strong>njenigen Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r ehemaligen<br />
›Christlichen Versammlung‹ gestattet wor<strong>de</strong>n [sei], die durchaus auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Nationalsozialismus<br />
stehen und zum Teil alte Parteigenossen sind«. 41 Daraus ist zu entnehmen, dass es nach<br />
Ansicht <strong>de</strong>r Gestapo in <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« einen Personenkreis gab, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n NS-Staat<br />
unterstützte. Diesem wollte man weiter die Möglichkeit <strong>de</strong>r religiösen Betätigung geben.<br />
Um klarzumachen, dass es nicht einen nahtlosen Übergang von <strong>de</strong>r verbotenen »Christlichen<br />
Versammlung« zum neuen Bund geben sollte, wur<strong>de</strong>n ihre Vertreter am 30. Mai 1937 in Wuppertal-<br />
Elberfeld lediglich von Becker über diese neue Glaubensgemeinschaft informiert. 42 In seiner Re<strong>de</strong><br />
wandte er sich gegen eine falsch verstan<strong>de</strong>ne Abson<strong>de</strong>rungslehre: Er sprach sich für eine Teilnahme<br />
an <strong>de</strong>r Kultur aus, bejahte <strong>de</strong>n NS-Staat und for<strong>de</strong>rte, aktiv in ihm mitzuarbeiten. Dies sei von vielen<br />
an<strong>de</strong>rs gesehen wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>shalb sei das Verbot zu Recht ergangen. Damit akzeptierte Becker die Sicht<br />
<strong>de</strong>r Gestapo hinsichtlich <strong>de</strong>s »Darbysmus« als einer sich <strong>de</strong>m NS-Staat verweigern<strong>de</strong>n Lehre.<br />
Bisher hatten Becker und seine Freun<strong>de</strong> unter Darbysmus mehr eine Haltung verstan<strong>de</strong>n, die »die<br />
eigene Überzeugung <strong>de</strong>r objektiven Wahrheit« gleichsetzte und sich damit als intolerant erwies. Jetzt<br />
aber übernahm er nicht nur die Position <strong>de</strong>s NS-Regimes, in<strong>de</strong>m er die bisherige Doktrin <strong>de</strong>r Abson<strong>de</strong>rung<br />
vom kulturellen und politischen Bereich verwarf, son<strong>de</strong>rn distanzierte sich auch öffentlich<br />
von ihr. Damit war eine wichtige For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Gestapo hinsichtlich <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>s BfC erfüllt<br />
wor<strong>de</strong>n: Er sollte nicht »darbystisch« ausgerichtet sein.<br />
Becker sprach sich jedoch auch gegen <strong>de</strong>n intoleranten Darbysmus aus: In Zukunft solle es mehr<br />
»Duldsamkeit« gegenüber Auffassungen geben, die nicht durch das bisherige Schrifttum <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«<br />
ge<strong>de</strong>ckt seien. Jeglicher »Gewissens- und Denkzwang« habe aufzuhören. Da Becker die gefor<strong>de</strong>rte<br />
Duldsamkeit auch später in seiner von <strong>de</strong>r Gestapo sanktionierten Abhandlung über die Entstehung<br />
<strong>de</strong>s BfC 43 erwähnte, ist davon auszugehen, dass diese For<strong>de</strong>rung vom NS-Regime unterstützt<br />
wur<strong>de</strong>. Man könnte es so ausdrücken: Becker erkannte die Einschätzung <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung«<br />
durch die Gestapo öffentlich an, diese wie<strong>de</strong>rum ließ ihm in <strong>de</strong>r Umgestaltung <strong>de</strong>r »Versammlung«<br />
freie Hand. Da die alten »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« sowohl <strong>de</strong>n dogmatischen als auch <strong>de</strong>n »staatsfeindlichen«<br />
Darbysmus repräsentierten, mussten Becker und seine Gesinnungsfreun<strong>de</strong> auf sie keine Rücksicht<br />
mehr nehmen und konnten im BfC ihre theologischen und kirchlichen Vorstellungen realisieren.<br />
Wie <strong>de</strong>r Bund entstehen und seine Organisation aussehen sollte, erläuterte Becker ebenfalls in<br />
Elberfeld: Einzelne Angehörige <strong>de</strong>r verbotenen »Christlichen Versammlung« sollten sich an einem<br />
Ort <strong>zusammen</strong><strong>fin<strong>de</strong>n</strong> und <strong>de</strong>m Reichsbeauftragten 44 Becker einen Ortsbeauftragten zur Bestätigung<br />
vorschlagen. Nach seiner Anerkennung durch Becker musste er bei <strong>de</strong>r zuständigen Behör<strong>de</strong> (z. B.<br />
39 Merkblatt <strong>de</strong>s SD über die »Darbysten« (1937), Son<strong>de</strong>rarchiv Moskau, Fond 500-3-432, Bl. 49f., zitiert nach Liese,<br />
S. 250.<br />
40 Dass dies eine absur<strong>de</strong> Behauptung war, muss nicht weiter begrün<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n: Alle freikirchlichen Christen lehnten<br />
alle Spielarten <strong>de</strong>s Marxismus ab und hatten sich auch immer wie<strong>de</strong>r ein<strong>de</strong>utig von <strong>de</strong>n Bibelforschern (Zeugen<br />
Jehovas) distanziert.<br />
41 Verfügung vom 3. Juni 1937, zitiert nach Liese, S. 252.<br />
42 Es han<strong>de</strong>lte sich hier nicht um eine Gründungsversammlung, wie manchmal behauptet wird.<br />
43 Hans Becker, Die Wahrheit über <strong>de</strong>n Bund freikirchlicher Christen, 1937. Diese Schrift ist als Grundsatzdokument <strong>de</strong>s BfC<br />
anzusehen.<br />
44 Später wur<strong>de</strong> die Bezeichnung »Bun<strong>de</strong>sbeauftragter« verwen<strong>de</strong>t.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 15<br />
<strong>de</strong>m Landrat) um eine Genehmigung für die Gründung einer BfC-Gemein<strong>de</strong> bitten und dabei auch<br />
eine Mitglie<strong>de</strong>rliste vorlegen. Diese wur<strong>de</strong> dann an die zuständige Staatspolizeistelle weitergeleitet,<br />
die die Liste überprüfte; bisweilen geschah das zusätzlich auch noch durch die zuständigen Stellen <strong>de</strong>r<br />
NSDAP. Dieses Verfahren zog sich manchmal über einen längeren Zeitraum hin. Erst wenn die offizielle<br />
Genehmigung erteilt wor<strong>de</strong>n war, konnte die Gründungsversammlung <strong>de</strong>r neuen BfC-Gemein<strong>de</strong><br />
einberufen wer<strong>de</strong>n. Auch spätere Aufnahmegesuche mussten <strong>de</strong>r örtlichen Gestapo-Stelle vorgelegt<br />
wer<strong>de</strong>n, wodurch eine permanente Kontrolle durch das NS-Regime gewährleistet wur<strong>de</strong>.<br />
Je<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m BfC beitreten wollte, musste eine Beitrittserklärung unterschreiben; in <strong>de</strong>r ersten<br />
Zeit musste man dabei die Grundsätze <strong>de</strong>s BfC ausdrücklich anerkennen. Damit sollte sichergestellt<br />
wer<strong>de</strong>n, dass diese Personen sich bewusst von <strong>de</strong>r bisherigen Abson<strong>de</strong>rungslehre distanzierten, <strong>de</strong>r<br />
Staats- und Lebensbejahung zustimmten und die For<strong>de</strong>rung nach theologischer Duldsamkeit explizit<br />
bejahten. Damit stellte dieser Personenkreis <strong>de</strong>n zuverlässigen Kern <strong>de</strong>r neuen Gemeinschaft dar.<br />
Später Hinzukommen<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> dieses ausdrückliche Bekenntnis zu <strong>de</strong>n Grundsätzen <strong>de</strong>s BfC erlassen.<br />
Im Laufe <strong>de</strong>r Zeit traten etwa 90 % <strong>de</strong>r Angehörigen <strong>de</strong>r ehemaligen »Christlichen Versammlung«<br />
<strong>de</strong>m BfC bei. 45<br />
Wichtig ist auch noch, dass man nicht einer Ortsgemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>s BfC beitrat, son<strong>de</strong>rn Mitglied <strong>de</strong>s<br />
Bun<strong>de</strong>s wur<strong>de</strong>. Der Aufbau <strong>de</strong>s BfC gestaltete sich nach <strong>de</strong>m Führerprinzip. Wie schon gesagt, stand<br />
an <strong>de</strong>r Spitze Hans Becker, <strong>de</strong>r Reichs-, später Bun<strong>de</strong>sbeauftragte. Aufgrund <strong>de</strong>r persönlichen Erlaubnis<br />
zur Bildung <strong>de</strong>s BfC war <strong>de</strong>r ganze Bund auf ihn ausgerichtet. 46 Er allein war damit auch verantwortlich<br />
für das politisch korrekte Verhalten seiner Mitglie<strong>de</strong>r; die Erlaubnis zur Abhaltung von<br />
Evangelisationen durch einzelne Gemein<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> von ihm persönlich gegeben. Auf <strong>de</strong>n unteren<br />
Ebenen (Bezirke, Kreise) folgten dann bis zu <strong>de</strong>n einzelnen Gemein<strong>de</strong>n hin jeweils Beauftragte. Den<br />
Beauftragten stan<strong>de</strong>n auf allen Ebenen Beiräte zur Seite.<br />
5. Die Kirchenfreien christlichen Gemein<strong>de</strong>n<br />
5.1. Situation nach <strong>de</strong>m Verbot <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung«<br />
Die KcG reagierten schnell auf das Verbot <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung«. Schon am 3. Mai 1937<br />
verfassten Heinrich Neumann, Christian Schatz und Werner Freiherr von Schleinitz ein Rundschreiben<br />
an alle Gemein<strong>de</strong>n. 47 So habe das Versammlungsverbot an einzelnen Orten »zu Verwechslungen<br />
geführt«. Aus <strong>de</strong>r Verbotsverfügung gehe aber ein<strong>de</strong>utig hervor, dass die KcG von <strong>de</strong>m Verbot nicht<br />
betroffen seien. Um sich entsprechend ausweisen zu können, schicke man <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n die –<br />
weiter oben genannte – Denkschrift zu. Wichtig sei, dass man sich strikt an die Bezeichnung »Kirchenfreie<br />
christliche Gemein<strong>de</strong>n« halte. Abschließend wur<strong>de</strong> davor gewarnt, von <strong>de</strong>m Verbot <strong>de</strong>r<br />
»Christlichen Versammlung« betroffene Personen in die KcG aufzunehmen. 48<br />
Auch das Geheime Staatspolizeiamt stellte in einer Antwort auf die Anfrage <strong>de</strong>r Staatspolizeistelle<br />
Leipzig klar, dass die KcG nicht »i<strong>de</strong>ntisch mit <strong>de</strong>r Sekte ›Christliche Versammlung‹« seien und<br />
<strong>de</strong>shalb nicht unter das Verbot <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« fielen. 49<br />
Die KcG wur<strong>de</strong>n allerdings vom Sicherheitsdienst <strong>de</strong>r SS negativ beurteilt. Deshalb verschickte das<br />
SD-Hauptamt auch über diese Gemeinschaft im Herbst 1937 ein Merkblatt an alle zuständigen Stellen.<br />
So stellte man neben <strong>de</strong>r diffusen Organisation fest, dass viele Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m offiziell dargestellten<br />
45 Vgl. dazu Liese, S. 347.<br />
46 Die Erlaubnis <strong>de</strong>r Gestapo zur Gründung <strong>de</strong>s BfC war an die Person Beckers gebun<strong>de</strong>n.<br />
47 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Jordy, Heinrich Neumann u. a., Rundschreiben, 3. Mai 1937.<br />
48 Ähnlich äußerten sich die Baptisten. Obwohl sie <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong><strong>de</strong>legation einen Anschluss <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung«<br />
an die Baptisten empfohlen hatten, wies das Bun<strong>de</strong>shaus darauf hin, dass die Gemein<strong>de</strong>n »von Aufnahmen<br />
<strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Versammlung absehen und je<strong>de</strong>n Schein vermei<strong>de</strong>n« sollten, <strong>de</strong>r die Baptisten »in <strong>de</strong>n<br />
Verdacht« bringen wür<strong>de</strong>, »Aufnahmestellung für die Verbotenen zu wer<strong>de</strong>n« (Oncken-Archiv Elstal, Paul<br />
Schmidt / Friedrich Rockschies, An alle Prediger, 7. Mai 1937).<br />
49 Staatsarchiv Leipzig, PP-V 4882, Bl. 26, Geheimes Staatspolizeiamt, 13. Mai 1937.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 16<br />
Bild nicht entsprächen. Um dies zu illustrieren, machte man <strong>de</strong>n KcG Vorwürfe, die teilweise sehr<br />
abstrus wirkten: Man wies auf mangeln<strong>de</strong> Distanz zum Ju<strong>de</strong>ntum hin; angeblich sei gepredigt wor<strong>de</strong>n,<br />
dass eheliche Treue keine hohe Be<strong>de</strong>utung habe; teilweise seien bei <strong>de</strong>n Bibelforschern ähnliche<br />
Bestrebungen festgestellt wor<strong>de</strong>n. Man könne zwar – so das Fazit – keine »staatsfeindliche[n] Handlungen<br />
<strong>de</strong>r Gemeinschaft« nachweisen, abgesehen von Verfehlungen Einzelner, die längst geahn<strong>de</strong>t<br />
wor<strong>de</strong>n seien; »(aber) dass sie … <strong>de</strong>n Bestrebungen <strong>de</strong>r NSDAP und ihrer Organisationen min<strong>de</strong>stens<br />
interesselos gegenübersteht, ist wohl erwiesen.« 50 Damit war klar, dass sich auch für die »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« die Situation verschlechtern wür<strong>de</strong>.<br />
En<strong>de</strong> Juni wur<strong>de</strong> Heinrich Neumann dann zu einem Gespräch im Gestapa vorgela<strong>de</strong>n, an <strong>de</strong>m auch<br />
Christian Schatz teilnahm. 51 Über die Ergebnisse <strong>de</strong>r Unterredung wur<strong>de</strong>n die Gemein<strong>de</strong>n durch ein<br />
Rundschreiben informiert: Neben <strong>de</strong>r erneuten Auffor<strong>de</strong>rung, nur <strong>de</strong>n offiziellen Namen »Kirchenfreie<br />
christliche Gemein<strong>de</strong>n« zu benutzen, wur<strong>de</strong> ausgeführt, dass <strong>de</strong>r Gestapo bald ein Verzeichnis<br />
<strong>de</strong>r zu <strong>de</strong>n KcG gehören<strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n vorzulegen sei, nebst Angaben zu <strong>de</strong>n führen<strong>de</strong>n Personen.<br />
Konferenzen und die auf ihnen verhan<strong>de</strong>lten Themen seien <strong>de</strong>r Gestapo vorab zu mel<strong>de</strong>n. 52 Ein Anschluss<br />
an an<strong>de</strong>re Gemein<strong>de</strong>verbän<strong>de</strong> sei allerdings nicht gefor<strong>de</strong>rt wor<strong>de</strong>n. 53<br />
Auch die Gestapo in Leipzig kam bei ihren Recherchen zu negativen Ergebnissen. So wur<strong>de</strong> die<br />
politische Einstellung gegenüber Staat und <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Bewegung als »gleichgültig<br />
und interesselos« bezeichnet. 54<br />
5.2. Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-Gruppen<br />
Will man die Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Richtungen <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in Deutschland angemessen<br />
würdigen, muss man diesen Vorgang in <strong>de</strong>n Kontext <strong>de</strong>r Einigungsbemühungen sog. »taufgesinnter«<br />
Kreise ab 1937 einordnen.<br />
Begonnen hatte die Diskussion über ein Zusammengehen <strong>de</strong>r Taufgesinnten mit einem zweiteiligen<br />
Artikel, <strong>de</strong>n Ernst Lange unter <strong>de</strong>m Titel »Die Überwindung <strong>de</strong>r Konfessionen« in <strong>de</strong>r Zeitschrift<br />
Die Tenne ab Januar 1937 publizierte. 55 Er rief zu einer Überwindung <strong>de</strong>r Zersplitterung auf und vertrat<br />
die Ansicht, die unterschiedlichen Auffassungen <strong>de</strong>r Freikirchen zu bestimmten Themen wie beispielsweise<br />
<strong>de</strong>r Taufe stellten nur minimale Lehrunterschie<strong>de</strong> dar, die sich nicht länger kirchentrennend<br />
auswirken sollten. Lange for<strong>de</strong>rte, die Einheit <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> sichtbar zu machen. Brisant an<br />
<strong>de</strong>m Vorgang war, dass es sich bei <strong>de</strong>r Tenne um eine langjährige Zeitschrift <strong>de</strong>r »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«<br />
han<strong>de</strong>lte, <strong>de</strong>ren Herausgeber zu diesem Zeitpunkt aber schon auf die Seite <strong>de</strong>r »Stündchenbewegung«<br />
und damit auf die Seite <strong>de</strong>r Opposition gewechselt war.<br />
Etwa um die gleiche Zeit (Februar 1937) äußerte Paul Schmidt, Bun<strong>de</strong>sdirektor <strong>de</strong>r Baptisten, die<br />
Meinung, dass die »Vereinigung <strong>de</strong>r ›taufgesinnten‹ Kreise« im Hinblick auf die kirchenpolitische<br />
Situation notwendig sei. 56 Diese Frage wur<strong>de</strong> dann auf <strong>de</strong>r Theologischen Woche <strong>de</strong>s Baptistenbun<strong>de</strong>s<br />
im Predigerseminar in Hamburg im April dieses Jahres aufgegriffen. Man beschloss, diesbezügliche<br />
50 Merkblatt <strong>de</strong>s SD über die »Kirchenfreien christlichen Gemein<strong>de</strong>n« (1937), Son<strong>de</strong>rarchiv Moskau, Fond 500-3-432,<br />
Bl. 49f., zitiert nach Liese, S. 277f.<br />
51 Zu diesem Vorgang siehe Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Jordy, Christian Schatz, 1. Juli 1937; Heinrich Neumann /<br />
Christian Schatz, Rundschreiben, 12. Juli 1937.<br />
52 Ebd., Neumann/Schatz, 12. Juli 1937.<br />
53 Ebd., Schatz, 1. Juli 1937.<br />
54 Staatsarchiv Leipzig, PP-V 4882, Bl. 35–37, Bericht vom 19. Dezember 1937, »Betr.: ›Freie christliche <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>‹.«<br />
55 Ernst Lange, »Die Überwindung <strong>de</strong>r Konfessionen«, in: Die Tenne 15 (1937), S. 11ff., 37ff., 65ff.<br />
56 Strübind, S. 215.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 17<br />
Gespräche mit <strong>de</strong>n Freien evangelischen Gemein<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« und <strong>de</strong>n KcG<br />
aufzunehmen. 57<br />
Paul Schmidt trat dann in Kontakt mit Ernst Brockhaus und besuchte ihn ungefähr 10–14 Tage vor<br />
<strong>de</strong>m Verbot <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« in Wuppertal-Elberfeld. 58 Schmidt berichtete, Brockhaus<br />
habe ausgeführt, dass auch ihn schon ähnliche Gedanken bewegt hätten und er auch mit seinem<br />
Vetter Wilhelm Brockhaus bereits darüber konferiert habe. Ernst Brockhaus habe die Absicht bekun<strong>de</strong>t,<br />
die Gesprächsergebnisse auf <strong>de</strong>r nächsten Gebetskonferenz <strong>de</strong>r Reisebrü<strong>de</strong>r vorzutragen. Er<br />
zweifle nicht, dass sie sich seiner Meinung über ein Zusammengehen anschließen wür<strong>de</strong>n, wobei<br />
sowohl an einen äußeren als auch an einen inneren Zusammenschluss gedacht sei (Baptisten, »Geschlossene<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, KcG, Freie evangelische Gemein<strong>de</strong>n).<br />
Daran wird <strong>de</strong>utlich, dass Ernst und Wilhelm Brockhaus – von <strong>de</strong>nen Letzterer zu <strong>de</strong>n »Lehrautoritäten«<br />
<strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« gehörte – zu diesem Zeitpunkt die darbystische Abson<strong>de</strong>rungsdoktrin<br />
schon hinter sich gelassen hatten und mehr o<strong>de</strong>r min<strong>de</strong>r bereit waren, wie auch immer<br />
geartete Beziehungen zu <strong>de</strong>n freikirchlichen Gruppen, zu <strong>de</strong>nen sich die »Christliche Versammlung«<br />
bis jetzt nicht gezählt hatte, aufzunehmen. 59<br />
Nach einem kurzen Moment <strong>de</strong>s Erschreckens – das Verbot <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung«<br />
hatte die Freikirchen schockiert – gingen die Einigungsbemühungen mit neuer Intensität weiter. So<br />
äußerte sich im Mai 1937 – noch vor <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>s BfC – Ernst Lange in einer Abhandlung »Gedanken<br />
über die Einigungsvorschläge <strong>de</strong>r Baptisten« positiv zu <strong>de</strong>n baptistischen Vorschlägen. 60<br />
Wenn eine solche Verbindung von <strong>de</strong>r Regierung geför<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>, sei das als »ein Eingreifen Gottes<br />
zur För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s einheitlichen Zeugnisses« zu begreifen. Eine Erleichterung <strong>de</strong>r Position im NS-<br />
Staat durch »die Bildung einer die Zersplitterung überwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Einheitsgemein<strong>de</strong>« sei dankbar<br />
anzunehmen. Der Wunsch nach »Existenzsicherung« kam dann in folgen<strong>de</strong>n Worten <strong>de</strong>utlich zum<br />
Ausdruck: »Wenn etwa das Körperschaftsrecht <strong>de</strong>r Baptisten auch auf die an<strong>de</strong>ren Gemein<strong>de</strong>n ausge<strong>de</strong>hnt<br />
wird, so wür<strong>de</strong> ich das ebenso selbstverständlich gerne annehmen, wie ich bei einem Regenschauer<br />
<strong>de</strong>n Regenschirm eines Bru<strong>de</strong>rs gern mitbenütze, wenn ich selbst keinen haben sollte.« Diese<br />
Begründung wirkte ambivalent: Wenn die Einigungsbemühungen von staatlicher Seite forciert wer<strong>de</strong>n<br />
sollten, sei das als ein »Eingreifen Gottes« zu begrüßen – Lange führte an dieser Stelle noch an,<br />
dass die Regierung ja von Gott eingesetzt sei, ihr Han<strong>de</strong>ln hätte dann an diesem Punkt einen noch<br />
höheren Grad von Legitimation –; auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite jedoch gingen gera<strong>de</strong> von dieser Regierung<br />
Gefahren aus, <strong>de</strong>nen gegenüber man sich gemeinsam schützen müsse. 61<br />
Es scheint so, dass die Planungen schon weit fortgeschritten waren. So hatte Paul Schmidt an Lange<br />
geschrieben, dass die Baptisten bald eine Konferenz einberufen wollten, auf <strong>de</strong>r Vertreter dieser vier<br />
Gruppen »die tatsächliche Vereinigung beschließen sollen«. 62 Becker vertrat in seiner Gründungsre<strong>de</strong><br />
57 Ebd.<br />
58 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Paul Schmidt an Gustav Runkel, 2. April 1947 (Abschrift). Vgl. auch die Äußerung<br />
von Carl Koch auf <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>nester Konferenz 1945: »Anschließend besuchten die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> Paul Schmidt und<br />
Rockschiess in Elberfeld Bru<strong>de</strong>r Ernst Brockhaus und an<strong>de</strong>re führen<strong>de</strong> <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>r ›Christlichen Versammlung‹<br />
und hörten zu ihrer Überraschung, dass hier ähnliche Gedanken <strong>de</strong>r Verbindung mit an<strong>de</strong>ren Gläubigen bereits<br />
besprochen waren« (Privatarchiv Kretzer, Carl Koch, Rückblick und Ausblick [Elberfel<strong>de</strong>r Konferenz 1945], S. 11).<br />
Auf Seiten <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« nahm noch Cronenberg an <strong>de</strong>m Gespräch teil.<br />
59 1932 verhielt Wilhelm Brockhaus sich gegenüber einem Zusammengehen mit <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« noch völlig<br />
ablehnend (Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Wilhelm Birkenstock, Vertrauliche Mitteilungen).<br />
60 Oncken-Archiv Elstal, Bestand Büro <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>sdirektors, Ernst Lange, Gedanken zu <strong>de</strong>n Vorschlägen <strong>de</strong>r Baptisten,<br />
26. Mai 1937.<br />
61 Eine ähnliche Argumentation ist dann später bei August Freiherr von We<strong>de</strong>kind in <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>r Vereinigung<br />
von »Geschlossenen« und »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« zu beobachten.<br />
62 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Ernst Lange an Albert von <strong>de</strong>r Kammer, 27. Mai 1937.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 18<br />
die Auffassung, dass <strong>de</strong>r BfC nur eine vorübergehen<strong>de</strong> Erscheinung sein sollte; anzustreben sei eine<br />
Einheitsorganisation <strong>de</strong>r Freikirchen. 63<br />
Am 20. August 1937 fand, initiiert durch Ernst Lange, ein Treffen in Kassel statt, an <strong>de</strong>m – neben<br />
führen<strong>de</strong>n Vertretern <strong>de</strong>r Baptisten – auf Seiten <strong>de</strong>s BfC folgen<strong>de</strong> Personen teilnahmen: Hans Becker,<br />
Ernst Brockhaus, Hugo Hartnack, Fritz Richter und Walter Vogelbusch; von <strong>de</strong>n KcG nahmen Ernst<br />
Lange, Heinrich Neumann, Christian Schatz und Werner Freiherr von Schleinitz teil. 64 Hier soll nur<br />
auf <strong>de</strong>n Teil dieser Unterredung eingegangen wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r die bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-Richtungen betraf.<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>s Gesprächs begann man auszuloten, ob zumin<strong>de</strong>st eine Einigung zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n<br />
»<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-Gruppen möglich wäre. So verließen die Baptisten für kurze Zeit die Gesprächsrun<strong>de</strong>.<br />
Die Vertreter von BfC und KcG versuchten dann die anstehen<strong>de</strong>n Fragen zu klären. Dabei »herrschte<br />
eine stille Übereinstimmung darüber«, dass die Vorgänge, die im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt zur Spaltung geführt<br />
hätten, keine Ursache für eine weitere Trennung sein sollten; außer<strong>de</strong>m sei dieser Sachverhalt<br />
nicht mehr objektiv zu klären. 65 Hinsichtlich <strong>de</strong>r Frage <strong>de</strong>r Kirchenzucht erklärten die KcG, dass man<br />
am Prinzip <strong>de</strong>r »Selbständigkeit« einer Gemein<strong>de</strong> festhalten wolle; allerdings wür<strong>de</strong>n Entscheidungen<br />
von Nachbargemein<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Regel akzeptiert. Dies wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n BfC-Vertretern mit Befriedigung<br />
zur Kenntnis genommen. Unklare Fälle sollten in Zukunft von je zwei Vertretern bei<strong>de</strong>r Gruppen<br />
untersucht wer<strong>de</strong>n. Hierzu meinte Schatz ein Jahr später, dass die ehemaligen »Elberfel<strong>de</strong>r«<br />
durchaus Grund zu einem gewissen Misstrauen gehabt hätten; so habe oft »die Einheitlichkeit« gefehlt,<br />
auch habe es häufig Defizite bezüglich <strong>de</strong>r »Handhabung gemeinsamer Zucht« gegeben. Schatz<br />
konstatierte, dass sich das, seit<strong>de</strong>m es einen gemeinsamen Bund gebe, zum Positiven verän<strong>de</strong>rt<br />
habe. 66<br />
In Bezug auf Lehrkontroversen erklärten die BfC-Vertreter in <strong>de</strong>m Kasseler Gespräch, dass bei<br />
ihnen jetzt »größere Duldsamkeit« herrsche; die Ansicht, nur bei <strong>de</strong>n »Exklusiven« sei das wahre<br />
Abendmahl zu <strong>fin<strong>de</strong>n</strong>, wer<strong>de</strong> inzwischen als »bedauerliche Überspitzung« angesehen. Da man in<br />
an<strong>de</strong>ren Fragen keine Differenzen feststellte, konnte man die Frage, ob es noch Trennungsgrün<strong>de</strong><br />
gebe, verneinen. Man einigte sich, »dass es wohl zweckmässig sei, die vollzogene Einigung auch nach<br />
aussen hin« in einer »gemeinsame[n] Organisation« zu realisieren. Die KcG-Vertreter waren aus<br />
pragmatischen Grün<strong>de</strong>n damit einverstan<strong>de</strong>n, dass man <strong>de</strong>n Zusammenschluss in <strong>de</strong>m sich konstituieren<strong>de</strong>n<br />
BfC vollziehen sollte, »und zwar unter Beibehaltung <strong>de</strong>s von <strong>de</strong>r Regierung selbst vorgeschlagenen<br />
und genehmigten Namens«. Die BfC-Vertreter sagten zu, dass die <strong>de</strong>r »Regierung vorgelegte<br />
Satzung, welche ohnehin noch nicht als endgültig betrachtet wor<strong>de</strong>n sei«, eine Überarbeitung<br />
»unter tatkräftiger Mitwirkung« <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« erfahren solle.<br />
Lange war über diesen nicht erwarteten Durchbruch sehr überrascht. Alle KcG-Vertreter waren<br />
beeindruckt von Ernst Brockhaus, <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Enge seines <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>kreises heraus- und von <strong>de</strong>n Trennungen<br />
unter <strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« wegkommen wollte. Außer<strong>de</strong>m lobte Lange, dass sich die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> ihnen<br />
– <strong>de</strong>n KcG – gegenüber sehr großzügig verhalten hätten. 67<br />
Die Einigung zwischen BfC und KcG schlug sich in einer gemeinsamen Erklärung – verfasst von<br />
Lange – nie<strong>de</strong>r, die an bei<strong>de</strong> Gemeinschaftskreise gerichtet war. Darin verzichtete man auf die Klärung<br />
<strong>de</strong>r Streitfrage, wie die Trennung von 1848 zwischen <strong>de</strong>n »Exklusiven« und <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n«<br />
zu bewerten sei. Der BfC erklärte, dass man <strong>de</strong>n Exklusivitätsanspruch bezüglich <strong>de</strong>r Abendmahlsfeier<br />
nicht mehr aufrechterhalte, und erkannte eine gewisse Selbständigkeit <strong>de</strong>r örtlichen Ge-<br />
63 Hans Becker, »Elberfel<strong>de</strong>r Zusammenkunft vom 30. Mai 1937«, in: Kretzer, S. 82–88.<br />
64 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Zeiger, Nie<strong>de</strong>rschrift über die Zusammenkunft vom 20. August 1937.<br />
65 Ebd.<br />
66 Christian Schatz in Gna<strong>de</strong> und Frie<strong>de</strong> 29 (1938), S. 125.<br />
67 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Ernst Lange an Albert von <strong>de</strong>r Kammer, 23. August 1937.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 19<br />
mein<strong>de</strong> an. Die KcG ihrerseits erkannten die Grenzen dieses Prinzips an. Die »praktische Durchführung<br />
dieser Vereinigung« sollte dann in weiteren Verhandlungen erfolgen. 68<br />
Seitens <strong>de</strong>s BfC erfolgte <strong>de</strong>r Bestätigungsvorgang hinsichtlich einer Vereinigung – bis jetzt bestand<br />
ja nur eine Absichtserklärung von führen<strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n – problemlos. Es gab viele in <strong>de</strong>r neuen Organisation,<br />
die die bisherige Enge <strong>de</strong>s alten Gemeinschaftskreises überwin<strong>de</strong>n wollten und somit für<br />
einen ersten Schritt in diese Richtung offen waren. 69 Dazu kam eine straffe Führung durch die BfC-<br />
Spitze (v. a. durch Becker), die <strong>de</strong>n ganzen Vereinigungsprozess relativ schnell und ohne größeren<br />
Wi<strong>de</strong>rstand durchführte. 70 Bereits am 10. Oktober fand in Wuppertal-Elberfeld eine Besprechung <strong>de</strong>r<br />
Ortsbeauftragen und <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r örtlichen Bru<strong>de</strong>rräte statt, um über die Vereinigung mit <strong>de</strong>n<br />
KcG zu beraten. Die etwa 900 Teilnehmer stimmten <strong>de</strong>r »Kasseler Erklärung« fast einmütig zu. Eine<br />
Zusammenkunft <strong>de</strong>r Ortsbeauftragten für das östliche Deutschland am 14. Oktober gab ebenfalls ihre<br />
Zustimmung zur geplanten Vereinigung; auch eine Zusammenkunft <strong>de</strong>r Reisebrü<strong>de</strong>r signalisierte<br />
Akzeptanz, was umso schwerer wog, als sie die Schicht <strong>de</strong>r mehr konservativen »Darbysten« repräsentierte.<br />
Vertreter <strong>de</strong>r KcG waren von dieser »Einmütigkeit« tief beeindruckt. 71<br />
Komplizierter gestaltete sich <strong>de</strong>r Prozess bei <strong>de</strong>n KcG, weil es darum ging, <strong>de</strong>n bisher bestehen<strong>de</strong>n<br />
losen Verband aufzugeben und in einen schon existieren<strong>de</strong>n Bund mit seinen hierarchischen Strukturen<br />
einzutreten. Christian Schatz beschrieb En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Jahres präzise die bei<strong>de</strong>n Aspekte dieser Problematik:<br />
Zum einen sei zu entschei<strong>de</strong>n gewesen, welche praktischen Folgerungen die KcG aus <strong>de</strong>r<br />
Kasseler Erklärung zu ziehen hätten; zum an<strong>de</strong>ren habe die Gestapo <strong>de</strong>n KcG klargemacht, dass sie<br />
sich »eine festere Organisation zu geben« hätten, wenn die Gemein<strong>de</strong>n in ihrer Existenz nicht gefähr<strong>de</strong>t<br />
sein sollten. 72 Eine eigene Organisation in Übereinstimmung mit <strong>de</strong>n gefor<strong>de</strong>rten Rahmenbedingungen<br />
hätte aber erhebliche Kosten für die KcG verursacht. Tatsächlich wur<strong>de</strong> dann aber doch noch<br />
ein Entwurf für eine neue Organisationsform <strong>de</strong>r KcG ausgearbeitet; als Namen schlug man vor:<br />
»Bund kirchenfreier biblischer Gemein<strong>de</strong>n«. 73 Ähnlich <strong>de</strong>n Strukturen <strong>de</strong>s BfC sollte es auch hier ein<br />
Beauftragtenwesen und ein »Entscheidungsrecht von oben« geben.<br />
Die leiten<strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>r KcG verfolgten aber seit <strong>de</strong>m 20. August, da die trennen<strong>de</strong>n Schranken<br />
zwischen bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-Richtungen grundsätzlich überwun<strong>de</strong>n waren, die Absicht, in <strong>de</strong>n BfC<br />
einzutreten. Heinrich Neumann hatte Theodor Küttner (Leipzig) und an<strong>de</strong>re eingehend über die<br />
Gespräche mit <strong>de</strong>m BfC informiert. 74 Der Beschluss über ein Zusammengehen sollte dann auf <strong>de</strong>r<br />
Berliner Konferenz im November erfolgen.<br />
Gegen <strong>de</strong>n beabsichtigten Eintritt in <strong>de</strong>n BfC, aber auch gegen eventuelle Än<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Organisationsform<br />
<strong>de</strong>r KcG gab es Opposition. So lehnten die Leipziger <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> (u. a. Küttner) in einem<br />
Schreiben an Christian Schatz und an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n Zusammenschluss mit <strong>de</strong>m BfC ab. Man sei zwar nicht<br />
»gegen die Gemeinschaft mit <strong>de</strong>n ›Elberfel<strong>de</strong>rn‹«; aber die Strukturen <strong>de</strong>s BfC stießen auf Ablehnung.<br />
75 Noch En<strong>de</strong> Oktober schrieb Lange, dass ihm Küttner eine Ausarbeitung zugeschickt habe, die<br />
68 »An die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s ›Bun<strong>de</strong>s freikirchlicher Christen‹ und <strong>de</strong>r ›Kirchenfreien christlichen Gemein<strong>de</strong>n‹«,<br />
20. August 1937, in: Kretzer, S. 125 (unterzeichnet war dieses Schreiben u. a. von Hans Becker als Vertreter <strong>de</strong>s BfC<br />
und Ernst Lange als Vertreter <strong>de</strong>r KcG).<br />
69 So auch Paul Schmidt in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>spost, Nr. 5, August 1937, S. 4 (Oncken-Archiv Elstal).<br />
70 Siehe hierzu und zum Folgen<strong>de</strong>n Jordy, Bd. 3, S. 161ff.<br />
71 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Ernst Lange an Albert von <strong>de</strong>r Kammer, 29. Oktober 1937.<br />
72 Christian Schatz, Rundschreiben an die bisherigen KcG, 1. Dezember 1937, in: Kretzer, S. 128.<br />
73 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Jordy, 1933–1945, Entwurf ohne Datum; vgl. auch Jordy, Bd. 3, S. 164. Er datiert diesen<br />
Entwurf auf Oktober 1937.<br />
74 Vgl. dazu Jordy, Bd. 3, S. 164.<br />
75 Ebd.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 20<br />
zeige, dass er noch tief in <strong>de</strong>n bisherigen Denkmustern verfangen sei. Seine Weigerung, sich auf diese<br />
neue Organisationsform einzulassen, gefähr<strong>de</strong> das Ganze. 76<br />
Schatz versuchte seinerseits <strong>de</strong>n Kritikern zu ver<strong>de</strong>utlichen, dass man sich aufgrund von – schon<br />
oben erwähnten – Auskünften <strong>de</strong>r Gestapo unbedingt eine neue Ordnung geben müsse. Außer<strong>de</strong>m<br />
habe man <strong>de</strong>n Anordnungen <strong>de</strong>r Obrigkeit Folge zu leisten. 77 Eine ganze Reihe von <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n teilten<br />
diese Sicht aber nicht. Es sei zuerst zu prüfen, was biblisch legitimierte For<strong>de</strong>rungen seien. Einige<br />
meinten, die Einreichung von Mitglie<strong>de</strong>rlisten bei <strong>de</strong>r Gestapo sei gerechtfertigt, an<strong>de</strong>re lehnten auch<br />
dies ab; einig war man sich in <strong>de</strong>r Ablehnung <strong>de</strong>s Eintritts in <strong>de</strong>n BfC o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Bildung eines eigenen<br />
Bun<strong>de</strong>s auf <strong>de</strong>r Grundlage <strong>de</strong>s Satzungsentwurfs, da dieser unbiblisch sei.<br />
Schatz meinte nun, dass viele »<strong>de</strong>n kirchenpolitischen Ernst <strong>de</strong>r Stun<strong>de</strong> – so wie er ihn beurteilte<br />
– nicht begriffen hatte[n]«. 78 Er befürchtete <strong>de</strong>shalb nicht nur eine »Vereitelung« <strong>de</strong>s Zusammengehens<br />
mit <strong>de</strong>m BfC, son<strong>de</strong>rn auch ein Verbot <strong>de</strong>r KcG durch die Gestapo.<br />
Albert von <strong>de</strong>r Kammer bezeichnete die Ablehnung von Verän<strong>de</strong>rungen als eine Haltung »<strong>de</strong>r<br />
Überhebung und <strong>de</strong>r Unfehlbarkeit«, wie sie sich in Dres<strong>de</strong>n und darüber hinaus in Sachsen immer<br />
noch zeige. Er hoffte darauf, dass Lange durch Predigtdienste noch kurz vor <strong>de</strong>r Berliner Konferenz<br />
daran etwas än<strong>de</strong>rn könne. 79<br />
Man erwartete <strong>de</strong>shalb mit Spannung, wie die Konferenz in Berlin entschei<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>. Die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
Aussprache, über die Christian Schatz in einem Rundschreiben ausführlich berichtete,<br />
fand am 15. November 1937 statt. 80 Die Gegner machten noch einmal ihre Be<strong>de</strong>nken geltend, »hauptsächlich<br />
auf <strong>de</strong>r Linie, daß wir eine Organisation <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n bisher als nicht schriftgemäß abgelehnt<br />
hätten«. Dagegen sagten die »führen<strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, dass die kirchenfreien Christen »nicht in<br />
einen Bund <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn nur in <strong>de</strong>n ›Bund <strong>de</strong>r freikirchlichen Christen‹ einzutreten«<br />
hätten. »Dieser Bund ist also nicht ein Bund <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn [eine Organisation] von einzelnen<br />
Personen«. Interessant ist, dass man die Notwendigkeit <strong>de</strong>r grundlegen<strong>de</strong>n Verän<strong>de</strong>rung bei<br />
<strong>de</strong>n bisherigen KcG nun viel stärker auf <strong>de</strong>n Aspekt <strong>de</strong>r Organisation konzentrierte, als das Becker bei<br />
<strong>de</strong>r Gründungsversammlung <strong>de</strong>s BfC im Mai getan hatte. Man begrün<strong>de</strong>te nämlich die angestrebte<br />
Vereinigung damit, dass, »wie schon wie<strong>de</strong>rholt von <strong>de</strong>n beauftragten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n mitgeteilt wur<strong>de</strong>, …<br />
<strong>de</strong>r Staat eine klare Organisation [will], durch die er je<strong>de</strong>rzeit die Arbeit <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> übersehen und<br />
sich über die Stellung <strong>de</strong>r einzelnen Gemein<strong>de</strong>glie<strong>de</strong>r unterrichten kann«.<br />
Man gab aber auch eine politische Begründung, in<strong>de</strong>m man ausführte, dass man die Absicht <strong>de</strong>s<br />
NS-Staates, »zur kollektiven Zusammenarbeit« zu erziehen, und sein Bestreben, »daß auch die<br />
christlichen Gemeinschaften in ihrem Zusammenleben innerhalb ihres Volkes in einer äußeren Ordnung<br />
diesen Gedanken zur Auswirkung bringen« sollten, unterstütze. Die Konsequenz sei, dass man<br />
»an die Spitze unserer Gemein<strong>de</strong>n einen Leiter o<strong>de</strong>r Beauftragten« zu stellen habe. Er sollte nicht nur<br />
die »Wünsche <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n« ausführen, »son<strong>de</strong>rn auch <strong>de</strong>m Staat gegenüber die Verantwortung<br />
für ein richtiges Verhalten und Gebaren <strong>de</strong>r von ihm vertretenen Gemein<strong>de</strong>glie<strong>de</strong>r« übernehmen.<br />
Damit mussten <strong>de</strong>m Beauftragten aber auch Kompetenzen <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n gegenüber eingeräumt<br />
wer<strong>de</strong>n. Schatz meinte dann, dass bei einer Abfrage am Abend nur noch drei <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> gegen <strong>de</strong>n Beitritt<br />
zum BfC gewesen seien. Paul Frey, einer <strong>de</strong>r Gegner, erwähnt dagegen vier <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>, die sich ablehnend<br />
zeigten. 81 Dem Evangelisten Willi Windgasse soll man <strong>de</strong>n Eintritt verwehrt haben. 82<br />
76 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Ernst Lange an Albert von <strong>de</strong>r Kammer, 29. Oktober 1937.<br />
77 Vgl. Jordy, Bd. 3, S. 164f.<br />
78 Ebd., S. 165.<br />
79 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Albert von <strong>de</strong>r Kammer an Ernst Lange, 1. November 1937.<br />
80 Christian Schatz, Rundschreiben an die ehemaligen KcG, 1. Dezember 1937, in: Kretzer, S. 128.<br />
81 Paul Frey an Rudolf Kretzer, 18. Dezember 1945, zitiert nach Kretzer, S. 498, Anm. 86. Namentlich wird noch Wilhelm<br />
Vogelberg aus Unna erwähnt.<br />
82 Kretzer, S. 42.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 21<br />
Am nächsten Tag, <strong>de</strong>m 16. November, nahmen dann die Vertreter <strong>de</strong>s BfC (u. a. Becker) an <strong>de</strong>r<br />
Konferenz teil. Schatz schrieb in <strong>de</strong>m schon erwähnten Rundschreiben über dieses Ereignis: »Die<br />
Ankunft dieser <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> war ein herzbewegen<strong>de</strong>r Augenblick«. Man saß nun in »brü<strong>de</strong>rlicher Verbun<strong>de</strong>nheit<br />
<strong>zusammen</strong>«, um <strong>de</strong>n Vereinigungsbeschluss zu realisieren. Schatz hob beson<strong>de</strong>rs das »brü<strong>de</strong>rliche<br />
Verhalten« <strong>de</strong>r BfC-Vertreter hervor, das auch die »letzten Zweifel« zerstreute. Diese Begegnung<br />
zeitigte dann auch ihre Wirkung, in<strong>de</strong>m am Abend dieses Tages alle Vertreter <strong>de</strong>r KcG <strong>de</strong>m<br />
Beitritt zum BfC zustimmten. 83<br />
In einer kurzen Erklärung, unterzeichnet u. a. von Schatz und Neumann, wur<strong>de</strong>n die KcG davon<br />
unterrichtet, dass ihre Abgesandten »einmütig« <strong>de</strong>n Beschluss vom August dieses Jahres »bestätigt«,<br />
<strong>de</strong>r Verfassung <strong>de</strong>s BfC »zugestimmt« und <strong>de</strong>n BfC-Vertretern zugesichert hätten, mit ihnen <strong>de</strong>n<br />
Bund aufzubauen. 84<br />
Auch später wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>rholt dieser 17. November als ein Tag erwähnt, <strong>de</strong>r neue Impulse bewirkt<br />
habe. So schrieb Lange in einer Abhandlung zur Vorbereitung <strong>de</strong>r Dezembertagung <strong>de</strong>r Taufgesinnten,<br />
dass die Vereinigungskonferenz in Berlin die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> im BfC mit »neuer Zuversicht« erfüllt habe,<br />
da diese »Einheit vom Herrn geschenkt« wor<strong>de</strong>n sei und man »<strong>de</strong>n Beginn unseres Gebets um Erweckung<br />
sehen« könne; außer<strong>de</strong>m könne man feststellen, dass »diese Vereinigung in Berlin uns alle,<br />
auch innerhalb <strong>de</strong>r bisherigen Gruppen, viel inniger verbun<strong>de</strong>n« habe. Lange meinte dazu, dies müsse<br />
auch so sein, da <strong>de</strong>r Geist jetzt, wo die Trennung beseitigt wor<strong>de</strong>n sei, viel wirksamer agieren könne.<br />
85 Auch ein Jahr später erinnerte sich Schatz in einer Rückschau auf das Jahr 1937 daran, dass diese<br />
Konferenz »ein Erlebnis« gewesen sei, das allen »unvergeßlich« bleiben wer<strong>de</strong>. Man könne es kaum<br />
mit Worten »ausdrücken, welch eine Freu<strong>de</strong> das Zusammensein herbeiführte«. 86<br />
Die praktische Umsetzung <strong>de</strong>s Eintritts in <strong>de</strong>n BfC wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sleitung <strong>de</strong>s BfC übernommen,<br />
zu <strong>de</strong>r nun auch Neumann, Schatz und von Schleinitz als Vertreter <strong>de</strong>r KcG gehörten.<br />
Schon am 4. Dezember 1937 beschloss sie, »die ›Kirchenfreien christlichen Gemein<strong>de</strong>n‹ zur Vorbereitung<br />
<strong>de</strong>r polizeilichen Anmeldung <strong>de</strong>s Zusammenschlusses mit <strong>de</strong>m B. f. C. aufzufor<strong>de</strong>rn«. 87<br />
Schatz wur<strong>de</strong> in die Finanzkommission <strong>de</strong>s BfC berufen; die reisen<strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>r KcG wur<strong>de</strong>n »in<br />
<strong>de</strong>n Gesamtdienst <strong>de</strong>s BfC eingereiht« und finanziell von <strong>de</strong>r Kassenführung <strong>de</strong>s BfC unterstützt.<br />
Einvernehmlich wur<strong>de</strong> die Bibelschule Wie<strong>de</strong>nest jetzt offiziell »in <strong>de</strong>n Dienst <strong>de</strong>s B.f.C.« gestellt;<br />
konkret zuständig für sie waren von <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sleitung Hugo Hartnack, Carl Koch, Fritz Richter und<br />
Walter Vogelbusch (also alles ehemalige »Elberfel<strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«).<br />
Weitere Rundschreiben regelten das konkrete Proce<strong>de</strong>re. Die ehemaligen KcG wur<strong>de</strong>n aufgefor<strong>de</strong>rt,<br />
jeweils einen Bru<strong>de</strong>r als Ortsbeauftragten zu benennen. 88<br />
Wie aus kirchenfreien Gemein<strong>de</strong>n BfC-Gemein<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n konnten, machte dann ein Erlass <strong>de</strong>s<br />
Gestapa vom 9. Januar 1938 <strong>de</strong>utlich, <strong>de</strong>r an alle Staatspolizei(leit)stellen weitergegeben wur<strong>de</strong>. Zuerst<br />
informierte man diese über <strong>de</strong>n Vereinigungsbeschluss. Die Vereinigung sei so vollzogen wor<strong>de</strong>n,<br />
dass die »Mitglie<strong>de</strong>r« <strong>de</strong>r KcG <strong>de</strong>m BfC beigetreten seien. Die ehemaligen KcG, die selbständige<br />
Gemein<strong>de</strong>n gewesen seien, wür<strong>de</strong>n nun »Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s freikirchlicher Christen unter <strong>de</strong>r<br />
verantwortlichen Leitung <strong>de</strong>s Ortsbeauftragten entsprechend <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sverfassung« <strong>de</strong>s BfC. Die<br />
Ortsbeauftragten müssten von Becker bestätigt wer<strong>de</strong>n. Sie müssten dann »in gleicher Weise, wie es<br />
bei <strong>de</strong>r Errichtung <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s freikirchlicher Christen geschah«, <strong>de</strong>r Polizei »hiervon unter Einreichung<br />
einer Mitglie<strong>de</strong>rliste Kenntnis« geben. 89 Damit waren diese Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r gleichen polizeili-<br />
83 Christian Schatz, Rundschreiben an die ehemaligen KcG, 1. Dezember 1937, in: Kretzer, S. 128.<br />
84 Ebd. Diese Erklärung wur<strong>de</strong> <strong>zusammen</strong> mit <strong>de</strong>m Rundschreiben von Schatz weitergegeben.<br />
85 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Ernst Lange, Grundlagen unserer Vereinigung, 3. Dezember 1937, ms., S. 4.<br />
86 Christian Schatz in Gna<strong>de</strong> und Frie<strong>de</strong> 29 (1938), S. 125.<br />
87 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Zeiger, Protokoll <strong>de</strong>r Sitzung <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sleitung <strong>de</strong>s BfC, 4. Dezember 1937.<br />
88 Vgl. dazu das BfC-Rundschreiben 18a/1937.<br />
89 Erlass <strong>de</strong>s Gestapa, 9. Januar 1938, Staatsarchiv Leipzig, PP-V 4872, Bl. 94, zitiert nach Liese, S. 318f.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 22<br />
chen Überwachung ausgesetzt wie auch die BfC-Gemein<strong>de</strong>n, die aus <strong>de</strong>r ehemaligen »Christlichen<br />
Versammlung« entstan<strong>de</strong>n waren. Gleichzeitig zeigt <strong>de</strong>r Erlass an, dass diese Vereinigung durchaus<br />
im Sinne <strong>de</strong>s NS-Regimes war. 90<br />
Dem BfC traten ca. 135 »Kirchenfreie christliche Gemein<strong>de</strong>n« bei. Hinzuweisen ist darauf, dass<br />
sich nicht alle Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« <strong>de</strong>m BfC anschlossen; so gab es beispielsweise im<br />
Frankenwald einige Gruppen, die <strong>de</strong>n Anschluss nicht vollzogen und <strong>de</strong>shalb verboten wur<strong>de</strong>n. 91<br />
Die Vereinigung von ehemaligen »Geschlossenen« und »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« wur<strong>de</strong> damals von<br />
vielen im Zusammenhang <strong>de</strong>r beabsichtigten Vereinigung <strong>de</strong>r taufgesinnten Freikirchen gesehen.<br />
Exemplarisch für diese Sicht soll hier auf Ausführungen Langes eingegangen wer<strong>de</strong>n. In seiner schon<br />
erwähnten Abhandlung von Anfang Dezember 1937, 92 mit <strong>de</strong>r er das nächste Treffen <strong>de</strong>r taufgesinnten<br />
Gruppen vorbereiten wollte, verwies er ausdrücklich auf die Initiative <strong>de</strong>r Baptisten vom Frühjahr<br />
dieses Jahres und meinte, dass mit <strong>de</strong>r Erklärung von Kassel »ein be<strong>de</strong>utsamer Schritt zur Erreichung<br />
dieses Ziels bereits erfolgt« sei; seit <strong>de</strong>r Entscheidung in Berlin existiere nun ein gemeinsamer Bund.<br />
Damit sei man zu <strong>de</strong>n ursprünglichen Grundsätzen <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung zurückgekehrt, nach <strong>de</strong>nen<br />
es keine Spaltungen im Leib Christi geben sollte. Im Hinblick auf das kommen<strong>de</strong> Gespräch verwies<br />
er ausdrücklich auf die Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-Gruppen als ein »Schulbeispiel« dafür,<br />
»wie sich eine Vereinigung allein vollziehen kann«. Er beschrieb dann <strong>de</strong>tailliert »die Punkte«, die<br />
für das Zusammengehen bei<strong>de</strong>r Gruppen wichtig gewor<strong>de</strong>n seien; zugleich sah er darin »Grundlagen<br />
für alles weitere Beginnen«, um das Ziel eines Bun<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r Taufgesinnten zu erreichen. So be<strong>de</strong>ute<br />
beispielsweise die Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Gruppen nicht eine »stärkere Abson<strong>de</strong>rung von <strong>de</strong>n Gläubigen<br />
in an<strong>de</strong>ren Lagern«. Im Gegenteil: Dieses Han<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« könne als Ansporn für an<strong>de</strong>re<br />
dienen, das Gleiche zu tun. Damit wird klar: Die Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-Richtungen zu<br />
einem Bund sollte sozusagen eine Initialzündung für die weitere Vereinigung darstellen.<br />
Das Gleiche wur<strong>de</strong> auch bei <strong>de</strong>r Elberfel<strong>de</strong>r Konferenz 1938 <strong>de</strong>utlich: Hier wur<strong>de</strong> nicht nur sichtbar,<br />
dass <strong>de</strong>r um die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« erweiterte Bund nun über ein größeres Lehrpotenzial verfügte,<br />
son<strong>de</strong>rn dass von ihm auch ein Signal in die benachbarten Freikirchen ausging, in<strong>de</strong>m man zum<br />
ersten Mal eine Konferenz zum Thema Gemein<strong>de</strong> abhielt, in <strong>de</strong>r auch bekannte Theologen aus <strong>de</strong>n<br />
an<strong>de</strong>ren Freikirchen zu Wort kamen.<br />
Aus alle<strong>de</strong>m wird <strong>de</strong>utlich, dass die Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-Gruppen nicht isoliert von<br />
<strong>de</strong>m späteren Zusammenschluss von Baptisten und »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« gesehen wer<strong>de</strong>n kann. Schon beim<br />
Kasseler Gespräch im August 1937 hatten die Vertreter <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-Gruppen mit <strong>de</strong>n Baptisten<br />
über ein mögliches Zusammengehen gesprochen.<br />
6. Der Zusammenschluss <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-Gruppen und das Ausland<br />
Nicht alle »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in Deutschland schlossen sich <strong>de</strong>m BfC an. Ca. 10% verweigerten<br />
diesen Schritt. 93 Dabei han<strong>de</strong>lte es sich um eine heterogene Gruppe. Einigen<strong>de</strong>s Band stellte die Ablehnung<br />
<strong>de</strong>r Person und Lehre Beckers dar. Er galt als ein Ver<strong>de</strong>rber <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung. Davon<br />
abgesehen gab es einige, die immer wie<strong>de</strong>r versuchten, die Genehmigung für einen zweiten Bund zu<br />
erreichen. An<strong>de</strong>re lehnten eine religiöse Organisation mit einem Namen, <strong>de</strong>r diese von an<strong>de</strong>ren<br />
Christen unterschied, konsequent ab. Ein großer Teil dieses Kreises führte dann illegale Gottesdienste<br />
durch. Beson<strong>de</strong>rs ab 1942 kam es zu Verfolgungsmaßnahmen durch die Gestapo, die zu Geld- und<br />
Gefängnisstrafen führten. Personen dieses Kreises stellten nach 1945 <strong>de</strong>n Kern <strong>de</strong>r wie<strong>de</strong>rzugelassenen<br />
»Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« dar.<br />
90 Zur lokalen Umsetzung dieses Erlasses vgl. Liese.<br />
91 Vgl. dazu Kretzer, S. 498, Anm. 87.<br />
92 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Bister, Ernst Lange, Grundlagen unserer Vereinigung, 3. Dezember 1937.<br />
93 Vgl. Liese, S. 347.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 23<br />
Wichtig für die sog. »Nichtbündler« war die Frage, wie sich die ausländischen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« gegenüber<br />
<strong>de</strong>m BfC verhalten wür<strong>de</strong>n. Hatte man anfangs noch relativ zurückhaltend agiert und in Gesprächen<br />
Anfang September <strong>de</strong>n »Fernstehen<strong>de</strong>n«, wie die »Nichtbündler« von <strong>de</strong>n BfClern bezeichnet wur<strong>de</strong>n,<br />
eine größere Kompromissbereitschaft nahegelegt, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ton <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung schärfer,<br />
als die Kasseler Erklärung im Ausland stärker bekannt wur<strong>de</strong>. Im Oktober 1937 versandten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong><br />
aus <strong>de</strong>r Schweiz und Frankreich einen »Mahnruf« an die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> im BfC; eine zweite Version unterzeichneten<br />
dann auch <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> u. a. aus <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n und England. Hinsichtlich <strong>de</strong>s Zusammenschlusses<br />
mit <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« warf man <strong>de</strong>m BfC ein eigenmächtiges Han<strong>de</strong>ln vor und versuchte<br />
durch eine ausführliche Betrachtung <strong>de</strong>r historischen Umstän<strong>de</strong> von 1848 nachzuweisen, dass<br />
eine Vereinigung mit <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« gegen die Prinzipien sei, die man <strong>de</strong>r Bibel entnehmen<br />
müsse. 94<br />
In seiner Erwi<strong>de</strong>rung – u. a. unterzeichnet von Hans Becker, Ernst und Wilhelm Brockhaus –<br />
führte <strong>de</strong>r BfC über <strong>de</strong>n Zusammenschluss mit <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« aus, dass man die Uniformität<br />
im <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tum ablehne; <strong>de</strong>shalb sei es möglich, eine Entscheidung ohne Zustimmung <strong>de</strong>s Auslan<strong>de</strong>s<br />
zu treffen. Außer<strong>de</strong>m gebe es in Deutschland keine biblisch legitimierten Grün<strong>de</strong>, die gegen ein Zusammengehen<br />
mit <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« sprächen.<br />
Damit war die Kluft unüberbrückbar gewor<strong>de</strong>n. Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> im BfC hatten gegen ein grundlegen<strong>de</strong>s<br />
Prinzip <strong>de</strong>r »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« verstoßen: Alle Versammlungen sind weltweit miteinan<strong>de</strong>r<br />
verbun<strong>de</strong>n, daher müssen grundlegen<strong>de</strong> Entscheidungen von allen vollzogen wer<strong>de</strong>n, weil sie auch<br />
für alle Geltung erlangen müssen. Dieses Prinzip hatte man missachtet, in<strong>de</strong>m man ohne Absprache<br />
mit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren gehan<strong>de</strong>lt hatte.<br />
Es kam dann noch zu einem ausführlichen sowohl schriftlichen als auch mündlichen Dialog mit<br />
<strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlän<strong>de</strong>rn unter <strong>de</strong>r Führung Johannes N. Voorhoeves, <strong>de</strong>r aber keine wirkliche Annäherung<br />
<strong>de</strong>r Positionen brachte. Im Juli 1938 wur<strong>de</strong> auf einer internationalen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong><strong>zusammen</strong>kunft beschlossen,<br />
keine sog. Empfehlungsbriefe – also Schreiben einer örtlichen Versammlung, die ihren Angehörigen<br />
die Abendmahlsteilnahme in an<strong>de</strong>ren Versammlungen ermöglichte – mehr von Gemein<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>s BfC zu akzeptieren. Damit war er aus <strong>de</strong>m internationalen Verbund <strong>de</strong>r »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«<br />
exkommuniziert wor<strong>de</strong>n. Diese Entscheidung wur<strong>de</strong> im Oktober dieses Jahres <strong>de</strong>n Versammlungen<br />
<strong>de</strong>r »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« bekanntgegeben. Beson<strong>de</strong>rs für einen Bru<strong>de</strong>r wie Ernst Brockhaus be<strong>de</strong>utete<br />
dies einen schmerzlichen Einschnitt, da er noch einige Jahre zuvor mit <strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n, die jetzt<br />
hinter dieser Entscheidung stan<strong>de</strong>n, eng <strong>zusammen</strong>gearbeitet hatte. Auf dieses Schreiben antwortete<br />
<strong>de</strong>r BfC noch einmal und wies alle Vorwürfe bezüglich <strong>de</strong>s Zusammenschlusses mit <strong>de</strong>n »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« zurück: Dieser sei biblisch legitimiert. 95<br />
An<strong>de</strong>rs als die »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« reagierten die Open Brethren. So besuchte Edmund H.<br />
Broadbent, ein führen<strong>de</strong>r Angehöriger <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, 1939 BfC-Versammlungen. 96 Aufschlussreich<br />
ist auch die Beurteilung von George Henry Lang. 97 Obwohl er <strong>de</strong>n BfC als religiöse Organisation<br />
sehr kritisch sah, bewertete er die Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-Gruppen positiv und<br />
interpretierte dieses Geschehen als göttliches Han<strong>de</strong>ln. Dagegen sei bei <strong>de</strong>n »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n«<br />
noch immer das falsche ekklesiologische Prinzip Darbys, das schon 1848 zur Trennung geführt<br />
habe – die Handlung einer Versammlung sei für alle an<strong>de</strong>ren bin<strong>de</strong>nd –, wirksam, in<strong>de</strong>m sich das<br />
Ausland vom BfC getrennt habe. Lang stellte noch fest, dass die Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-<br />
Gruppen sofort positive Auswirkungen gehabt habe.<br />
94 »Mahnruf an die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> in Deutschland, die zum ›Bun<strong>de</strong> freikirchlicher Christen‹ gehören«, Zürich, 10. Oktober<br />
1937, in: Kretzer, S. 146–150.<br />
95 Abgedruckt bei Kretzer, S. 176–184.<br />
96 Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Bestand Zeiger, BfC-Geschäftsführung an die Ortsbeauftragten <strong>de</strong>r Regierungsbezirke Arnsberg,<br />
Düsseldorf und Köln, 27. Januar 1939.<br />
97 George Henry Lang, »Obversations upon The Union of Freechurch Christians in Germany«, o.J., www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/langobservations.pdf.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 24<br />
Damit hatte sich die Situation für die ehemaligen »Elberfel<strong>de</strong>r« im BfC grundlegend geän<strong>de</strong>rt: Von<br />
nun an wür<strong>de</strong>n sie sich auch international zu <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« halten.<br />
7. Resümee<br />
Abschließend soll zunächst gefragt wer<strong>de</strong>n, wie <strong>de</strong>r BfC im Kontext <strong>de</strong>s nationalsozialistischen<br />
Deutschlands zu bewerten ist. Die oft geäußerte Meinung, nach <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r BfC lediglich eine äußere<br />
Angelegenheit darstellte, ist nicht zu halten. Ist als entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Grund für das Verbot <strong>de</strong>r »Christlichen<br />
Versammlung« <strong>de</strong>r »volks- und staatsfeindliche Darbysmus« zu veranschlagen, dann muss als<br />
wichtige Vorbedingung für die Erlaubnis zur Gründung <strong>de</strong>s BfC die Auffor<strong>de</strong>rung gesehen wer<strong>de</strong>n,<br />
sich öffentlich vom ihm zu distanzieren. Genau dies tat Becker in seiner Re<strong>de</strong> am 30. Mai 1937 in<br />
Wuppertal-Elberfeld. So muss man feststellen, dass sich dieser Bund in vielerlei Hinsicht als eine an<br />
<strong>de</strong>n NS-Staat angepasste Gemeinschaft erwies, in<strong>de</strong>m man das Führerprinzip praktizierte, die Mitglie<strong>de</strong>r<br />
zur Mitwirkung im nationalsozialistischen Staat auffor<strong>de</strong>rte und <strong>de</strong>n noch »darbystisch«<br />
ausgerichteten Angehörigen <strong>de</strong>r alten »Christlichen Versammlung« erst einmal die Mitgliedschaft im<br />
Bund verweigerte. Die Überprüfung <strong>de</strong>r neuen Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s BfC durch die Gestapo sollte zu<strong>de</strong>m<br />
sicherstellen, dass nur <strong>de</strong>m NS-System genehme Personen <strong>de</strong>m Bund angehören wür<strong>de</strong>n. An<strong>de</strong>rerseits<br />
kann nicht bestritten wer<strong>de</strong>n, dass in <strong>de</strong>n BfC-Gemein<strong>de</strong>n nicht nur das gottesdienstliche Leben<br />
wie früher gepflegt wur<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn dass es auch beson<strong>de</strong>rs nach <strong>de</strong>r Vereinigung mit <strong>de</strong>n »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« durchaus zu einem geistlichen Aufschwung kam.<br />
Komplizierter ist die Frage nach <strong>de</strong>r Beurteilung <strong>de</strong>s Zusammenschlusses von »Geschlossenen«<br />
und »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« zu beantworten. Sieht man sich die einzelnen Aussagen <strong>de</strong>r agieren<strong>de</strong>n<br />
Personen an, so muss man verschie<strong>de</strong>ne Motive für diesen Schritt konstatieren. So betonte Christian<br />
Schatz in seinem Rundschreiben unmittelbar nach <strong>de</strong>r Vereinigungskonferenz <strong>de</strong>n existenzsichern<strong>de</strong>n<br />
Aspekt: Die KcG hätten sich aufgrund <strong>de</strong>r Auffor<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Gestapo »eine festere Organisationsform«<br />
geben müssen; dieser sei man, da es keine trennen<strong>de</strong>n Schranken mehr gegenüber <strong>de</strong>n »Geschlossenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« gebe, durch <strong>de</strong>n Beitritt zum BfC nachgekommen. 98 Der Entschluss zur Vereinigung<br />
hatte aber seinen Ursprung in <strong>de</strong>r Initiative <strong>de</strong>r Baptisten, die Taufgesinnten zur Einheit<br />
aufzufor<strong>de</strong>rn. Hier muss ein geistliches Motiv anerkannt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Motivation für die Auffassung, die Einheit <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> sei das eigentliche Thema <strong>de</strong>r freikirchlichen<br />
Christen im Jahre 1937, speiste sich jedoch auch aus <strong>de</strong>m damaligen Zeiterleben. Da man<br />
die liberal-individualistische Zeit im »Dritten Reich« überwun<strong>de</strong>n habe, passten die vielen Kirchen<br />
nicht mehr in <strong>de</strong>n Kontext dieser Zeit – so Lange. 99 Auf allen Gebieten strebe man die Einheit an.<br />
Auch die hohe Bewertung <strong>de</strong>s Prinzips <strong>de</strong>r religiösen Duldsamkeit gehörte dazu. So wie im BfC von<br />
Anfang an Duldsamkeit gegenüber unterschiedlichen religiösen Erkenntnissen herrschen sollte, sollte<br />
es auch zwischen <strong>de</strong>n Kirchen sein: Es sollte um Glaubens- und nicht um Erkenntniseinheit gehen. 100<br />
Schatz spricht davon, es sollte aufgezeigt wer<strong>de</strong>n, dass die »freikirchlichen Christen die Unduldsamkeit«<br />
aufgegeben hätten. 101 Er bringt dann noch einen klaren politischen Akzent in die Beurteilung<br />
hinein, in<strong>de</strong>m er die Meinung äußert, die Haltung <strong>de</strong>s NS-Staates sei die, dass »ein getrenntes Marschieren<br />
gleichgerichteter Christen nicht mehr erwünscht« sei. Hier kann man durchaus von einem<br />
politischen Motiv sprechen: Das Streben nach <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>r Christen entspricht <strong>de</strong>m Streben nach<br />
<strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Dabei wird eine Vermischung von religiösen,<br />
politischen und existenzsichern<strong>de</strong>n Motiven <strong>de</strong>utlich; die einzelnen Aspekte können nicht säuberlich<br />
voneinan<strong>de</strong>r getrennt wer<strong>de</strong>n.<br />
98 Christian Schatz, Rundschreiben an die ehemaligen KcG, 1. Dezember 1937, in: Kretzer, S. 128.<br />
99 Vgl. Archiv Wie<strong>de</strong>nest, Ernst Lange, Grundlagen unserer Vereinigung, 3. Dezember 1937.<br />
100 Ebd.<br />
101 Hierzu und zum Folgen<strong>de</strong>n Christian Schatz in Gna<strong>de</strong> und Frie<strong>de</strong> 29 (1938), S. 124.
Andreas Liese: 1937 – ein Schicksalsjahr <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung 25<br />
Festzuhalten bleibt, dass sich »Geschlossene« und »Offene <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« 1937 aufeinan<strong>de</strong>r zubewegt<br />
haben: Erstere erkannten die Notwendigkeit, ihre Position im Hinblick auf die Beziehungen <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n<br />
untereinan<strong>de</strong>r zu verän<strong>de</strong>rn, sie überwan<strong>de</strong>n ihre Vorurteile, gingen auf die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«<br />
zu und verzichteten auf die Klärung längst vergangener Sachverhalte. Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«<br />
ihrerseits waren bereit, das Prinzip <strong>de</strong>r völligen Autonomie <strong>de</strong>r Ortsgemein<strong>de</strong>n zu relativieren und<br />
Kirchenzuchthandlungen gegenseitig mehr anzuerkennen. 102 Insofern könnte das Jahr 1937 tatsächlich<br />
ein Beispiel für die För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Einheit unter Christen geben.<br />
Gedruckte Quellen und Literatur<br />
Coad, F. Roy: A History of the Brethren Movement. Its Origins, its Worldwi<strong>de</strong> Development and its Significance<br />
for the Present Day. Exeter 1968.<br />
Dierker, Wolfgang: Himmlers Glaubenskrieger. Der Sicherheitsdienst <strong>de</strong>r SS und seine Religionspolitik 1933–<br />
1941. 2., durchgesehene Auflage. Pa<strong>de</strong>rborn 2003 (Veröffentlichungen <strong>de</strong>r Kommission für Zeitgeschichte;<br />
Reihe B: Forschungen, Bd. 92).<br />
Gardiner, Alfred J. (Hrsg.): Die Wie<strong>de</strong>rherstellung und Aufrechterhaltung <strong>de</strong>r Wahrheit. Kingston-on-<br />
Thames 1964.<br />
Geldbach, Erich: Christliche Versammlung und Heilsgeschichte bei John Nelson Darby. Wuppertal 1971.<br />
Jordy, Gerhard: Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in Deutschland. 3 Bän<strong>de</strong>. Wuppertal 1979–86.<br />
Karrenberg, Kurt: »Der Freie <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>kreis (Ein Zweig <strong>de</strong>r ›<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung‹ in Deutschland)«. In:<br />
Ulrich Kunz (Hrsg.): Viele Glie<strong>de</strong>r – ein Leib. Kleinere Kirchen, Freikirchen und ähnliche Gemeinschaften in<br />
Selbstdarstellungen. Stuttgart 2 1961. S. 266–282.<br />
Kretzer, Hartmut (Hrsg.): Quellen zum Versammlungsverbot und zur Gründung <strong>de</strong>s BfC. Neustadt an <strong>de</strong>r<br />
Weinstraße 1987.<br />
Liese, Andreas: verboten – gedul<strong>de</strong>t – verfolgt. Die nationalsozialistische Religionspolitik gegenüber <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung.<br />
2., durchgesehene Auflage. Hammerbrücke 2003.<br />
Menk, Friedhelm: Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung im Dritten Reich. Das Verbot <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« 1937.<br />
Bielefeld 1986.<br />
Miller, Andrew: »Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« – allgemein so genannt. Eine kurze Übersicht über ihren Ursprung, ihre Entwicklung<br />
und ihr Zeugnis. Neustadt an <strong>de</strong>r Weinstraße 1971.<br />
Neatby, William Blair: A History of the Plymouth Brethren. London 1901.<br />
Rowdon, Harold H.: The Origins of the Brethren 1825–1850. London 1967.<br />
Schatz, Christian: »Das erste Jahr <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s freikirchlicher Christen«. In: Gna<strong>de</strong> und Frie<strong>de</strong> 29 (1938),<br />
S. 124–127.<br />
Strübind, Andrea: Die unfreie Freikirche. Der Bund <strong>de</strong>r Baptistengemein<strong>de</strong>n im »Dritten Reich«. Neukirchen-<br />
Vluyn 1991 (Historisch-theologische Studien zum 19. und 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt, Bd. 1). – 2., verbesserte<br />
Auflage. Wuppertal 1995.<br />
Warns, Johannes: Georg Müller und John Nelson Darby. Ein Rückblick auf <strong>de</strong>n sogenannten Bethesdastreit zu<br />
Bristol im Jahre 1848. Wie<strong>de</strong>nest 1936.<br />
102 Erklärung <strong>de</strong>r ehemaligen Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>, 1946, in: Menk, S. 193.
Joachim Heim, Jürgen Goldnau<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Chemnitz<br />
In Chemnitz haben sich im November 2004 die Geschwister <strong>de</strong>r »Alten Versammlung« (AV) und die<br />
<strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong> im BEFG zu einer Gemein<strong>de</strong> <strong>zusammen</strong>geschlossen. Wir möchten einige Einzelheiten<br />
berichten<br />
– zur geschichtlichen Entwicklung <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in Chemnitz,<br />
– zum Prozess <strong>de</strong>s Zusammen<strong>fin<strong>de</strong>n</strong>s und<br />
– zur gegenwärtigen Situation.<br />
Nach Anfängen im Umland <strong>de</strong>r Stadt ab etwa 1885 gab es seit 1905 in <strong>de</strong>r Stadt Chemnitz »Christliche<br />
Versammlungen« mit »Elberfel<strong>de</strong>r« Prägung; anfänglich in Privatwohnungen, dann über fast 100<br />
Jahre in <strong>de</strong>r Zietenstraße. Der Geschwisterkreis umfasste 1937 etwa 180 Personen. Unabhängig davon<br />
entstand ab 1924 eine Gemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, die 1937 etwa 30 Geschwister zählte.<br />
Diese bei<strong>de</strong>n Geschwistergruppen schlossen sich nach <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>s BfC 1937 zu einer BfC-<br />
Gemein<strong>de</strong> <strong>zusammen</strong> und versammelten sich gemeinsam in <strong>de</strong>r Zietenstraße. Etwa 15 Geschwister<br />
<strong>de</strong>r »Elberfel<strong>de</strong>r« Richtung traten <strong>de</strong>m BfC nicht bei und versammelten sich von da an getrennt und<br />
ohne rechtlichen Status als AV in Privatwohnungen. Einige an<strong>de</strong>re lehnten 1937 die Mitgliedschaft im<br />
BfC für sich zwar ebenfalls ab, versammelten sich aber weiterhin mit <strong>de</strong>n Geschwistern <strong>de</strong>r BfC-Gemein<strong>de</strong>,<br />
hielten also geistlich und beim Brotbrechen die Gemeinschaft aufrecht. Diese Situation wur<strong>de</strong><br />
von bei<strong>de</strong>n Seiten getragen.<br />
1942 trat die Chemnitzer BfC-Gemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>m BEFG bei. Auch jetzt lehnten einige Geschwister<br />
diesen Schritt und ihre offizielle Gemein<strong>de</strong>mitgliedschaft ab. Im gegenseitigen Einverständnis wur<strong>de</strong><br />
die geschwisterliche Gemeinschaft beim Brotbrechen und allen weiteren Zusammenkünften (außer<br />
<strong>de</strong>n organisationsbedingten) aufrechterhalten. Insbeson<strong>de</strong>re die Mahlfeiern trugen intern weiterhin<br />
nahezu ausschließlich »Elberfel<strong>de</strong>r« Gepräge.<br />
Allen Geschwistern, die aus unterschiedlichen Beweggrün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n organisatorischen Status <strong>de</strong>r<br />
Gemein<strong>de</strong> als BEFG-Gemein<strong>de</strong> für sich ablehnten, wur<strong>de</strong> auf Wunsch die Möglichkeit eingeräumt, die<br />
geistliche Gemeinschaft, speziell auch die Teilnahme am Brotbrechen, aufrechtzuerhalten. Voraussetzung<br />
dafür war, dass sie ein<strong>de</strong>utig als Kin<strong>de</strong>r Gottes bekannt waren. Erfor<strong>de</strong>rlichenfalls fan<strong>de</strong>n klären<strong>de</strong><br />
Einzelgespräche statt. Danach wur<strong>de</strong>n sie <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> zur Teilnahme am Mahl <strong>de</strong>s Herrn öffentlich<br />
vorgeschlagen.<br />
In <strong>de</strong>r unmittelbaren Nachkriegszeit und unter <strong>de</strong>n beson<strong>de</strong>ren Bedingungen <strong>de</strong>r sowjetischen<br />
Besatzung wur<strong>de</strong> aus Sorge um <strong>de</strong>n äußeren Fortbestand <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> die Zugehörigkeit zum BEFG<br />
bewusst beibehalten. Ein zweiter Grund für das Vertagen einer Entscheidung war die oft mehrjährige<br />
Abwesenheit vieler <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>, bedingt durch Kriegsdienst und Gefangenschaft. Dadurch und durch die<br />
allgemeine Umbruchsituation infolge Umsiedlung, <strong>de</strong>n Verzug zahlreicher Geschwister nach <strong>de</strong>n<br />
westlichen Besatzungszonen und die Entstehung zweier <strong>de</strong>utscher Staaten waren we<strong>de</strong>r Kräfte noch<br />
Übersicht vorhan<strong>de</strong>n, die zurückliegen<strong>de</strong> Entwicklung und die momentane Situation geistlich tiefgründiger<br />
aufzuarbeiten. Vorrang hatten die Sicherung <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nen und die Beobachtung und<br />
Abwägung <strong>de</strong>r zu erwarten<strong>de</strong>n Verhältnisse.<br />
Es gab einen Versuch <strong>de</strong>s gegenseitigen Näherkommens seitens <strong>de</strong>r AV. Dem wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r<br />
BEFG-Gemein<strong>de</strong> damals nicht entsprochen.<br />
Die Praxis <strong>de</strong>s <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tums, unter Kriegs- und Nachkriegsbedingungen als lebbar und tragfähig<br />
bewährt, auch gestützt durch vereinzelte starke Führungspersönlichkeiten, blieb bestimmend für die<br />
Chemnitzer Geschwister <strong>de</strong>r Zietenstraße gera<strong>de</strong> im bisher ungekannten Ausmaß <strong>de</strong>s Wechsels in<br />
<strong>de</strong>n politischen und organisatorischen Bedingungen. Die Basis <strong>de</strong>r geschwisterlichen Gemeinschaft<br />
war und blieb die unverhan<strong>de</strong>lbar zentrale Stellung <strong>de</strong>s Herrn, die Anerkennung <strong>de</strong>r Bibel als be-
Joachim Heim, Jürgen Goldnau: Entwicklung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Chemnitz 27<br />
stimmen<strong>de</strong>s Wort Gottes für das Leben <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> und <strong>de</strong>s Einzelnen sowie <strong>de</strong>r Wunsch, Ihn zu<br />
ehren im Brotbrechen und im brü<strong>de</strong>rlich-geschwisterlichen Zusammenhalt als oft schwierigem, aber<br />
durch Ihn ein<strong>de</strong>utig befohlenem Auftrag und ermöglichtem Weg.<br />
Das durch Krieg und Nachkrieg gegebene, oft von außen erzwungene Zur-Kenntnis-Nehmen <strong>de</strong>r<br />
»Schafe aus an<strong>de</strong>ren Höfen« erfolgte unter <strong>de</strong>n Bedingungen <strong>de</strong>r DDR verstärkt und war einerseits<br />
Hilfe, an<strong>de</strong>rerseits Anlass zur Profilierung und zur Frage nach <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntitätsbewahrung. Das Verhältnis<br />
zu baptistischen Geschwistern im Einzelnen und <strong>de</strong>r baptistischen Organisationsstruktur als<br />
solcher war geprägt vom Streben nach Bewahrung <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«-I<strong>de</strong>ntität, vom Bemühen um gegenseitiges<br />
Akzeptieren und vom verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rstand gegen <strong>de</strong>n Druck von außen. DDR-typische<br />
Probleme bezüglich <strong>de</strong>r Versammlungsräume führten auch in Chemnitz zu gegenseitigen Gastverhältnissen<br />
mit und bei <strong>de</strong>r Elim- und <strong>de</strong>r Baptistengemein<strong>de</strong> wie auch mit Geschwistern <strong>de</strong>r »Alten<br />
Versammlung«. Dadurch wur<strong>de</strong>n auch persönliche geistliche Begegnungen und Beziehungen geför<strong>de</strong>rt.<br />
Von <strong>de</strong>n Zeiten als BfC-Gemein<strong>de</strong> an bestan<strong>de</strong>n in Chemnitz stets auf persönlich-geistlicher,<br />
verwandtschaftlicher und/o<strong>de</strong>r beruflicher Basis Kontakte zwischen BEFG- und AV-Geschwistern.<br />
Die Intensität war zeitlich unterschiedlich und von <strong>de</strong>n Einzelnen abhängig. Sie reichte von relativ<br />
eng bis zum nur mehr unterschwelligen Wissen um das gemeinsame Glaubens- und Bibelverständnis.<br />
Ausdruck fan<strong>de</strong>n die Kontakte in Gesprächen, Informations- und Literaturaustausch, manchmal<br />
auch in Einladungen zu Vorträgen auswärtiger <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>. Auf je<strong>de</strong>n Fall aber bestand die gewollte Aufrechterhaltung<br />
<strong>de</strong>r geschwisterlichen Verbindung aus <strong>de</strong>m Wissen um <strong>de</strong>n gemeinsamen Herrn<br />
heraus.<br />
Wie auch in an<strong>de</strong>ren Gemein<strong>de</strong>n nicht nur <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung kennzeichnete in <strong>de</strong>r DDR-Zeit<br />
und beson<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>ren letzten Jahren auch die bei<strong>de</strong>n Gruppen in Chemnitz das an <strong>de</strong>r Schrift orientierte<br />
Besehen, Be<strong>de</strong>nken, Prüfen und Durchleben von<br />
– neu entstan<strong>de</strong>nen Einsichten infolge äußerer Bedingungen (z. B. Obrigkeit),<br />
– Akzentverlagerungen beim geistlichen Beurteilen (z. B. Wehrdienst),<br />
– erfor<strong>de</strong>rlichen Stellungnahmen zu Zeiteinflüssen und Zeitgeist (z. B. Schule, Pioniere, FDJ),<br />
– notwendigen Reaktionen auf konkrete Lebensbedingungen (z. B. Arbeit im VEB, Parteien).<br />
Die Beziehungen zwischen bei<strong>de</strong>n Gruppen wur<strong>de</strong>n enger, als 1993 die Geschwister <strong>de</strong>r AV am Sonntagnachmittag<br />
und auch wochentags die Versammlungsräume in <strong>de</strong>r Zietenstraße als Untermieter zu<br />
nutzen begannen. In <strong>de</strong>n Jahren 2003 und 2004 fan<strong>de</strong>n dann im engeren <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>kreis Gespräche über<br />
das gemeinsame Glaubensverständnis und über praktische Gemein<strong>de</strong>fragen statt. Gegen einen etwaigen<br />
Zusammenschluss gab es anfängliche Vorbehalte auf bei<strong>de</strong>n Seiten. Gleichzeitig waren alle Gespräche<br />
von gegenseitiger Achtung und brü<strong>de</strong>rlicher Liebe geprägt.<br />
Beim Ausbau unseres jetzigen Gemein<strong>de</strong>hauses arbeiteten die Geschwister bei<strong>de</strong>r Gruppen zwei<br />
Jahre lang »Schulter an Schulter« »handgreiflich« <strong>zusammen</strong>, nahmen die gemeinsamen Pausenmahlzeiten<br />
an »einem« Tisch ein und lernten sich auch in Arbeitskleidung näher kennen. Der<br />
Wunsch, die Trennung aufzugeben und in Chemnitz einen gemeinsamen Glaubensweg zur Ehre<br />
unseres Herrn zu gehen, nicht mehr an zwei Tischen, son<strong>de</strong>rn an einem einzigen das Brot zu brechen,<br />
half unterschiedliche Ansichten und Gewohnheiten zu akzeptieren und einan<strong>de</strong>r entgegenzukommen.<br />
Es gibt durchaus noch offene Fragen und Probleme, bei <strong>de</strong>nen wir gemeinsam nach einer schriftgemäßen<br />
Lösung suchen. Die 150 Jahre alten Lehrdifferenzen und die unterschiedliche Gestaltungsart<br />
<strong>de</strong>s praktischen Gemein<strong>de</strong>lebens sind bei<strong>de</strong>rseits wohl bekannt, gewusst und auch bei uns nach wie<br />
vor sichtbar.<br />
Nicht nur bezüglich <strong>de</strong>r Probleme aus <strong>de</strong>r Vergangenheit, son<strong>de</strong>rn auch bei <strong>de</strong>r Suche nach heute<br />
und künftig erfor<strong>de</strong>rlichen schriftgemäßen Antworten und Verhaltensweisen in ethischen, sozialen,<br />
religiösen und kulturellen Anfor<strong>de</strong>rungen eint uns das gemeinsame Bemühen darum. Wir wissen,<br />
dass wir als Gemeinschaft von <strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong> und Hilfe unseres Herrn leben und dass Sein Wirken unter<br />
uns niemals durch »Rezepte«, Metho<strong>de</strong>n und Mo<strong>de</strong>strömungen ersetzt wer<strong>de</strong>n kann und darf. Wie
Joachim Heim, Jürgen Goldnau: Entwicklung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Chemnitz 28<br />
alle Gemein<strong>de</strong>n, die biblische Antworten auf aktuelle Fragen suchen, haben wir uns immer wie<strong>de</strong>r<br />
erneut klarzumachen, dass nur in und durch Jesus Christus, unseren Herrn, eine Ihm entsprechen<strong>de</strong><br />
Einheit möglich ist und alles an<strong>de</strong>re »äußerlich«, »zeitlich« und »von dieser Welt« ist.<br />
Schriftorientiertes Wachsein, behutsames Offensein ohne Angst und wissen<strong>de</strong>s Bewahren <strong>de</strong>s<br />
Bewährten »in <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r uns zu bewahren vermag« (Judas 24) – das soll uns Aufgabe und Ziel für die<br />
Zeit vor uns sein.
Lothar Jung<br />
Auswirkungen am Beispiel <strong>de</strong>r Werke<br />
in Rehe, Lützeln und Burgstädt<br />
Das Jahr 1937 ging zu En<strong>de</strong> – auf einmal waren 90 % <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tums vereint. Ein Jahr zuvor<br />
noch un<strong>de</strong>nkbar. Jetzt Wirklichkeit. Weltweit einmalig. Viele <strong>de</strong>r heutigen AGB- und Freien <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n<br />
sind sich <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s 16. November 1937 nicht bewusst. Die meisten wären heute<br />
noch »Geschlossene« <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n. Das Jahr 1937 ist zweifellos sehr umstritten, aber es hat –<br />
ohne je<strong>de</strong>n Zweifel – die stärksten Verän<strong>de</strong>rungen in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>geschichte ausgelöst.<br />
Doch lei<strong>de</strong>r hielt die gewonnene Einheit nicht lange. Unmittelbar nach En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs<br />
kam es zu einer ersten großen Austrittsbewegung. Viele gingen zurück in die Exklusivität. 1949<br />
setzte eine zweite große Austrittsbewegung ein: <strong>de</strong>r Freie <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>kreis entstand.<br />
War damit die neu entstan<strong>de</strong>ne Einheit <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen zerstört? Sie war<br />
beschädigt, aber nicht zerstört. Die Austrittsbewegung von 1949 ist nicht mit <strong>de</strong>r von 1945 zu vergleichen.<br />
Ja, nach 1949 gab es drei <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen in Deutschland – vor 1937 waren es nur zwei. Doch wer<br />
genauer hinschaut, stellt fest: Die Bun<strong>de</strong>s-<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> und die Freien <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> organisierten sich zwar unterschiedlich,<br />
aber sie waren geistlich nicht wirklich getrennt. Die gefun<strong>de</strong>ne Mahlgemeinschaft von<br />
1937 blieb bestehen, trotz unterschiedlicher Organisationsstrukturen, bis heute – Gott sei Lob und<br />
Dank! Und das ist nicht nur ein kleiner Unterschied zum »Geschlossenen« <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tum, son<strong>de</strong>rn das<br />
ist <strong>de</strong>r wesentliche Unterschied. Unterschiedlich organisiert, aber vereint im grundsätzlichen Gemein<strong>de</strong>verständnis<br />
im Sinne <strong>de</strong>s »Offenen« <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tums. Gehörten vor 1937 in Deutschland ca. 80%<br />
zum »Geschlossenen« und ca. 20% zum »Offenen« <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tum, so waren es nach 1949 immerhin ca.<br />
60 %, die sich im Sinne <strong>de</strong>s »Offenen« <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tums versammelten, und ca. 40 % im Sinne <strong>de</strong>s »Geschlossenen«<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tums. Das ist kein Grund zum Jubeln (immer noch sind »Geschlossene« und<br />
»Offene <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« getrennt), aber es ist ohne Zweifel ein Grund zur Dankbarkeit, be<strong>de</strong>nkt man, wie es<br />
vor 1937 war. Heute verstehen sich sogar ca. 70 % <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tums im Sinne <strong>de</strong>r »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«. Ich bedaure es sehr, dass dies so wenig bewusst reflektiert und dankbar gelebt wird. Mein<br />
Wunsch ist, dass dieser Tag <strong>de</strong>r dankbaren Bewusstmachung dient.<br />
Doch trotz <strong>de</strong>r zwei Wege im <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tum mit »offenem« Verständnis (<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> im BEFG<br />
und Freie <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>) ist doch etwas von <strong>de</strong>r weltweit einmalig gefun<strong>de</strong>nen Einheit von 1937 bis heute<br />
geblieben. Ich nenne die Stichworte Rehe, Lützeln, Burgstädt. Ich könnte auch noch sagen: Arbeitskreis<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>geschichte, Arbeitskreis Wachstum, Diakonie für Christus, Evangelium für Kin<strong>de</strong>r, Herausgeberkreis<br />
Elberfel<strong>de</strong>r Bibel, Herausgeberkreis Glaubenslie<strong>de</strong>r, Jugendarbeit Ost<strong>de</strong>utschland, Persis,<br />
Perspektive, Senioren für Christus u. a. m. Ja, auch Wie<strong>de</strong>nest gehört dazu, hat aber in verschie<strong>de</strong>ner<br />
Hinsicht eine Son<strong>de</strong>rstellung.<br />
Aber zurück zu Rehe, Lützeln, Burgstädt. Alle drei Werke wer<strong>de</strong>n seit Jahrzehnten von bei<strong>de</strong>n<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen getragen. Verantwortliche in <strong>de</strong>n Gremien, aus bei<strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen kommend,<br />
arbeiten gut und segensreich <strong>zusammen</strong>. Die Werke arbeiten in bei<strong>de</strong> Gemein<strong>de</strong>gruppen hinein und<br />
wer<strong>de</strong>n von bei<strong>de</strong>n Seiten unterstützt und genutzt. Es kommt mir vor, als ob an diesen Stellen, nicht<br />
so im Blickpunkt <strong>de</strong>r Tagesthemen, <strong>de</strong>r tiefe <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>traum von <strong>de</strong>r Einheit heimlich weiterlebt. Und<br />
wenn die führen<strong>de</strong>n Vertreter <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen nicht gera<strong>de</strong> in informellen Sitzungen miteinan<strong>de</strong>r<br />
ringen, kann man sie an solchen Orten bei ganz harmonischen Begegnungen brü<strong>de</strong>rlichen Miteinan<strong>de</strong>rs<br />
erleben. Herrlich! Wenn das doch Kreise ziehen könnte!<br />
Ich bin <strong>de</strong>r Frage nachgegangen, wie es möglich war, dass man in <strong>de</strong>r Verantwortung und Arbeit in<br />
Werken gemeinsam marschieren konnte, während sich die Wege <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen doch<br />
eher voneinan<strong>de</strong>r entfernten.
Lothar Jung: Auswirkungen am Beispiel <strong>de</strong>r Werke in Rehe, Lützeln und Burgstädt 30<br />
Christliches Erholungsheim Westerwald in Rehe<br />
Fünf relativ junge Männer <strong>de</strong>r Versammlung Rehe/Westerwald entschlossen sich in <strong>de</strong>n Wochen<br />
nach Kriegsen<strong>de</strong> 1945, das ehemalige Reichsarbeitsdienstlager zu erwerben und zu einem christlichen<br />
Erholungsheim aufzubauen. Dies geschah unter viel Gebet.<br />
Zunächst kam das Haus unter die Obhut <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s. 1947 fan<strong>de</strong>n die ersten Freizeiten in Rehe<br />
statt. Versorgt wur<strong>de</strong> man durch die Bru<strong>de</strong>rhilfe in Dillenburg, eine soziale Einrichtung <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s.<br />
1953 löste man das Heim aus <strong>de</strong>m Bund heraus und führte es in eine selbständige Stiftung.<br />
Horst Weiß aus Haiger, langjähriger Vorstandsvorsitzen<strong>de</strong>r in Rehe, erzählt: »Es war ein ungeschriebenes<br />
Gesetz, dass immer ein Bru<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r einen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppe <strong>de</strong>n Verwaltungsratsvorsitz<br />
innehatte und ein Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppe <strong>de</strong>n Vorstandsvorsitz.« Stets stand das Anliegen<br />
um das Haus und die Menschen im Vor<strong>de</strong>rgrund, das Gruppen<strong>de</strong>nken spielte keine Rolle.<br />
Die Reher Versammlung ist von ihrer Entstehung her eine Versammlung <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«,<br />
zu <strong>de</strong>r 1937 die Geschwister <strong>de</strong>r kleinen »Geschlossenen« Versammlung dazukamen. Drei <strong>de</strong>r alten<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>r Reher Versammlung berichteten mir kürzlich: »Als Reher Versammlung waren wir immer<br />
offen für bei<strong>de</strong> <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen und fühlen uns ihnen bis heute verbun<strong>de</strong>n.« Gemäß Satzung gehören<br />
stets fünf <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>r Reher Versammlung zum Verwaltungsrat <strong>de</strong>r Stiftung <strong>de</strong>s Erholungsheims. So<br />
trugen sie diesen guten, verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Geist von Anfang an in die Arbeit dieser wichtigen Begegnungsstätte.<br />
Willi Rapp, einer <strong>de</strong>r alten Reher Freizeitleiter, betont: »Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> sagten zu mir: Du gehst nach<br />
Rehe als Mitarbeiter für die Jugend, nicht als Bun<strong>de</strong>smann. Aus diesen Dingen hältst du dich raus.«<br />
So durften Generationen von Geschwistern bei<strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen hier ihre geistliche Prägung<br />
erleben. Rehe bil<strong>de</strong>t bis heute eine brü<strong>de</strong>rgruppenübergreifen<strong>de</strong> Klammer.<br />
Stiftung Christliches Altenheim in Lützeln<br />
Die 1965 gegrün<strong>de</strong>te Stiftung Christliches Altenheim Lützeln ist ebenfalls ein Werk bei<strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen.<br />
Führen<strong>de</strong> Grün<strong>de</strong>r wie die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> Wilhelm Loh, Rudolf Loh und Hermann Loh sorgten<br />
dafür, dass in <strong>de</strong>r Satzung von Lützeln bis heute festgeschrieben ist, dass <strong>de</strong>r Verwaltungsrat stets<br />
brü<strong>de</strong>rgruppenausgewogen besetzt sein muss.<br />
Klaus Hassel (Altenkirchen), langjähriger Vorstandsvorsitzen<strong>de</strong>r in Lützeln – übrigens <strong>de</strong>r einzige<br />
noch leben<strong>de</strong> Grün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Einrichtung –, ließ mich wissen: »Nie empfan<strong>de</strong>n wir unser Miteinan<strong>de</strong>r<br />
in <strong>de</strong>n Gremien als Wettbewerb zwischen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen. Da wur<strong>de</strong> gar nicht drüber gesprochen.«<br />
1987 berief man mich als jungen Mann in <strong>de</strong>n Verwaltungsrat dieser Einrichtung, und ich staunte<br />
nicht schlecht über die Atmosphäre, die in <strong>de</strong>n Gremiensitzungen herrschte: Man re<strong>de</strong>te sich zwar<br />
förmlich mit »Sie« an, aber <strong>de</strong>r Umgang miteinan<strong>de</strong>r war respektvoll, liebevoll und herzlich. Dies<br />
habe ich, auch nach mittlerweile 25 Jahren, stets als sehr vorbildlich erlebt.<br />
Wolfgang Zint, langjähriger Verwaltungsratsvorsitzen<strong>de</strong>r, weist darauf hin: »Wer Verantwortung<br />
trägt, <strong>de</strong>r muss das Ganze sehen. Lützeln wur<strong>de</strong> von starken Persönlichkeiten geprägt, die keine Quertreiber<br />
waren.«<br />
Bibelschule Burgstädt e. V.<br />
Als 1960 die Bibelschule Burgstädt entstand, spielte das Thema unterschiedlicher <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen<br />
keine Rolle. Die politische Situation in <strong>de</strong>r DDR ließ diese Frage nicht zu. Gemeinsam trugen die<br />
Gemein<strong>de</strong>n das entstehen<strong>de</strong> kleine Werk in Burgstädt. Zunächst bot man 2-Monats-Lehrgänge an, ab<br />
1973 kamen sogar Jahreskurse dazu. Dies dauerte bis 1991.<br />
Auch die örtliche Burgstädter Gemein<strong>de</strong> ist von ihrer Entstehung her eine »Offene« <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>,<br />
zu <strong>de</strong>r 1937 die Geschwister <strong>de</strong>r kleinen »Geschlossenen« Versammlung hinzukamen. Beson<strong>de</strong>rs<br />
Familie Am En<strong>de</strong> prägte die Gemein<strong>de</strong> über Jahrzehnte.<br />
Die Nachwen<strong>de</strong>zeit brachte <strong>de</strong>n neuen Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>rn die gleiche Situation mit zwei <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen<br />
wie auch <strong>de</strong>n alten Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>rn. Gottfried Pfeiffer sen. berichtet über diese Zeit: »Wir Burgstädter<br />
wollten im Bund bleiben. Wir sind eine Truppe, die immer ihr eigenes Ding gemacht hat. Offen<br />
nach bei<strong>de</strong>n Seiten.«
Lothar Jung: Auswirkungen am Beispiel <strong>de</strong>r Werke in Rehe, Lützeln und Burgstädt 31<br />
Die Vorstän<strong>de</strong>, die ab 1994 das Werk neu vorantrieben, waren gute Bekannte – man könnte sagen<br />
Freun<strong>de</strong> – aus <strong>de</strong>r überörtlichen Jugendarbeit Ost: Karl-Heinz Vanhei<strong>de</strong>n, Jürgen Lutter, Andreas<br />
Ebert. Lothar Jung kam aus <strong>de</strong>n alten Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>rn dazu. Dass wir unsere Anstellungsverhältnisse<br />
in unterschiedlichen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen hatten, war von untergeordneter Be<strong>de</strong>utung.<br />
Richtungsfragen <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen Fraktionen beschäftigten uns wenig. Gemeinsam ging es uns<br />
darum, auf Gott und sein ewig gültiges Wort zu hören. Die geistlich prägen<strong>de</strong> Arbeit an jungen Menschen<br />
(immer aus bei<strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen und darüber hinaus) hatte oberste Priorität. Freilich offenbart<br />
theologische Arbeit auch sehr schnell Unterschie<strong>de</strong> in Lehrfragen. Doch nicht das Bestehen auf<br />
<strong>de</strong>r eigenen theologischen Position steht im Vor<strong>de</strong>rgrund, son<strong>de</strong>rn vielmehr <strong>de</strong>r Gehorsam gegenüber<br />
Gottes Wort, das Verstehenwollen <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren und die Bereitschaft zur Rücksichtnahme. Ich<br />
bin mir sicher, diesen Geist haben schon viele <strong>de</strong>r Bibelschüler aus Burgstädt mit in ihre Gemein<strong>de</strong>n<br />
genommen.<br />
Fazit<br />
Was hat zum Gelingen <strong>de</strong>r brü<strong>de</strong>rgruppenübergreifen<strong>de</strong>n Zusammenarbeit beigetragen?<br />
1. Starke Anlehnung von Werken an örtliche Gemein<strong>de</strong>n, die ihre Selbständigkeit verantwortlich<br />
leben, in<strong>de</strong>m sie sich bei<strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gruppen verbun<strong>de</strong>n wissen und Dienstgemeinschaft suchen<br />
und leben.<br />
2. Prägen<strong>de</strong> Persönlichkeiten, die durch starke persönliche Beziehungen verbun<strong>de</strong>n sind und sich<br />
nicht zertrennen lassen.<br />
3. Ein verantwortlicher Blick für die gemeinsamen Aufträge.<br />
Ich stelle abschließend fest: Von <strong>de</strong>m Zusammen<strong>fin<strong>de</strong>n</strong> 1937 ist mehr übriggeblieben, als es <strong>de</strong>n meisten<br />
Geschwistern und Gemein<strong>de</strong>n heute bewusst ist. Ich fin<strong>de</strong>, dafür gilt Gott großer Dank.<br />
Nach vorne blickend beschäftigen mich folgen<strong>de</strong> Fragen: Wie wird es mit <strong>de</strong>m Miteinan<strong>de</strong>r unserer<br />
Gemein<strong>de</strong>n weitergehen? Mein Eindruck ist: In <strong>de</strong>r jüngeren Generation verliert man sowohl<br />
persönlich als auch gemeindlich das Interesse an einem brü<strong>de</strong>rgruppenübergreifen<strong>de</strong>n Miteinan<strong>de</strong>r.<br />
Ist das Vermächtnis unserer Väter wertlos gewor<strong>de</strong>n? Verlieren wir in einer individualistisch geprägten<br />
Gesellschaft ein Gut, das uns in einer freiheitlich unterdrückten Zeit geschenkt wur<strong>de</strong>? Es stellt<br />
sich die herausfor<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Frage: Haben die Grundsätze <strong>de</strong>s »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tums« unseren Gemein<strong>de</strong>n<br />
von morgen noch etwas zu bieten? Wenn ja, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen,<br />
wie wir die Staffel weitergeben. Wenn nein, dann bleibt es eine Ausgrabungsstelle für die Historiker.
Andreas Schmidt<br />
»Was haben wir damit zu tun?«<br />
Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung<br />
damals und heute<br />
»Der Staat spielte im geistlichen Denken <strong>de</strong>r ›<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>‹ offiziell keine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Rolle. Das Bürgerrecht<br />
<strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r Gottes war für sie im Himmel, das Denken <strong>de</strong>r Christen hatte sich vornehmlich auf<br />
die das Reich Gottes betreffen<strong>de</strong>n Dinge zu richten. Der Staat war nur insofern in die Überlegungen<br />
einbezogen, als man nach Röm. 13 <strong>de</strong>r Obrigkeit untertan zu sein hatte.« So beginnt Gerhard Jordy<br />
<strong>de</strong>n dritten Teil seiner Geschichte <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in Deutschland. 1 Mit diesen Sätzen wird die<br />
Stellung <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung innerhalb <strong>de</strong>r Gesellschaft treffend angerissen – abgesehen davon, dass<br />
<strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s »Reiches Gottes« nach <strong>de</strong>m Verständnis <strong>de</strong>r meisten »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« nur Israel bzw. ein<br />
zukünftiges Tausendjähriges Reich betraf. Doch gera<strong>de</strong> dieses Verständnis <strong>de</strong>r Heilsgeschichte hatte<br />
grundlegen<strong>de</strong> Auswirkungen bei <strong>de</strong>r Frage nach <strong>de</strong>m gesellschaftlichen Engagement.<br />
Der Hinweis, dass hier die »offizielle« Meinung zum Ausdruck kommt, <strong>de</strong>utet schon an, dass<br />
daneben eine alternative Haltung existierte, die möglicherweise weniger reflektiert, aber dafür in <strong>de</strong>r<br />
Praxis umso wirkmächtiger war. Gepaart mit einem bedingungslosen »Untertansein« gegenüber <strong>de</strong>r<br />
Regierung – einer For<strong>de</strong>rung, die sich bei allen gesellschaftlichen und gemeindlichen Umwälzungen<br />
durchhielt – sollte die zunehmen<strong>de</strong> Abwendung von <strong>de</strong>r »offiziellen« Stellung zum Staat dramatische<br />
Konsequenzen haben.<br />
Neutralität und Passivität<br />
Von ihrem Ursprung her verhielten sich die »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« <strong>de</strong>m Staat gegenüber neutral. Aufgrund <strong>de</strong>r<br />
heilsgeschichtlichen (dispensationalistischen) Bibel- und Geschichtsbetrachtung hatten die Regierungen<br />
und Regierungsformen allesamt nichts mehr mit <strong>de</strong>m Heilshan<strong>de</strong>ln Gottes in dieser Welt zu tun.<br />
Der Tübinger Theologieprofessor Christian Palmer, ein Kritiker John Nelson Darbys, charakterisiert<br />
treffend <strong>de</strong>ssen Einstellung zur Obrigkeit: »Keine weltliche Regierung ist mehr von Gott eingesetzt,<br />
<strong>de</strong>r Sultan ist kein Gesalbter <strong>de</strong>s Herrn, aber ebensowenig sind es Ihre Majestäten von England o<strong>de</strong>r<br />
Preußen. Nur jüdische Könige hat <strong>de</strong>r Herr gesalbt, heidnische niemals; die Ju<strong>de</strong>n haben ihr Königthum<br />
durch eigene Schuld an Nebukadnezar verloren, und von diesem Hei<strong>de</strong>n sind alle Könige <strong>de</strong>r<br />
Er<strong>de</strong> bis auf diesen Tag die Nachfolger.« 2<br />
Diese grundlegen<strong>de</strong> Entsakralisierung von Herrschaft schützte vor falschen Hoffnungen und Bindungen,<br />
die im Blick auf die Herrschen<strong>de</strong>n geknüpft wer<strong>de</strong>n konnten. Auf dieser Grundlage war auch<br />
keine Staatsform einer an<strong>de</strong>ren vorzuziehen, weshalb Darby zum Beispiel die aufkommen<strong>de</strong> Demokratie<br />
im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt im Gegensatz zu vielen an<strong>de</strong>ren nicht als »Ursache allen Übels« ansah. 3<br />
Doch auch wenn Regierungen grundsätzlich nicht nach Gottes Willen han<strong>de</strong>ln, so sind sie <strong>de</strong>nnoch<br />
nach Röm 13,1 »von Gott verordnet«. Deshalb wur<strong>de</strong> unter <strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« immer wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Gehorsam<br />
gegenüber <strong>de</strong>r Obrigkeit betont: »so ist das Verhalten <strong>de</strong>s Christen <strong>de</strong>r Obrigkeit gegenüber sehr<br />
einfach. Wir gehorchen Gott in <strong>de</strong>r Obrigkeit; und sobald dieser Grundsatz für uns feststeht, ver-<br />
1 Gerhard Jordy: Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in Deutschland, Band 3: Die Entwicklung seit 1937, Wuppertal 1986, S. 17.<br />
2 Christian Palmer: »Die Darbysten o<strong>de</strong>r Plymouther <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, in: <strong>de</strong>rs., Die Gemeinschaften und Sekten Württembergs,<br />
Tübingen 1877, S. 188f. (auch online unter www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/palmer.pdf).<br />
3 Siehe Marcel Hal<strong>de</strong>nwang: Religion, Politik und Staat. Zur politischen Theologie <strong>de</strong>r sogenannten »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« unter beson<strong>de</strong>rer<br />
Berücksichtigung ihrer Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit <strong>de</strong>m Nationalsozialismus, Staatsexamensarbeit Wuppertal 2003, www.<br />
<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/hal<strong>de</strong>nwang.pdf, S. 22–24.
Andreas Schmidt: Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung 33<br />
schwin<strong>de</strong>n alle Schwierigkeiten von selbst, und alle Fragen sind gelöst«, schrieb zum Beispiel <strong>de</strong>r<br />
Botschafter <strong>de</strong>s Heils in Christo 1861. 4<br />
Als <strong>de</strong>r Bibel verpflichtete Christen kam man natürlich nicht um das Wi<strong>de</strong>rstandsgebot herum, wie<br />
es in Apg 5,29 formuliert ist. Doch die Interpretation dieser sogenannten clausula petri bezog sich nur<br />
auf individuelle Gewissenentscheidungen. Der aus <strong>de</strong>m Zusammenhang sichtbare Anspruch Jesu, <strong>de</strong>r<br />
als auferstan<strong>de</strong>ner Messias Herr über alle Menschen ist und <strong>de</strong>shalb von allen Gehorsam for<strong>de</strong>rt,<br />
passte nicht in das heilsgeschichtliche Konzept.<br />
Aus <strong>de</strong>m strengen Dispensationalismus resultierte auch die strikte Unterscheidung zwischen Israel<br />
und <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>. Während Israel irdische Verheißungen besaß und Gott durch dieses Volk innerhalb<br />
<strong>de</strong>r Welt Geschichte schrieb, bezog sich alles, was die Gemein<strong>de</strong> betraf, auf <strong>de</strong>n zukünftig<br />
gedachten Himmel. Die Folge war eine Spaltung <strong>de</strong>r Wirklichkeit in zwei Bereiche, die man voneinan<strong>de</strong>r<br />
trennen zu können meinte. Auf <strong>de</strong>r einen Seite stand die menschliche Zivilisation mit ihren<br />
Strukturen und kulturellen Errungenschaften. Diese wur<strong>de</strong>n als durch und durch von <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong><br />
geprägt und korrumpiert angesehen und abwertend unter <strong>de</strong>m Begriff »Welt« <strong>zusammen</strong>gefasst. Auf<br />
<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite lagen dagegen die geistlichen Güter und Wahrheiten, die auf die jenseitige Welt<br />
Gottes verwiesen, zu <strong>de</strong>r die Gemein<strong>de</strong> jetzt schon unsichtbar gehörte und auf <strong>de</strong>ren sichtbaren Anbruch<br />
sie wartete.<br />
Dieser Dualismus, <strong>de</strong>r nicht nur in <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung zum Tragen kam, wur<strong>de</strong> verschärft durch<br />
ein apokalyptisches Weltbild. Die Gesellschaft – und das betraf sowohl die bürgerliche als auch die<br />
christliche Kirche – wur<strong>de</strong> als eine <strong>de</strong>ka<strong>de</strong>nte, sich immer weiter von Gott abwen<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Größe gesehen,<br />
<strong>de</strong>ren endgültige Vernichtung kurz bevorstand. Zugleich erwartete man eine herrliche Zukunft,<br />
die keine Ähnlichkeit mit <strong>de</strong>r düsteren Gegenwart haben wür<strong>de</strong>. Die gegenwärtigen Umstän<strong>de</strong> zu<br />
än<strong>de</strong>rn war <strong>de</strong>shalb keinen Versuch wert. Der Missiologe David Bosch fasst dieses Bewusstsein wie<br />
folgt <strong>zusammen</strong>: »Gottes Aktivität wird entwe<strong>de</strong>r in die Vergangenheit o<strong>de</strong>r in die Zukunft verlegt.<br />
In bei<strong>de</strong>n Fällen wird die Gegenwart entleert. Und da die Gegenwart leer ist, ist echtes missionarisches<br />
Engagement in bei<strong>de</strong>n Fällen unmöglich. Mission impliziert, dass hier und jetzt etwas Neues geschieht.«<br />
5<br />
Sich selbst begriff man in diesem Zusammenhang als die kleine auserwählte Schar, <strong>de</strong>ren einzige<br />
Rettung vor <strong>de</strong>m Untergang darin bestehen konnte, sich von dieser abgefallenen Welt zu lösen und in<br />
einen abgegrenzten kulturellen Raum zurückzuziehen. Wie bei apokalyptisch orientierten Bewegungen<br />
üblich, entwickelte sich ein System von Regeln, das die Abgrenzung von <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Untergang<br />
geweihten Welt symbolisierte und zugleich die eigene Frömmigkeit und Reinheit <strong>de</strong>monstrierte.<br />
Auch wenn diese Ausprägung <strong>de</strong>s Glaubens bei vielen Geschwistern durchaus zu einer vorbildlichen<br />
individuellen Ethik führte, machte sie ein konstruktives Engagement in Gesellschaft und Kultur<br />
beinahe unmöglich.<br />
Neben die Neutralität <strong>de</strong>m Staat gegenüber trat also die Passivität. Die Mitgliedschaft in Vereinen<br />
war verpönt, man weigerte sich, zur Wahl zu gehen, geschweige <strong>de</strong>nn Verantwortung in politischen<br />
Ämtern zu übernehmen. Im Gegensatz zum biblischen Vorbild <strong>de</strong>s Apostels Paulus, <strong>de</strong>r um sein<br />
Bürgerrecht im Himmel wusste, zugleich aber auch sein römisches Bürgerrecht in Anspruch nahm,<br />
sah man das »Nicht-von-<strong>de</strong>r-Welt«-Sein als das wahre Wesen christlicher Existenz an, das »In-<strong>de</strong>r-<br />
Welt«-Sein <strong>de</strong>s Gläubigen 6 dagegen nur als notwendiges Übel. Treffend <strong>zusammen</strong>gefasst wird diese<br />
Mentalität in einem Lied von John Nelson Darby:<br />
4 »Betrachtungen über <strong>de</strong>n Brief <strong>de</strong>s Apostels Paulus an die Versammlung in Rom«, in: Botschafter <strong>de</strong>s Heils in Christo<br />
9 (1861), S. 70f. (zitiert nach Hal<strong>de</strong>nwang, S. 39).<br />
5 David J. Bosch: Ganzheitliche Mission. Theologische Perspektiven, Marburg 2011, S. 88. Nach Auffassung Boschs kann<br />
missionarisches Engagement auch gesellschaftliches Engagement sein. Von daher trifft <strong>de</strong>r Vergleich wohl.<br />
6 Siehe Joh 17,11–19.
Andreas Schmidt: Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung 34<br />
7 Kleine Sammlung geistlicher Lie<strong>de</strong>r, Wuppertal 18 1989, Nr. 67 (<strong>de</strong>utsche Übersetzung: Julius Anton von Poseck).<br />
8 Siehe Andreas Liese: verboten – gedul<strong>de</strong>t – verfolgt. Die nationalsozialistische Religionspolitik gegenüber <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung,<br />
Hammerbrücke 2002, S. 249–262.<br />
9 Siehe Jordy, S. 24f.<br />
»Diese Welt ist eine Wüste,<br />
wo ich nichts zu wählen wüßte,<br />
wo ich nichts zu suchen hab’.<br />
Habe nichts hier zu betrauern,<br />
zu verlieren, zu bedauern,<br />
brauche nichts als einen Wan<strong>de</strong>rstab.« 7<br />
Wenn die Gestapo 1937 in ihrer Begründung zum Verbot <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« <strong>de</strong>ren<br />
»staats- und lebensverneinen<strong>de</strong> Haltung« anführte, 8 so hatte sie die Position <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« durchaus<br />
richtig verstan<strong>de</strong>n, zumin<strong>de</strong>st was die offiziellen Verlautbarungen anging. Tatsächlich hätte diese<br />
neutral-passive Grundhaltung zu Staat und Gesellschaft einen wirksamen – wenn auch biblisch-theologisch<br />
fragwürdigen – Schutz vor <strong>de</strong>m Einfluss <strong>de</strong>r Nazi-I<strong>de</strong>ologie bil<strong>de</strong>n können. Doch wie die<br />
Geschichte zeigt, waren die <strong>de</strong>utschen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« tiefer in dieser Welt verhaftet, als sie es in ihren<br />
Lehraussagen und Lie<strong>de</strong>rn wahrhaben wollten.<br />
Patriotismus und Neuorientierung<br />
Neben <strong>de</strong>r »offiziellen« Haltung zu Staat und Gesellschaft lässt sich eine »inoffizielle« beobachten,<br />
die sich im Verhalten <strong>de</strong>r Geschwister äußerte und im Wi<strong>de</strong>rspruch zur gelten<strong>de</strong>n Lehre stand. Diese<br />
Wi<strong>de</strong>rsprüchlichkeit hängt zum einen sicher damit <strong>zusammen</strong>, dass eine konsequente Weltabgewandtheit<br />
allgemein schwer durchzuhalten ist, zumin<strong>de</strong>st wenn man nicht wirklich räumlich einen<br />
Ort außerhalb <strong>de</strong>r Gesellschaft sucht, wie es zum Beispiel die monastischen Bewegungen taten. Zum<br />
an<strong>de</strong>ren aber kamen in Deutschland zu Beginn <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts beson<strong>de</strong>re Umstän<strong>de</strong> zum Tragen:<br />
Zunächst die als unverzeihliche Schmach empfun<strong>de</strong>ne Nie<strong>de</strong>rlage im Ersten Weltkrieg, dann das<br />
Scheitern <strong>de</strong>r ersten <strong>de</strong>utschen Demokratie in <strong>de</strong>r Weimarer Republik und schließlich die wachsen<strong>de</strong><br />
Popularität und Attraktivität <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Bewegung. Diese Ereignisse prägten die<br />
Mentalität <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerung und damit auch die <strong>de</strong>r brü<strong>de</strong>rgemeindlichen Christen in<br />
einem nicht zu unterschätzen<strong>de</strong>n Maße.<br />
Wenn man Gerhard Jordy in seiner Beschreibung folgt, zeigten sich in <strong>de</strong>r Lebenspraxis <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«<br />
schon seit <strong>de</strong>r Kaiserzeit be<strong>de</strong>utsame Brüche:<br />
– keine politische Betätigung, aber intensives wirtschaftliches Engagement<br />
– keine Feste <strong>de</strong>s Kirchenjahres in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>, aber nationale Feiertage in <strong>de</strong>r Familie<br />
– keine Verkündigung über politische Inhalte, aber Begeisterung für nationale Interessen<br />
– kein Gebrauch <strong>de</strong>s Wahlrechts, aber treue Erfüllung <strong>de</strong>r Wehrpflicht 9<br />
Neben <strong>de</strong>r nach außen vertretenen apokalyptischen Weltsicht gab es also durchaus eine innere Verbun<strong>de</strong>nheit<br />
mit <strong>de</strong>m eigenen Vaterland, die sich bis hin zum Patriotismus steigern konnte. Sie wur<strong>de</strong><br />
durch die oben genannten Ereignisse in eine verhängnisvolle Richtung gelenkt.<br />
Ein Stimmungsbild liefern dabei die Zeitschriften <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« aus dieser Zeit. Denn darin beschäftigte<br />
man sich auch immer wie<strong>de</strong>r mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen.<br />
Beson<strong>de</strong>rs die Tenne als »Christliche Monatsschrift für die heranwachsen<strong>de</strong> Jugend« tat sich auf<br />
diesem Gebiet hervor. 10<br />
In dieser Auseinan<strong>de</strong>rsetzung – <strong>de</strong>ren Inhalt an an<strong>de</strong>rer Stelle bereits ausführlich beschrieben<br />
wur<strong>de</strong> 11 – lässt sich eine <strong>de</strong>utliche Ten<strong>de</strong>nz erkennen. Zunächst beharrte die Schriftleitung immer<br />
10 Ab 1936 nannte sich die Zeitschrift »Christliches Erbauungs- und Unterhaltungsblatt für Jugend und Haus«.<br />
11 Siehe Jordy, S. 17–83, Liese, S. 121–206, und Hal<strong>de</strong>nwang, S. 4–78.
Andreas Schmidt: Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung 35<br />
wie<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r »offiziellen« Linie: keine Einmischung in Politik und Gesellschaft, keine Beteiligung<br />
an Wahlen, keine Mitgliedschaft in politischen Verbän<strong>de</strong>n. Zugleich kamen aber auch nationalistische<br />
Töne zum Tragen, so zu Beginn und während <strong>de</strong>s Ersten Weltkriegs, aus Anlass von nationalen Feiertagen<br />
o<strong>de</strong>r bei Jubiläen be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Staatsmänner wie Otto von Bismarck und Feldmarschall von<br />
Hin<strong>de</strong>nburg. Unter <strong>de</strong>r Schriftleitung Fritz von Kietzells bekam die Tenne ab 1928 sogar eine Rubrik<br />
»Ge<strong>de</strong>nktage«, in <strong>de</strong>r Ereignisse wie die Besetzung <strong>de</strong>s Ruhrgebiets durch die Franzosen, <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong><br />
von Brest-Litowsk o<strong>de</strong>r wichtige Schlachten im Ersten Weltkrieg gewürdigt wur<strong>de</strong>n. 12<br />
In <strong>de</strong>n späten 20er und zu Beginn <strong>de</strong>r 30er Jahre häuften sich Beiträge zu gesellschaftlichen Themen,<br />
ein Zeichen für die zunehmen<strong>de</strong> Politisierung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerung, die auch vor <strong>de</strong>n<br />
Gemein<strong>de</strong>n nicht Halt machte. Dabei setzte man sich auch mit <strong>de</strong>m Nationalsozialismus auseinan<strong>de</strong>r<br />
und kritisierte vor allem <strong>de</strong>n Antisemitismus und das optimistische Menschenbild. Doch mit <strong>de</strong>r<br />
fortschreiten<strong>de</strong>n Popularität dieser Bewegung wur<strong>de</strong> man immer vorsichtiger – um nicht zu sagen<br />
unkritischer – in <strong>de</strong>r Beurteilung.<br />
Aus <strong>de</strong>n Briefen und Fragen <strong>de</strong>r Leser, die in <strong>de</strong>r Tenne veröffentlicht wur<strong>de</strong>n, lassen sich Rückschlüsse<br />
auf die Haltung <strong>de</strong>r Geschwister in <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n ziehen. Dabei riefen die politischen<br />
Beiträge einerseits <strong>de</strong>n Protest <strong>de</strong>rer hervor, die entsprechend <strong>de</strong>r »offiziellen Lehre« jegliche Beschäftigung<br />
mit Politik ablehnten. An<strong>de</strong>rerseits und in zunehmen<strong>de</strong>m Maße wur<strong>de</strong>n aber auch Stimmen<br />
wie<strong>de</strong>rgegeben, welche die mangeln<strong>de</strong> Begeisterung für <strong>de</strong>n »nationalen Aufbruch« und die<br />
neutrale Haltung <strong>de</strong>r Schriftleitung kritisierten. In diesen Zuschriften wird <strong>de</strong>utlich, dass die private<br />
Beschäftigung mit Politik unter <strong>de</strong>n Geschwistern viel weiter verbreitet war, als es offiziell <strong>de</strong>n Anschein<br />
hatte. Auch die Beteiligung an Wahlen war offensichtlich für eine beträchtliche Zahl bereits<br />
selbstverständlich.<br />
Und obwohl die Schriftleitung nach wie vor starke Grün<strong>de</strong> gegen das Wählen und die Mitgliedschaft<br />
in Parteien o<strong>de</strong>r Verbän<strong>de</strong>n anführte, wuchs auch bei ihr die Toleranz gegenüber politischer<br />
und gesellschaftlicher Beteiligung von Jahr zu Jahr. Motiv dafür scheint die Anerkennung <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Politisierung unter <strong>de</strong>n Geschwistern gewesen zu sein, vermischt mit <strong>de</strong>r eigenen Aufgeschlossenheit<br />
gegenüber <strong>de</strong>n aufstreben<strong>de</strong>n nationalen und nationalsozialistischen Ten<strong>de</strong>nzen, die <strong>de</strong>m<br />
<strong>de</strong>utschen Volk Ordnung im Inneren sowie neue Geltung in <strong>de</strong>r Welt versprachen.<br />
Als sich Fritz von Kietzell im Mai 1932 zu einem Artikel entschloss unter <strong>de</strong>r Überschrift »Der<br />
Nationalsozialismus und wir – eine Antwort auf viele Fragen«, war das eine Reaktion auf die Unmenge<br />
an Leserbriefen, die zu diesem Thema bei <strong>de</strong>r Redaktion eingegangen waren. 13 Kietzell übte vorsichtige<br />
Kritik, zum Beispiel an <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Hasspropaganda, doch würdigte er auch<br />
die Be<strong>de</strong>utung dieser Bewegung als Gegengewicht zum Bolschewismus. Der Grundtenor seines Beitrags<br />
lautete aber: »Was haben wir eigentlich damit zu tun?« Dies war eine rhetorische Frage, mit <strong>de</strong>r<br />
er noch einmal <strong>de</strong>n radikalen eschatologischen Dualismus <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« heraufbeschwor und <strong>de</strong>mentsprechend<br />
die »Abson<strong>de</strong>rung von <strong>de</strong>r Welt« for<strong>de</strong>rte, die sich in einer ganz und gar apolitischen<br />
Haltung <strong>de</strong>r Gläubigen ausdrücken sollte.<br />
Das Spannungsfeld von »Christ und Gesellschaft« wur<strong>de</strong> also in <strong>de</strong>n Zeitschriften <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung<br />
immer wie<strong>de</strong>r thematisiert, ohne dass man sich jedoch inhaltlich gründlich mit <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen<br />
politischen Strömungen auseinan<strong>de</strong>rgesetzt und damit <strong>de</strong>n Lesern Orientierung geboten,<br />
geschweige <strong>de</strong>nn sie auf <strong>de</strong>n Nationalsozialismus mit seiner menschenverachten<strong>de</strong>n und antichristlichen<br />
I<strong>de</strong>ologie vorbereitet hätte. Statt<strong>de</strong>ssen schimmerte zwischen <strong>de</strong>n Zeilen <strong>de</strong>utlich die Sympathie<br />
für eine konservative, nationalistische und damit auch antikommunistische Politik durch; mitunter<br />
wur<strong>de</strong> ihr auch ganz offen das Wort gere<strong>de</strong>t. 14<br />
12 Hal<strong>de</strong>nwang, S. 51.<br />
13 Die Tenne 10 (1932), S. 149f. Siehe dazu ausführlich Liese, S. 123, und Jordy, S. 52–54.<br />
14 Nicht verschwiegen wer<strong>de</strong>n soll, dass einzelne Stimmen immer wie<strong>de</strong>r vor <strong>de</strong>m Nationalsozialismus warnten. Am<br />
be<strong>de</strong>utendsten war dabei sicher <strong>de</strong>r Ausspruch von Rudolf Brockhaus auf <strong>de</strong>r Dillenburger Konferenz 1930: »Ich<br />
habe zu meinem Entsetzen gehört, daß manche <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> die NSDAP gewählt haben. Das ist doch eine ganz und gar
Andreas Schmidt: Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung 36<br />
Nach <strong>de</strong>r Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 än<strong>de</strong>rten sich gemäß <strong>de</strong>r<br />
Lehrauffassung die Rahmenbedingungen. Nach<strong>de</strong>m Hitler nun »die Obrigkeit« darstellte, musste<br />
man ihm ja gehorchen, aber es hat <strong>de</strong>n Anschein, dass es <strong>de</strong>n meisten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n und Schwestern nicht<br />
schwerfiel. Die Mitgliedschaft in NS-Organisationen und sogar <strong>de</strong>r NSDAP war nun problemlos möglich.<br />
15 Führen<strong>de</strong> <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> ermunterten die Geschwister plötzlich offen zur Teilnahme an Wahlen o<strong>de</strong>r<br />
Volksentschei<strong>de</strong>n. Der Hitlerjugend und <strong>de</strong>m Bund <strong>de</strong>utscher Mä<strong>de</strong>l wur<strong>de</strong>n trotz ihrer Konkurrenz<br />
zur gemeindlichen Jugendarbeit positive Aspekte abgewonnen, zum Beispiel die »körperliche Ertüchtigung«.<br />
Und die Mitarbeit beim Winterhilfswerk <strong>de</strong>r Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt galt gar<br />
als diakonischer Einsatz. 16<br />
Als 1937 mit <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s freikirchlicher Christen Hans Becker und die Männer <strong>de</strong>r<br />
sogenannten »Stündchenbewegung« an Einfluss gewannen, wur<strong>de</strong> die Wandlung in <strong>de</strong>r Einstellung<br />
zu Gesellschaft und Staat auch geistlich begrün<strong>de</strong>t. In ihrer kritischen Überprüfung <strong>de</strong>s »Darbysmus«<br />
und <strong>de</strong>r darauf aufbauen<strong>de</strong>n Lehre <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« waren die »Stündchen«-Leute unter an<strong>de</strong>rem zu<br />
<strong>de</strong>m Schluss gekommen: Das Himmelsbürgertum <strong>de</strong>s Gläubigen schließt ein Engagement in <strong>de</strong>r Welt<br />
keinesfalls aus. 17 Damit wur<strong>de</strong> die kulturpessimistische Weltsicht abgelegt und die Beschäftigung mit<br />
Literatur, Kunst und Kultur rehabilitiert. Ja, man i<strong>de</strong>ntifizierte sich plötzlich ganz offiziell mit <strong>de</strong>n<br />
gesellschaftlichen Herausfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Zeit. Und damit war auch – wie Andreas Liese feststellt –<br />
»die frühere Diskrepanz zwischen offiziellen Lehren <strong>de</strong>r ›<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>‹ und <strong>de</strong>n Verhaltensweisen <strong>de</strong>r<br />
Mehrzahl <strong>de</strong>r Versammlungschristen aufgehoben wor<strong>de</strong>n«. 18<br />
Die Tragik dieser Entwicklung liegt darin, dass die biblisch begrün<strong>de</strong>te Abkehr von einem extremen<br />
eschatologischen Dualismus, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Christen jegliche Verantwortung für die Gestaltung <strong>de</strong>r<br />
gegenwärtigen Welt absprach, zu einem Zeitpunkt geschah, als die Begeisterung für die »Erfolge« <strong>de</strong>r<br />
nationalsozialistischen Bewegung ihren Höhepunkt erreichte. Die Gründung <strong>de</strong>s BfC stand somit<br />
nicht nur unter <strong>de</strong>m Zeichen <strong>de</strong>r »Lebensbejahung«, son<strong>de</strong>rn auch unter <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r überzeugten Bejahung<br />
<strong>de</strong>r NS-Diktatur.<br />
Statt die Maßstäbe für die Mitgestaltung <strong>de</strong>r Welt aus <strong>de</strong>r Heiligen Schrift abzuleiten, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
engagierten Unterstützung <strong>de</strong>s Regimes eine »geistliche« Rechtfertigung gegeben. Die <strong>de</strong>r neuen<br />
Linie folgen<strong>de</strong>n Schwestern und <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> sahen nun nicht nur bewusst ihre Verantwortung »in <strong>de</strong>r<br />
Welt«, sie waren jetzt – zumin<strong>de</strong>st politisch gesehen – auch »von <strong>de</strong>r Welt«. Und selbst wenn jemand<br />
weiterhin eine Beteiligung am politischen und gesellschaftlichen Leben ablehnte, so galt ja nach<br />
wie vor <strong>de</strong>r Gehorsam gegenüber <strong>de</strong>r Obrigkeit, <strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n Schriftauslegung als gera<strong>de</strong>zu<br />
bedingungslos gelehrt wor<strong>de</strong>n war. An eine kritische Beurteilung <strong>de</strong>s Nationalsozialismus, wie sie die<br />
Barmer Bekenntnissyno<strong>de</strong> innerhalb <strong>de</strong>r Evangelischen Kirche vollzog, war in <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung<br />
nicht zu <strong>de</strong>nken. 19<br />
antichristliche Partei« (Jordy, S. 49). 1931 wie<strong>de</strong>rholte er: »Eins ist sicher, von oben kommt diese Bewegung nicht«<br />
(Hal<strong>de</strong>nwang, S. 68). Doch er blieb ein einsamer Rufer in <strong>de</strong>r Wüste. Als die Nationalsozialisten 1933 tatsächlich an<br />
die Macht kamen, war Brockhaus bereits verstorben. (Auf die sprachliche Parallelität seiner Aussagen mit <strong>de</strong>r<br />
»Berliner Erklärung« von 1909 zur Pfingstbewegung soll hier nicht eingegangen wer<strong>de</strong>n.)<br />
15 Wie viele Geschwister aus <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n Parteigenossen waren, ist unbekannt. Es han<strong>de</strong>lt sich aber um keine<br />
geringe Zahl.<br />
16 Liese, S. 129–134.<br />
17 Ebd., S. 135.<br />
18 Ebd., S. 351.<br />
19 Beispielhaft seien hier die ersten bei<strong>de</strong>n Thesen <strong>de</strong>r sogenannten Barmer Theologischen Erklärung wie<strong>de</strong>rgegeben:<br />
»Jesus Christus, wie er uns in <strong>de</strong>r Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, <strong>de</strong>m wir<br />
im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und<br />
müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch an<strong>de</strong>re<br />
Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. […] Wie Jesus Christus<br />
Gottes Zuspruch <strong>de</strong>r Vergebung aller unserer Sün<strong>de</strong>n ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger
Andreas Schmidt: Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung 37<br />
Gegenwart und Ausblick<br />
Heute, zu Beginn <strong>de</strong>s 21. Jahrhun<strong>de</strong>rts, ist die Frage nach <strong>de</strong>m gesellschaftlichen Engagement in <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n<br />
erneut virulent. 20 Indizien dafür sind unter an<strong>de</strong>rem:<br />
– die Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen mit verschie<strong>de</strong>nen Aspekten gesellschaftsrelevanter Gemein<strong>de</strong>arbeit<br />
auf Tagungen und Konferenzen,<br />
– zahlreiche Beiträge zu gesellschaftlich relevanten Fragen in <strong>de</strong>r Zeitschrift Perspektive sowie in<br />
<strong>de</strong>n Magazinen für Jugendliche bzw. Jugendmitarbeiter komm! und christ-online Magazin,<br />
– die Gründung <strong>de</strong>s Arbeitskreises »Diakonie für Christus«,<br />
– die Beteiligung zahlreicher <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>r »Initiative Hoffnung«, einem sozialdiakonischen<br />
Themenjahr verschie<strong>de</strong>ner evangelikaler Jugendverbän<strong>de</strong> und Missionswerke.<br />
Bei dieser Entwicklung steht nicht so sehr eine direkte politische Beteiligung im Vor<strong>de</strong>rgrund, abgesehen<br />
davon, dass die Teilnahme an Wahlen selbstverständlich ist und weithin akzeptiert wird. Vielmehr<br />
beschäftigen sich <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n zunehmend mit <strong>de</strong>r Frage, wie sie neben <strong>de</strong>m geistlichen<br />
auch das materielle und emotionale Wohl <strong>de</strong>r Menschen in ihrer Umgebung suchen können. Daneben<br />
hat die Suche nach Möglichkeiten begonnen, wie unsere Gesellschaft durch lebensför<strong>de</strong>rn<strong>de</strong><br />
biblische Werte beeinflusst wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Etliche Gemein<strong>de</strong>n haben inzwischen sozialdiakonische Arbeiten begonnen; oft sind es offene<br />
Angebote für Kin<strong>de</strong>r, Jugendliche o<strong>de</strong>r Bedürftige. Manche haben Patenschaften für Menschen o<strong>de</strong>r<br />
Einrichtungen in ihrem Ort übernommen. In einzelnen Fällen fin<strong>de</strong>t auch eine Vernetzung mit an<strong>de</strong>ren<br />
lokalen Vereinen und <strong>de</strong>r kommunalen Politik statt. Geschwister wer<strong>de</strong>n ermutigt, Verantwortung<br />
in <strong>de</strong>r Elternvertretung von Kin<strong>de</strong>rtagesstätten und Schulen zu übernehmen o<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>n Ganztagsangeboten<br />
<strong>de</strong>r Bildungseinrichtungen mitzuarbeiten. Und auch wenn die Mitgliedschaft in einer<br />
Partei unter brü<strong>de</strong>rgemeindlichen Christen ein ausgesprochen seltenes Phänomen darstellt, fin<strong>de</strong>t<br />
sich hier und da parteipolitisches Engagement auf kommunaler Ebene bis hin zur Lan<strong>de</strong>spolitik.<br />
Auffällig ist dabei: Das Bemühen in diesen genannten Bereichen, das oft auch von Menschen außerhalb<br />
<strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> anerkannt wird, scheint stärker zu sein als in Bereichen, wo biblische Werte<br />
und Verhaltensweisen von <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Mehrheitsmeinung abweichen. Als Beispiele seien<br />
hier <strong>de</strong>r Schutz <strong>de</strong>s ungeborenen Lebens genannt, <strong>de</strong>r vorurteilsfreie Umgang mit Migranten o<strong>de</strong>r die<br />
Unterstützung von Eltern, die ihre Kin<strong>de</strong>r zu Hause erziehen wollen.<br />
Hinter die Erkenntnis, dass Christen sowohl »Bürger <strong>de</strong>s Himmels« als auch aktive Bürger in<br />
dieser Welt sein sollen, ist <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>m BfC hervorgegangene Teil <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung also nicht<br />
zurückgefallen. Im Gegenteil, er hat sie in <strong>de</strong>n vergangenen Jahren wie<strong>de</strong>r neu ent<strong>de</strong>ckt. Da aber auch<br />
heute <strong>de</strong>r geistesgeschichtliche Kontext ein wesentlicher Motor für diese Entwicklung zu sein<br />
Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn wi<strong>de</strong>rfährt uns frohe Befreiung aus <strong>de</strong>n gottlosen Bindungen dieser<br />
Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche<br />
unseres Lebens, in <strong>de</strong>nen wir nicht Jesus Christus, son<strong>de</strong>rn an<strong>de</strong>ren Herren zu eigen wären, Bereiche, in <strong>de</strong>nen wir<br />
nicht <strong>de</strong>r Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften« (Evangelischer Erwachsenenkatechismus, Gütersloh<br />
7 2001, o. S.). Dass die Syno<strong>de</strong> aber nur eine Min<strong>de</strong>rheit innerhalb <strong>de</strong>r protestantischen Kirchen repräsentierte, ist<br />
bekannt. Die überwiegen<strong>de</strong> Zahl ihrer Mitglie<strong>de</strong>r unterstützte das NS-Regime zunächst in gleicher Weise wie die<br />
Christen <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n.<br />
20 Neben <strong>de</strong>m Einfluss <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne (siehe Anm. 21) scheinen sich hier die allgemeine Enttraditionalisierung <strong>de</strong>r<br />
Glaubensgemeinschaften und die damit verbun<strong>de</strong>ne Lösung von überkommenen Lehrauffassungen auszuwirken.<br />
Daraus ergibt sich wie<strong>de</strong>rum die Möglichkeit und Herausfor<strong>de</strong>rung einer »ganz neuen« Lektüre und Interpretation<br />
<strong>de</strong>r Bibel. Hinzu kommt natürlich die zunehmen<strong>de</strong> Öffnung <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« gegenüber Impulsen aus <strong>de</strong>r nationalen<br />
und internationalen evangelikalen Bewegung in <strong>de</strong>n vergangenen Jahrzehnten.
Andreas Schmidt: Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung 38<br />
scheint, 21 wäre eine gründlichere biblisch-theologische Reflexion hilfreich, um das Ziel und die Art<br />
<strong>de</strong>s Engagements immer wie<strong>de</strong>r auf Jesus, <strong>de</strong>n Messias und Herrn, auszurichten.<br />
Das Erbe unserer so stark heilsgeschichtlich ausgerichteten Bewegung kann dabei helfen,<br />
– die Anbetung Gottes – zu <strong>de</strong>r alle Menschen aufgerufen sind – nicht aus <strong>de</strong>m Fokus zu verlieren,<br />
– die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s persönlichen Charakters und <strong>de</strong>r individuellen Ethik neben <strong>de</strong>m Einsatz für<br />
eine gerechtere Gesellschaft nicht zu unterschätzen,<br />
– nicht kurzsichtig je<strong>de</strong>r gesellschaftspolitischen Problemanzeige hinterherzulaufen und unsere<br />
Gestaltungsmöglichkeiten in dieser Welt nicht zu überschätzen,<br />
– die Hoffnung auf eine neue Schöpfung wachzuhalten, die Gott selbst herbeiführen wird.<br />
Zugleich muss dieses Erbe weiterentwickelt wer<strong>de</strong>n, weil<br />
– es beim Evangelium von Jesus, <strong>de</strong>m Messias, nicht nur um innere, geistlich-unsichtbare Verän<strong>de</strong>rungen<br />
geht, son<strong>de</strong>rn immer auch um sichtbare Auswirkungen, die die Umwelt verän<strong>de</strong>rn,<br />
22<br />
– die Gemein<strong>de</strong> als die neue Menschheit das wahre Menschsein in dieser Welt verkörpert, 23<br />
– Gott uns nicht in erster Linie für unser persönliches Heil erwählt hat, son<strong>de</strong>rn als seine Nachfolger,<br />
die sich wie er für seine Welt aufopfern und in ihr Heil schaffen. 24<br />
Von Gott in diese Welt gestellt, aber <strong>de</strong>m Wesen nach nicht »von dieser Welt« zu sein, diese Herausfor<strong>de</strong>rung<br />
bleibt auch in <strong>de</strong>r Gegenwart und Zukunft bestehen. Denn nach <strong>de</strong>m dunkelsten Kapitel<br />
jüdisch-christlicher Geschichte im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt wird immer <strong>de</strong>utlicher:<br />
21 Zu verweisen ist hier zum Beispiel auf postmo<strong>de</strong>rne Phänomene wie die Konzentration auf die Gegenwart, nach<strong>de</strong>m<br />
die »großen Erzählungen«, die eine Erlösung in ferner Zukunft verhießen, versagt haben, o<strong>de</strong>r die Be<strong>de</strong>utung<br />
<strong>de</strong>r Erfahrung als neuer »Königsweg« <strong>de</strong>r Erkenntnis.<br />
22 Siehe Mt 7,21; Röm 8,1–5, Phim u. a.<br />
23 Jak 1,18.<br />
Das Volk Gottes kann nicht aus <strong>de</strong>r Welt fliehen.<br />
Und das Volk Gottes darf auch nicht aus <strong>de</strong>r Welt fliehen.<br />
Das Volk Gottes kann nicht in <strong>de</strong>r Welt aufgehen.<br />
Und das Volk Gottes darf auch nicht in <strong>de</strong>r Welt aufgehen.<br />
24 Siehe 1Mo 12,1–3; 2Kor 5,15; Eph 2,10; Tit 3,8 u.a. In <strong>de</strong>r Theologie spricht man von »Solidarität mit <strong>de</strong>r Welt«, ein<br />
treffen<strong>de</strong>r, aber zugleich auch missverständlicher Begriff.
Jurek Karzelek<br />
Einflüsse <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« auf Osteuropa<br />
vor und nach 1937<br />
1. Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung hatte von Anfang an ein sehr großes Interesse an Mission. Beson<strong>de</strong>rs von<br />
<strong>de</strong>n englischen »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n«, bei <strong>de</strong>nen unsere Bewegung ihren Anfang nahm, sind sehr<br />
viele Missionare ausgegangen – bis nach Irak und Indien o<strong>de</strong>r bis Australien und Amerika.<br />
2. Dieses Interesse an Mission ist auch bei <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« zu sehen. Deutsche Missionare<br />
arbeiteten Anfang <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts unter an<strong>de</strong>rem im Osten Russlands bis hin nach Sibirien<br />
und Turkestan. Sie waren auch bis nach China und Zentralafrika tätig.<br />
3. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts gab es im Sü<strong>de</strong>n Russlands unter <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Kolonisten und<br />
im Nor<strong>de</strong>n unter <strong>de</strong>r russischen Aristokratie Erweckungen. Die Arbeit unter <strong>de</strong>n Erweckten wur<strong>de</strong><br />
von englischen und <strong>de</strong>utschen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« unterstützt. Auch in einigen Teilen Österreich-<br />
Ungarns, also »vor <strong>de</strong>r Haustür«, arbeiteten <strong>de</strong>utsche »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« als Missionare.<br />
4. Um die Arbeit zu verstärken, kam <strong>de</strong>r Gedanke auf, eine Missions-Bibelschule zu grün<strong>de</strong>n. Nach<br />
vielen Überlegungen entstand so 1905 die »Allianz-Bibelschule« in Berlin (es war nicht möglich,<br />
eine solche Schule in Russland o<strong>de</strong>r Österreich-Ungarn zu grün<strong>de</strong>n). Von Anfang an studierten<br />
dort viele <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> aus Osteuropa. Dazu gehörten u. a. Franz Kresina, <strong>de</strong>r später als Missionar bei<br />
<strong>de</strong>n Tschechen arbeitete, und 1907–09 Josef Mrozek, <strong>de</strong>r nach Polen ging. Vor <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg<br />
arbeitete er im österreichischen Schlesien, danach zog er in die polnische Stadt Chorzow<br />
(Königshütte) um.<br />
5. Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>, die die Bibelschule in Berlin und später in Wie<strong>de</strong>nest absolviert hatten, wur<strong>de</strong>n auch<br />
weiterhin von ihren Lehrern beraten. So erhielt z.B. Josef Mrozek die Empfehlung, von Trzanowice<br />
nach Bogumin zu ziehen, einer Stadt mit guter Eisenbahnverbindung, wo er eine neue Arbeit<br />
anfing. Sein Dienst und <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rer Schüler <strong>de</strong>r Bibelschule wur<strong>de</strong> von Johannes Warns und<br />
an<strong>de</strong>ren erfahrenen Mitarbeitern begleitet.<br />
6. Diese Begleitung wur<strong>de</strong> auch nach <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg und <strong>de</strong>m Umzug von Jozef Mrozek nach<br />
Chorzow (Königshütte) fortgesetzt, wie die Korrespon<strong>de</strong>nz mit <strong>de</strong>r Redaktion <strong>de</strong>r Offenen Türen<br />
<strong>de</strong>utlich zeigt. Josef Mrozek pflegte auch Kontakt zu <strong>de</strong>utschen Gemein<strong>de</strong>n und besuchte Konferenzen<br />
in Deutschland.<br />
7. Nach <strong>de</strong>m Zusammenschluss <strong>de</strong>r »Offenen« und »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« 1937 brach bald <strong>de</strong>r<br />
Zweite Weltkrieg aus. Auch im Krieg hielten die <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> Kontakt zu Jozef Mrozek.<br />
Während <strong>de</strong>s Krieges besuchte Erich Sauer die Gemein<strong>de</strong> in Chorzow. Möglicherweise kamen<br />
auch an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>utsche <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> zu Besuch in polnische Gemein<strong>de</strong>n, aber auf unserer Seite ist kein<br />
Wissen darüber erhalten.<br />
8. Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong>n Deutschland und Europa in zwei Lager geteilt. Kontakte <strong>de</strong>r<br />
west<strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> zum Osten wur<strong>de</strong>n schwieriger, da die Kirchen und Gemein<strong>de</strong>n im Ostblock<br />
unterdrückt und in ihren Möglichkeiten begrenzt wur<strong>de</strong>n und ständigen Bespitzelungen<br />
ausgesetzt waren. Die Verbindungen zwischen <strong>de</strong>r BRD und Osteuropa waren daher in <strong>de</strong>n Jahren<br />
1945–1970 sehr eingeschränkt. In dieser Zeit pflegten beson<strong>de</strong>rs <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> aus England die Kontakte<br />
zu <strong>de</strong>n osteuropäischen Gläubigen, darunter James Lees, Bill Grumbaum und Martin Baker.<br />
9. In <strong>de</strong>n 70er Jahren bekamen wir über die Leipziger Rüstwoche neue Verbindungen zu <strong>de</strong>n west<strong>de</strong>utschen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n. Bekanntlich konnten Bürger aus Oststaaten leichter in die DDR fahren als in
Jurek Karzelek: Einflüsse <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« auf Osteuropa 40<br />
die BRD. So bot die Leipziger Rüstwoche auch die Möglichkeit zum Kontakt zwischen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n <strong>de</strong>r<br />
bei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Staaten und mit <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n aus Ostlän<strong>de</strong>rn wie Polen, Rumänien, <strong>de</strong>r Tschechoslowakei<br />
und Ungarn. Auch auf <strong>de</strong>r Berliner Glaubenskonferenz konnten Treffen zwischen West<br />
und Ost statt<strong>fin<strong>de</strong>n</strong>. <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> aus <strong>de</strong>r DDR besuchten dann die Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Ostblocks; so Karl-Heinz<br />
Vanhei<strong>de</strong>n, Frie<strong>de</strong>r Sei<strong>de</strong>l, Wilfried Böttger und an<strong>de</strong>re mehr.<br />
10. Ab Anfang <strong>de</strong>r 70er Jahre war es <strong>de</strong>n west<strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n auch wie<strong>de</strong>r möglich, ohne großes<br />
Aufsehen – meistens als Touristen – Besuche in <strong>de</strong>n Ostblocklän<strong>de</strong>rn zu machen. Von vielen<br />
Namen erwähne ich hier beson<strong>de</strong>rs Siegfried Reh, Karl Thewes und Karl Beyer.<br />
11. Nach <strong>de</strong>r Verhängung <strong>de</strong>s Kriegsrechts in Polen 1981 engagierten sich die west<strong>de</strong>utschen Gemein<strong>de</strong>n<br />
sehr, um <strong>de</strong>n polnischen Gemein<strong>de</strong>n zu helfen. Sowohl die Gemein<strong>de</strong>n im BEFG als auch<br />
Freie <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n beteiligten sich stark an <strong>de</strong>r humanitären Hilfe. Nicht zu vergessen sind<br />
hier auch die Gläubigen <strong>de</strong>r DDR, die nicht nur Pakete mit Lebensmitteln nach Polen schickten,<br />
son<strong>de</strong>rn auch für Rumänien große Hilfeleistungen erbrachten. Die Gemein<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Ostlän<strong>de</strong>rn<br />
wur<strong>de</strong>n von Deutschland aus sowohl geistlich durch Gemein<strong>de</strong>besuche und Schriften als auch<br />
durch Hilfe mit Lebensmitteln und Material und beim Kauf und Ausbau von Gemein<strong>de</strong>häusern<br />
unterstützt.<br />
12. Was ich hier schreibe, ist stark von <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Kontakte nach Polen bestimmt, da ich dort<br />
Erfahrungen habe. Ich weiß jedoch, dass sich die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Gemein<strong>de</strong>n durch die neu<br />
entstehen<strong>de</strong>n Möglichkeiten <strong>de</strong>r 70er Jahre sehr stark für die Unterstützung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n in<br />
ganz Osteuropa engagierten.<br />
13. Die polnischen Gemein<strong>de</strong>n sind an<strong>de</strong>rs organisiert als die <strong>de</strong>utschen, und sie arbeiten an<strong>de</strong>rs. Ich<br />
möchte beson<strong>de</strong>rs würdigen, dass die <strong>de</strong>utsche Hilfe nie mit <strong>de</strong>r Erwartung verbun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>,<br />
dass wir in Polen die Art und Weise unserer Arbeit än<strong>de</strong>rn.<br />
14. Ich freue mich, mit euch diese Konferenz zu erleben. Ich glaube, Gott hat die Entscheidung eurer<br />
Väter im Jahre 1937 gesegnet, und damit wur<strong>de</strong>n auch Gemein<strong>de</strong>n in Osteuropa mitgesegnet. Die<br />
<strong>de</strong>utschen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« haben die Arbeit in Osteuropa vor und nach 1937 sehr unterstützt.
Ralf Kaemper<br />
Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung<br />
in <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung<br />
1. Einleitung<br />
1.1. Die Grundspannung<br />
»Einheit und Abson<strong>de</strong>rung« ist die Spannung, die das Wesen <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in beson<strong>de</strong>rer<br />
Weise von Anfang an geprägt hat – bis heute. Lei<strong>de</strong>r muss man feststellen, dass diese Spannung häufig<br />
zugunsten <strong>de</strong>r Abson<strong>de</strong>rung aufgelöst wur<strong>de</strong>. Es ist auffällig, dass eine Bewegung, die im Zeichen<br />
<strong>de</strong>r Einheit antrat, im Laufe ihrer Geschichte sehr viele Spaltungen erlebt hat. Es gibt eine erschrecken<strong>de</strong><br />
Zersplitterung <strong>de</strong>r weltweiten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung.<br />
1.2. Urimpuls Einheit<br />
Der Urimpuls, <strong>de</strong>r zum Entstehen <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung führte, liegt klar auf <strong>de</strong>r Einheit. Erich Geldbach<br />
spricht vom »revolutionären Geist« <strong>de</strong>r Väter, die sich einfach als Christen versammelten und<br />
das Brot miteinan<strong>de</strong>r brachen, unabhängig vom kirchlichen Hintergrund <strong>de</strong>r Einzelnen. 1 Der Gründungsimpuls<br />
<strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung ist ein<strong>de</strong>utig die Einheit. Ohne diesen Gedanken hätte es keine<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung gegeben.<br />
1.3. Spaltungen<br />
Sehr bald sollte aber die Frage, wie weit die Einheit geht – und wen sie impliziert –, beherrschend<br />
wer<strong>de</strong>n. Zentrales Thema war dann nicht mehr Einheit, son<strong>de</strong>rn Abson<strong>de</strong>rung – in <strong>de</strong>r paradoxen<br />
Formulierung »Einheit durch Trennung«. Gerhard Jordy schreibt, dass <strong>de</strong>r »Grundsatz <strong>de</strong>r Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>, mit allen wahren Kin<strong>de</strong>rn Gottes am Tisch <strong>de</strong>s Herrn Gemeinschaft haben zu wollen, <strong>de</strong>m<br />
Uranliegen <strong>de</strong>r ›<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>‹ besser gerecht [wur<strong>de</strong>] als Darby, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Prinzip ›Einheit durch Trennung‹<br />
dieses Uranliegen zu To<strong>de</strong> ritt«. 2 Über die Trennung von Darby und Müller aufgrund <strong>de</strong>r unterschiedlichen<br />
Gemein<strong>de</strong>verständnisse schreibt Hartwig Schnurr:<br />
»Es ist eine Tragik, daß gera<strong>de</strong> an diesem Punkt die Spaltung <strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>kreis heimgesucht hat!<br />
Man war angetreten in <strong>de</strong>r Suche nach <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>s Leibes mit allen wahren Gläubigen, hatte<br />
aber im eigenen Kreis schon bald eine tiefe Spaltung verursacht. Daß man nicht einmal wahrnahm,<br />
daß eine eigene, neue Konfession entstan<strong>de</strong>n war – <strong>de</strong>nn das war ja gera<strong>de</strong> das Übel, das man überwin<strong>de</strong>n<br />
wollte –, machte die Tragik nur noch größer.« 3<br />
Was hätte alles möglich sein können, wenn es diese Spaltungsten<strong>de</strong>nz in <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung nicht<br />
gegeben, son<strong>de</strong>rn das »Uranliegen« <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> sich durchgesetzt hätte …<br />
1 Erich Geldbach: Christliche Versammlung und Heilsgeschichte bei John Nelson Darby, Wuppertal 3 1975, S. 16 (auch online<br />
unter www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/geldbach.pdf).<br />
2 Gerhard Jordy: »Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung – Gedanken zur Geschichte …«, in: Perspektive 8 (2008), Heft 10, S. 24–27,<br />
hier 25 (auch online unter www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/jordygedanken.pdf).<br />
3 Hartwig Schnurr: »Die Einheit <strong>de</strong>s Leibes Christi und die Konfessionsfrage in <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung«,<br />
in: Theologisches Gespräch 25 (2001), Beiheft 2, S. 33–39, hier 35 (auch online unter www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/<br />
schnurr.pdf).
Ralf Kaemper: Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung 42<br />
2. Themen und Inhalte um Einheit und Abson<strong>de</strong>rung<br />
Wenn man die Spannung von Einheit und Abson<strong>de</strong>rung in <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>geschichte untersucht, fallen<br />
drei Inhalte beson<strong>de</strong>rs ins Gewicht. Das sind<br />
1. das Kirchen- o<strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>verständnis,<br />
2. die Lehre <strong>de</strong>r Abson<strong>de</strong>rung und<br />
3. die Theologie um <strong>de</strong>n »Tisch <strong>de</strong>s Herrn«.<br />
2.1. Das Kirchen- und Gemein<strong>de</strong>verständnis<br />
Hier <strong>fin<strong>de</strong>n</strong> wir das Paradoxon, das die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung am Anfang geprägt hat. Man wollte keine<br />
Kirche o<strong>de</strong>r Konfession sein, man wollte sich einfach nur als Geschwister versammeln, das Abendmahl<br />
miteinan<strong>de</strong>r feiern, die Bibel betrachten, miteinan<strong>de</strong>r beten. Und doch entstand dabei eine<br />
Gruppe innerhalb <strong>de</strong>s Christentums, die sich wie<strong>de</strong>rum zum Ganzen <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Jesu verhalten<br />
musste. Eine Gruppe, eine Gemein<strong>de</strong>richtung, die keine sein wollte – das klingt schon fast wie<strong>de</strong>r<br />
mo<strong>de</strong>rn, besser postmo<strong>de</strong>rn (siehe die Emerging-Church-Bewegung, die ja auch <strong>de</strong>n Konfessionalismus<br />
überwin<strong>de</strong>n will).<br />
Ulrich Müller spricht in seinem Aufsatz über <strong>de</strong>n sog. »Schriftenstreit« zwischen <strong>de</strong>n Freien evangelischen<br />
Gemein<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung« von einem »kommunikative[n] Grundproblem«,<br />
nämlich: »Das Selbstverständnis <strong>de</strong>r ›Versammlung‹, keine ›Partei‹, also keine Gemein<strong>de</strong><br />
o<strong>de</strong>r Kirche zu sein, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Versuch, außerhalb aller ›Zäune‹ […] ›die von Gott gemachte Einheit<br />
[aller Gläubigen] zu verwirklichen und […] äußerlich zur Darstellung zu bringen‹«. 4 Müller zitiert<br />
Gustav Nagel:<br />
»Auch wenn die ›Versammlung‹ ›alle an<strong>de</strong>ren religiösen Versammlungen und Gemeinschaften<br />
rücksichtslos als »menschliche Systeme«‹ ablehne, sei sie ›selbst durch ihre ganze Art zu einem<br />
System gewor<strong>de</strong>n, wie es so kein zweites mehr gibt‹ […], <strong>de</strong>nn ›die Darbysche Literatur setzt ihr<br />
Lehrsystem, gera<strong>de</strong> wie <strong>de</strong>r Katholizismus, <strong>de</strong>m Gesamtgehalt <strong>de</strong>s Willens und <strong>de</strong>r Wahrheit Gottes<br />
völlig gleich‹«. 5<br />
Da es keine formlose Existenz gibt und man sich über bestimmte Fragen einigen muss, wenn mehrere<br />
Personen <strong>zusammen</strong>kommen, wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung dann sehr schnell eine Gemein<strong>de</strong>richtung<br />
– mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein.<br />
Dabei ging es immer wie<strong>de</strong>r um das Verhältnis einer Ortsgemein<strong>de</strong> (o<strong>de</strong>r örtlichen Gruppe, die<br />
sich am »Tisch <strong>de</strong>s Herrn« versammelte) zum überregionalen Gemein<strong>de</strong>ganzen. Das wur<strong>de</strong> beson<strong>de</strong>rs<br />
dann wichtig, wenn Ausschlüsse vorgenommen wur<strong>de</strong>n. Damit war die Frage gestellt: Sind die<br />
Entscheidungen einer Ortsgruppe bin<strong>de</strong>nd für das Gemein<strong>de</strong>ganze <strong>de</strong>r »Versammlungen«? Müssen<br />
sich also alle Gemein<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>m Ausgeschlossenen trennen, wenn eine Ortsgemein<strong>de</strong> ein Mitglied<br />
ausschließt? Daran hing auch die Frage, wie man mit <strong>de</strong>nen umzugehen hatte, die noch Gemeinschaft<br />
mit <strong>de</strong>m Ausgeschlossenen hielten. Wenn es zu Ausschlüssen kam, durfte dies dann von an<strong>de</strong>ren<br />
Versammlungen geprüft o<strong>de</strong>r musste es zwingend übernommen wer<strong>de</strong>n?<br />
Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« haben sich einer verbindlichen Anerkennung solcher Beschlüsse wi<strong>de</strong>rsetzt.<br />
So heißt es im »Brief <strong>de</strong>r Zehn« von Henry Craik, Georg Müller und an<strong>de</strong>ren: »Wir <strong>de</strong>nken<br />
nicht, dass wir als Gemeinschaft verpflichtet sind, Irrtümer zu untersuchen, nur weil sie in Plymouth<br />
o<strong>de</strong>r sonstwo gelehrt wer<strong>de</strong>n mögen.« 6 Man befürchtete, dass das Ergebnis weitere »ver<strong>de</strong>rbliche<br />
Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen und Wortgefechte sein« wür<strong>de</strong>n »von <strong>de</strong>r Art, die mehr Streitfragen hervor-<br />
4 Ulrich Müller: Der »Schriftenstreit« zwischen <strong>de</strong>n Freien evangelischen Gemein<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r »Christlichen Versammlung«<br />
(2007), www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/muellerschriftenstreit.pdf, S. 9 (Zitate aus Bernhard Koch: Als Manuskript<br />
gedruckter Brief an <strong>de</strong>n Verfasser <strong>de</strong>r Schrift: »Die Zerrissenheit <strong>de</strong>s Gottesvolkes in <strong>de</strong>r Gegenwart«, o. O. 1913).<br />
5 Müller, S. 8 (Zitate aus Gustav Nagel: Die Zerrissenheit <strong>de</strong>s Gottesvolkes in <strong>de</strong>r Gegenwart, Witten o. J. [1913]).<br />
6 Der »Brief <strong>de</strong>r Zehn« (1848), www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/brief<strong>de</strong>rzehn.pdf, S. 4, Pkt. 1.
Ralf Kaemper: Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung 43<br />
bringt als die göttliche Auferbauung för<strong>de</strong>rt«. 7 Die For<strong>de</strong>rung, die Irrlehren zu prüfen, erschien manchen<br />
von ihnen »wie die Einführung eines neuen Prüfsteins für die Gemeinschaft«. 8<br />
Das Kernanliegen <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« war klar die Einheit, wie sie in Punkt 8 <strong>de</strong>s »Briefs <strong>de</strong>r<br />
Zehn« <strong>de</strong>utlich formulieren: »Gleichzeitig möchten wir ein<strong>de</strong>utig klarstellen, dass wir die Gemeinschaft<br />
mit allen Gläubigen aufrechtzuerhalten suchen und uns beson<strong>de</strong>rs mit <strong>de</strong>nen verbun<strong>de</strong>n fühlen,<br />
die sich wie wir einfach im Namen <strong>de</strong>s Herrn Jesus versammeln.« 9 Man sah, dass die Themen<br />
»Prüfung – Trennung – Abson<strong>de</strong>rung« zentral wer<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>n, »sodass unsere ganze Zeit mit <strong>de</strong>r<br />
Prüfung von Irrtümern an<strong>de</strong>rer Leute vergeu<strong>de</strong>t wird, anstatt dass wir uns wichtigerem Dienst widmen«.<br />
10<br />
Jordy schreibt, dass sich Carl Brockhaus <strong>de</strong>n »Ausschließlichkeitscharakter <strong>de</strong>r Lehre Darbys« zu<br />
Eigen machte. Dies führte dazu, dass sich die Wege zwischen ihm und Hermann Heinrich Grafe im<br />
Evangelischen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>verein trennten. 11 Im Hintergrund steht die Frage nach <strong>de</strong>m Kirchen- und Gemein<strong>de</strong>verständnis.<br />
Für Brockhaus war <strong>de</strong>r Gedanke über »Christum und die Versammlung« »die<br />
Mitte <strong>de</strong>s gesamten Christenlebens«, wie Jordy feststellt. 12<br />
Rudolf Brockhaus schrieb 1913 in Die Einheit <strong>de</strong>s Leibes Christi: »Entwe<strong>de</strong>r sind wir <strong>de</strong>r ›Leib Christi‹<br />
und ›Glie<strong>de</strong>r voneinan<strong>de</strong>r‹ und geben diesem Verhältnis schriftgemäßen Ausdruck, o<strong>de</strong>r wir bil<strong>de</strong>n<br />
selbständige, unabhängige Körperschaften und sind dann Glie<strong>de</strong>r dieser Körperschaften. Bei<strong>de</strong>s miteinan<strong>de</strong>r<br />
zu vereinigen ist unmöglich. Das eine schließt das an<strong>de</strong>re aus.« 13 Jordy kommentiert: »Im<br />
Grun<strong>de</strong> konnte man sich über die Wahrheit o<strong>de</strong>r Unwahrheit dieses letzten Satzes nicht einigen, ob<br />
<strong>de</strong>nn nun wirklich das eine das an<strong>de</strong>re ausschließen müsse, und damit war <strong>de</strong>r unüberbrückbare<br />
Graben zwischen <strong>de</strong>n ›<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n‹ und <strong>de</strong>n Freien evangelischen Gemein<strong>de</strong>n gekennzeichnet«. 14<br />
Im Hintergrund geht es immer um das Kirchenverständnis. Jordy beschreibt <strong>de</strong>n Unterschied<br />
zwischen <strong>de</strong>r Sicht Darbys und <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« so, dass Darby von einer »äußerlichen<br />
Einheit <strong>de</strong>r Kirche Christi« ausging, »nach <strong>de</strong>r je<strong>de</strong> Gemein<strong>de</strong> für je<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re und <strong>de</strong>ren einzelne<br />
Glie<strong>de</strong>r verantwortlich war, statt die Verantwortung in weiser Selbstbeschränkung <strong>de</strong>n jeweiligen<br />
Ortsgemein<strong>de</strong>n zu überlassen, wie es die Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> für richtig hielten«. 15<br />
Johannes Warns stellte 1936 in seiner Studie Georg Müller und John Nelson Darby klar, dass gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Kirchenbegriff einen Kernunterschied zwischen Darby und <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« ausmachte.<br />
Warns fasst ihn so <strong>zusammen</strong>: »Um es vorweg kurz und bündig zu sagen, worum es sich in diesem<br />
bedauernswerten Kampf mit seinen unseligen Folgen han<strong>de</strong>lte, sei <strong>de</strong>n nachfolgen<strong>de</strong>n Ausführungen<br />
gleichsam als These die Behauptung vorangestellt, daß es sich um <strong>de</strong>n Gegensatz zwischen <strong>de</strong>m evangelischen<br />
und <strong>de</strong>m katholischen Gemein<strong>de</strong>i<strong>de</strong>al han<strong>de</strong>lte«. 16 Darbys Kircheni<strong>de</strong>al sei »ein Erbstück aus <strong>de</strong>r<br />
englischen Staatskirche« gewesen. Dies sei »ein Beweis <strong>de</strong>r Geringschätzung aller protestantischen<br />
freikirchlichen und kirchenfreien Gruppen, wie sie ein hochkirchlicher Kleriker zu haben pflegt.<br />
7 Ebd., Pkt. 4.<br />
8 Ebd., Pkt. 7.<br />
9 Ebd., S. 5, Pkt. 8.<br />
10 Ebd., Pkt. 9.<br />
11 Gerhard Jordy: Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in Deutschland, Band 2: 1900–1937, Wuppertal 1981, S. 60.<br />
12 Ebd., S. 62.<br />
13 Rudolf Brockhaus: Die Einheit <strong>de</strong>s Leibes Christi. Ein Wort in Erwi<strong>de</strong>rung auf die Schrift von G. Nagel: »Die Zerrissenheit <strong>de</strong>s<br />
Gottesvolkes in <strong>de</strong>r Gegenwart«, Elberfeld 1913, S. 16 (auch online unter www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/brockhauseinheit.pdf).<br />
14 Jordy, Bd. 2, S. 65.<br />
15 Ebd., S. 154.<br />
16 Johannes Warns: Georg Müller und John Nelson Darby. Ein Rückblick auf <strong>de</strong>n sogenannten Bethesdastreit zu Bristol im Jahre<br />
1848, Wie<strong>de</strong>nest 1936, S. 17 (auch online unter www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/warns.pdf).
Ralf Kaemper: Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung 44<br />
Darby hat selbst bekannt, für die Reformationskirchen sich nie erwärmt gefühlt zu haben, wohl aber<br />
für die katholische Kirche Roms«. 17<br />
Warns vertritt <strong>de</strong>mgegenüber klar die Position <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, die die Selbständigkeit <strong>de</strong>r<br />
Ortsgemein<strong>de</strong> impliziert:<br />
»Wie je<strong>de</strong>r einzelne auf sich selbst zu sehen hat und sich selbst zu prüfen hat, so hat auch je<strong>de</strong><br />
Einzelgemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>n hohen Beruf und die Pflicht, ihr eigenes Haus in Ordnung zu halten und inmitten<br />
eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes zu leuchten. Solche Gemein<strong>de</strong>n sind dann<br />
durch das allerfesteste Band miteinan<strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>n, durch <strong>de</strong>n heiligen Geist. Dies Band kann<br />
durch die Fehler einzelner und gelegentliche Fehlgriffe nicht zerrissen wer<strong>de</strong>n. Es muß auch nicht<br />
durch menschliche Führer und durch eine künstlich herbeigeführte und oft gar nicht wirklich<br />
vorhan<strong>de</strong>ne Übereinstimmung in allen Lehrpunkten und durch eine schematische Anerkennung<br />
<strong>de</strong>r Beschlüsse einzelner Versammlungen vor <strong>de</strong>m Zerreißen bewahrt wer<strong>de</strong>n.« 18<br />
2.2. Die Lehre von <strong>de</strong>r Abson<strong>de</strong>rung<br />
Die Lehre von <strong>de</strong>r »Abson<strong>de</strong>rung vom Bösen« ist ein zentraler Punkt im Lehrgebäu<strong>de</strong> eines Teils <strong>de</strong>r<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung. Jordy schreibt, »daß die Lehre von <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>r Kirche durch Abson<strong>de</strong>rung<br />
gera<strong>de</strong> das Spezifische <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung damals war und es für einen Teil von ihr bis<br />
heute ist«. 19 Für Darby sei <strong>de</strong>r »einzig gangbare Weg <strong>de</strong>r wahren Gläubigen die absolute Trennung<br />
von allen religiösen ›Systemen‹« gewesen. Die etablierten Kirchen wur<strong>de</strong>n für ihn »zum Bösen<br />
schlechthin«. »So wur<strong>de</strong> für Darby die Trennung vom Bösen gera<strong>de</strong>zu zum göttlichen Prinzip <strong>de</strong>r<br />
Einheit <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r Gottes«. 20 »Seine Lehre, die man von nun an als Darbysmus bezeichnen kann, fiel<br />
in ihrem Absolutheitsanspruch und ihrer bedingungslosen Anwendung <strong>de</strong>m ursprünglichen Ziel <strong>de</strong>r<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in <strong>de</strong>n Rücken«, schreibt Jordy. 21<br />
Für <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Bereich gibt <strong>de</strong>r Briefwechsel zwischen Georg von Viebahn und Rudolf Brockhaus<br />
einen guten Einblick. Viebahn schrieb 1905 an Brockhaus:<br />
»Schon seit Jahren habe ich wie<strong>de</strong>rholt ausgesprochen, daß ich die Wahrheiten anerkenne, welche<br />
<strong>de</strong>r Versammlung anvertraut sind, aber ich habe niemals <strong>de</strong>m Satze zugestimmt: ›Wir haben die<br />
Wahrheit‹ […]. Die traurigen Folgen solcher Meinungen können nicht ausbleiben: Überhebung<br />
an<strong>de</strong>rn Gläubigen gegenüber, Blindheit für die Gna<strong>de</strong>ngaben, welche Gott an<strong>de</strong>ren gibt, <strong>de</strong>r Geist<br />
<strong>de</strong>r Kritik, <strong>de</strong>r an an<strong>de</strong>ren nur die Mängel sucht und fin<strong>de</strong>t. Die Ecclesia, welche Pfeiler und Grundfeste<br />
<strong>de</strong>r Wahrheit ist, besteht nicht aus <strong>de</strong>m kleinen Kreis <strong>de</strong>r Geschwister, die mit uns in Gemeinschaft<br />
am Tische <strong>de</strong>s Herrn sind, son<strong>de</strong>rn aus allen Gläubigen. Die Wahrheit, welche wir<br />
besitzen, besteht nicht in einer Lehre, son<strong>de</strong>rn einerseits in einer Person, in Jesu, welcher bezeugt:<br />
›Ich bin die Wahrheit‹ (Joh. 14,6).« 22<br />
Viebahn spricht von <strong>de</strong>r »schweren Krankheit« <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«:<br />
»Wenn die Geschwister, die auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Versammlung stehen, Herz und Arme öffnen für<br />
alle Kin<strong>de</strong>r Gottes, die auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r ganzen Bibel stehen, so wird die Versammlung selbst<br />
von ihrer schweren Krankheit genesen […]. Diese schwere Krankheit erkenne ich in <strong>de</strong>m, was ich<br />
17 Ebd., S. 18.<br />
18 Ebd., S. 28.<br />
19 Jordy, Bd. 2, S. 67.<br />
20 Gerhard Jordy: Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung in Deutschland, Band 1: Das 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt: Englische Ursprünge und Entwicklung in<br />
Deutschland, Wuppertal 2 1989, S. 31.<br />
21 Ebd., S. 34.<br />
22 Georg von Viebahn: Brief an Rudolf Brockhaus, 14. Dezember 1905, in: Die Botschaft 92 (1951), S. 114–120, hier 115<br />
(auch online unter www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/viebahnbrockhaus.pdf).
Ralf Kaemper: Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung 45<br />
in <strong>de</strong>r Konferenz zu Elberfeld ›römisch‹ nannte, d. h. in <strong>de</strong>m Grundsatz, daß die in sich abgeschlossene<br />
Versammlung wichtiger sei als die persönliche Herzenshingabe an <strong>de</strong>n Herrn.« 23<br />
Brockhaus antwortete Viebahn: »Gottes Wort gebietet uns, die Tür zu schließen wi<strong>de</strong>r alle bösen<br />
Lehren und keine Gemeinschaft zu haben mit <strong>de</strong>nen, die sie bringen«. 24 Die spannen<strong>de</strong> Frage ist<br />
natürlich: Was sind »böse Lehren« – wo fängt Irrlehre an? Schon bei einer an<strong>de</strong>ren Interpretation<br />
biblischer Aussagen?<br />
Jordy schreibt <strong>zusammen</strong>fassend: »An <strong>de</strong>m ›Fall‹ Viebahn wird <strong>de</strong>utlich, wie schwierig das Verhältnis<br />
<strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> zwischen <strong>de</strong>m Auftrag ihrer geschichtlichen Herkunft und <strong>de</strong>r Hypothek einer zum<br />
Dogma erstarrten Lehrmeinung in <strong>de</strong>r Ära von Rudolf Brockhaus gewor<strong>de</strong>n war«. Auch wenn man im<br />
Einzelfall bereit war, »<strong>de</strong>r Bru<strong>de</strong>rliebe freien Raum zu lassen, um so kompromißloser war man in <strong>de</strong>r<br />
Bewahrung <strong>de</strong>s Lehrstandpunktes«. 25<br />
2.3. Das Verständnis vom »Tisch <strong>de</strong>s Herrn«<br />
Ein wichtiger inhaltlicher Punkt in <strong>de</strong>r Frage nach Einheit und Abson<strong>de</strong>rung ist eine bestimmte Lehrbildung<br />
bei <strong>de</strong>n »Elberfel<strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« um <strong>de</strong>n Ausdruck »Tisch <strong>de</strong>s Herrn«. Dabei geht es auf <strong>de</strong>r<br />
einen Seite um eine Gleichsetzung <strong>de</strong>r Begriffe »Abendmahl« und »Tisch <strong>de</strong>s Herrn« (1Kor 10,21), auf<br />
<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite zugleich um eine Unterscheidung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Ausdrücke. »Abendmahl« stehe für<br />
die individuelle Seite, »Tisch <strong>de</strong>s Herrn« für die kollektive. Beim »Abendmahl« gehe es um die persönliche<br />
Herzenshaltung <strong>de</strong>s einzelnen Christen, daher könne es von allen Gläubigen gefeiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Der »Tisch <strong>de</strong>s Herrn aber erfor<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n Gehorsam, nicht ›die heilige Sache mit unheiligen Dingen<br />
in Verbindung zu bringen‹, an diesem Tisch könne man daher nur außerhalb <strong>de</strong>r ›Systeme‹ sitzen.« 26<br />
In dieser Frage gab es ausführliche theologisch-exegetische Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen mit »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« (Ferdinand Braselmann, Christian Schatz, Albert von <strong>de</strong>r Kammer). Stellvertretend sei hier<br />
von <strong>de</strong>r Kammer zitiert, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>n Zusammenhang von 1Kor 10,21 hinweist. Dieser zeige, »daß es<br />
sich in dieser Stelle nicht um Belehrungen über <strong>de</strong>s Herrn Abendmahl, son<strong>de</strong>rn um Belehrungen über<br />
<strong>de</strong>n Götzendienst han<strong>de</strong>lt«. 27<br />
Dass dieser problematischen Auslegung eine entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Zentralität zugewiesen wur<strong>de</strong>, sodass<br />
sie fast zum Kernstück <strong>de</strong>r »Versammlung« wur<strong>de</strong>, gibt <strong>de</strong>m Ganzen eine beson<strong>de</strong>re Dramatik. So<br />
schreibt Rudolf Brockhaus in Die Versammlung <strong>de</strong>s lebendigen Gottes:<br />
»ist und bleibt doch <strong>de</strong>r einzige Platz, die einzige Gelegenheit, wo <strong>de</strong>r Einheit (nicht Einigkeit o<strong>de</strong>r<br />
Einmütigkeit) Ausdruck gegeben wer<strong>de</strong>n kann, <strong>de</strong>r Tisch <strong>de</strong>s Herrn. Nur hier fin<strong>de</strong>t sie in <strong>de</strong>m einen<br />
Brote, von welchem alle essen, eine sichtbare, sinnfällige Darstellung. Daß sich an die Feier <strong>de</strong>s<br />
Abendmahls an<strong>de</strong>re Zusammenkünfte <strong>de</strong>r Versammlung schließen, ist selbstverständlich, aber sie<br />
bil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Mittelpunkt, die Grundlage von allem.« 28<br />
23 Ebd., S. 116.<br />
24 Rudolf Brockhaus: Antwort an Georg von Viebahn, 15. Januar 1906, www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/viebahnbrockhaus.pdf,<br />
S. 4.<br />
25 Jordy, Bd. 2, S. 77.<br />
26 Ebd., S. 78.<br />
27 Albert von <strong>de</strong>r Kammer: Der Unterschied zwischen »Tisch« und »Mahl« <strong>de</strong>s HErrn. Eine Betrachtung über 1. Kor. 8–10 (11),<br />
Klotzsche o. J., S. 6 (auch online unter www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/kammerunterschied.pdf).<br />
28 Rudolf Brockhaus: Die Versammlung <strong>de</strong>s lebendigen Gottes, Elberfeld 1912, S. 47 (auch online unter www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/brockhausversammlung.pdf).
Ralf Kaemper: Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung 46<br />
Nach Braselmann besteht das Problem darin, »Grundsätze, die von gewiß treuen Männern durch<br />
Schlußfolgerungen aufgestellt wor<strong>de</strong>n sind, als ›göttliche‹ auszugeben«. 29 Es geht also um die Frage <strong>de</strong>r<br />
richtigen Interpretation biblischer Aussagen. Es geht um Schlussfolgerungen.<br />
Rudolf Brockhaus schrieb 1927 in einem Brief an Heinz Köhler:<br />
»Eine Verständigung ist auch nicht möglich, solange <strong>de</strong>r ernste Gegensatz zwischen Ihrer und<br />
unserer Auffassung über <strong>de</strong>n ›Tisch <strong>de</strong>s Herrn‹ bestehen bleibt. Wir glauben auf Grund <strong>de</strong>r Belehrung<br />
<strong>de</strong>s Apostels in 1. Kor. 10, dass bei <strong>de</strong>r Feier <strong>de</strong>s Abendmahles <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>s Leibes Ausdruck<br />
gegeben wird[,] und ziehen daraus die notwendigen Folgerungen. Sie glauben das nicht,<br />
o<strong>de</strong>r wollen doch nicht jene Folgerungen ziehen.« 30<br />
Sicherlich meinte Brockhaus mit »Folgerungen« hier Konsequenzen, die man aus <strong>de</strong>r biblischen<br />
Wahrheit zog, die man meinte erkannt zu haben. Und doch waren es auch Schlussfolgerungen. Es<br />
waren Auslegungen, Interpretationen o<strong>de</strong>r Meinungen – nicht das Bibelwort selbst.<br />
Dies ist ein wichtiger Punkt in <strong>de</strong>r Frage nach »Einheit und Abson<strong>de</strong>rung«. Es geht um die Schriftfrage<br />
– wie so häufig! Es geht um die hermeneutische Frage: Wie wird die Bibel richtig ausgelegt?<br />
Beim Verständnis vom »Tisch <strong>de</strong>s Herrn« han<strong>de</strong>lt es sich m. E. um Folgen<strong>de</strong>s:<br />
a) Es geht um Folgerungen – d. h. Schlussfolgerungen aus biblischen Aussagen.<br />
b) Diesen Folgerungen wird eine zentrale Stellung zugewiesen, sodass an<strong>de</strong>rsartige Folgerungen als<br />
ernster Gegensatz bezeichnet wer<strong>de</strong>n.<br />
c) Diese Einordnung macht dann eine Verständigung unmöglich.<br />
Dieses Problem – nämlich dass nicht zwischen biblischer Aussage und ihrer Interpretation o<strong>de</strong>r einer<br />
Meinung dazu unterschie<strong>de</strong>n wird – begegnet uns an vielen Stellen. So stellt Jordy zum Schriftenstreit<br />
fest: »Wahrheit o<strong>de</strong>r Meinung – auf diesen Gegensatz lief letztlich <strong>de</strong>r gesamte Schriftenstreit<br />
hinaus.« 31<br />
2.4. Trotz »Entwe<strong>de</strong>r-O<strong>de</strong>r« ein Zusammenschluss<br />
Es ist erstaunlich, dass es am 16. November 1937 in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Berlin-Hohenstaufenstraße zu<br />
einem Zusammenschluss von »Offenen« und »Geschlossenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« kam. Auf einmal war das<br />
kategorische »Entwe<strong>de</strong>r-O<strong>de</strong>r«, das Rudolf Brockhaus 1913 in Die Einheit <strong>de</strong>s Leibes Christi formuliert<br />
hatte, nicht mehr bin<strong>de</strong>nd.<br />
Der Zusammenschluss wur<strong>de</strong> zunächst durch <strong>de</strong>n politischen Druck von 1937 angestoßen. Aus<br />
unserer heutigen Sicht sind natürlich die politischen Umstän<strong>de</strong> äußerst problematisch – nachher ist<br />
man ja immer klüger. Und doch war es nicht nur ein fragwürdiger politischer Druck, <strong>de</strong>r diesen Zusammenschluss<br />
begünstigte. Es war auch die Erkenntnis, dass es im Laufe <strong>de</strong>r Zeit zu unberechtigten<br />
Vorurteilen übereinan<strong>de</strong>r gekommen war. So schrieb Hugo Hartnack über das Treffen vom 20. August<br />
1937 in Kassel:<br />
»Die gegenseitigen Vorurteile waren viel größer gewesen als die tatsächlichen Unterschie<strong>de</strong>, die<br />
eigentlich nur in <strong>de</strong>r Vorgeschichte bei<strong>de</strong>r Kreise lagen. Bei <strong>de</strong>m Zusammensein wirkte <strong>de</strong>r Geist<br />
Gottes so mächtig, dass sich die anwesen<strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> überraschend schnell fan<strong>de</strong>n im gemeinsamen<br />
Bestreben, die unheilvolle Trennung zu beseitigen«. 32<br />
29 Ferdinand Braselmann: Sind alle Kin<strong>de</strong>r Gottes <strong>de</strong>s Tisches <strong>de</strong>s Herrn teilhaftig? Bad Homburg o.J., S. 7 (auch online unter<br />
www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/braselmann.pdf).<br />
30 Rudolf Brockhaus: Brief an Heinz Köhler, 19. Dezember 1927, www.<strong>brue<strong>de</strong>rbewegung</strong>.<strong>de</strong>/pdf/brockhauskoehler.<br />
pdf, S. 3.<br />
31 Jordy, Bd. 2, S. 67.<br />
32 Zitiert bei Jordy, Bd. 3, S. 161.
Ralf Kaemper: Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung 47<br />
3. Wie gehen wir heute mit <strong>de</strong>r Spannung von Einheit und Abson<strong>de</strong>rung um?<br />
3.1. Einheit ist und bleibt entschei<strong>de</strong>nd wichtig<br />
Die Frage nach <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>r Christen ist für <strong>de</strong>n Glauben von zentraler Be<strong>de</strong>utung. Die Einheit <strong>de</strong>r<br />
Christen entspricht <strong>de</strong>m ausdrücklichen Wunsch und Gebet unseres Herrn Jesus Christus. In Joh 17,11<br />
bittet Jesus seinen Vater um die tiefe göttliche Einheit <strong>de</strong>r Jünger (»dass sie eins seien wie wir«). Der<br />
Vater hat dieses Gebet erhört und diese Einheit dadurch geschaffen, dass er seinen Geist in die Herzen<br />
<strong>de</strong>r Jünger ausgegossen hat. Das verpflichtet uns, die Einheit praktisch auszuleben. Sie ist Erkennungszeichen<br />
für »die Welt«, dass Jesus <strong>de</strong>r Sohn Gottes ist (»damit die Welt glaube, dass du mich<br />
gesandt hast«; Joh 17,21.23). Gelebte Einheit be<strong>de</strong>utet also größte Zeugniskraft für das Evangelium. Sie<br />
ist damit Pflicht, nicht Kür. Sie ist überlebensnotwendig für die Gemein<strong>de</strong> Jesu, weil daran ihre Zeugniskraft<br />
hängt.<br />
3.2. Der Sinn von Gruppen<br />
Damit bleibt diese Frage aktuell – nicht nur für <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n. »Einheit« ist heute ein aktuelles,<br />
durchaus modisches Thema. Gera<strong>de</strong> angesichts <strong>de</strong>r immer größer wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Zersplitterung unserer<br />
Gesellschaft wird es stark thematisiert und forciert. Allerdings wird dabei häufig auf einen Minimalkonsens<br />
gesetzt – auf <strong>de</strong>n kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner.<br />
»Abson<strong>de</strong>rung« dagegen steht heute unter Generalverdacht, ist aber genauso relevant – und wird<br />
auch überall praktiziert. Man kann sehr <strong>de</strong>utlich beobachten, wie schnell sich die Mehrheit von abweichen<strong>de</strong>n<br />
– nicht politisch korrekten – Meinungen »abson<strong>de</strong>rt«. Fast je<strong>de</strong>r Verein hat bestimmte<br />
Statuten und auch eine Ethik, die einige Menschen einschließen, an<strong>de</strong>re ausschließen. Wenn ein<br />
Tierschutzverein z. B. Pelzträger ausschließt, weil das seinem Vereinsziel wi<strong>de</strong>rspricht, könnte man<br />
das durchaus als »fundamentalistisch« bezeichnen. Solche Exklusionen sind aber nötig, wenn Gruppenbildung<br />
in unserer Gesellschaft überhaupt irgen<strong>de</strong>inen Sinn haben soll.<br />
Dies gilt m.E. auch für <strong>de</strong>n geistlichen Bereich. Auch wenn ständig behauptet wird, dass die junge<br />
Generation kein Interesse an »Konfessionen« habe (eben typisch postmo<strong>de</strong>rn), glaube ich, dass man<br />
Ordnungen auf Dauer nicht ausweichen kann. Sie sind einfach notwendig. Sogar ein Jugendhauskreis<br />
wird sich, wenn er sich festigt (d.h. nachhaltig wird), vielen Fragen stellen müssen: Wie will man sich<br />
selbst verstehen? Wie will man gewisse Dinge handhaben? Auch je<strong>de</strong> traditionsfreie Neulandgemein<strong>de</strong><br />
wird irgendwann einmal mit »Ordnungsfragen« konfrontiert, z. B. wie man es mit <strong>de</strong>m Abendmahl<br />
halten will o<strong>de</strong>r wen und wann man tauft. Man kommt auch um schwierige ethische Entscheidungen<br />
nicht herum, auch wenn man das eigentlich nicht will. Damit sprechen wir aber von Gruppeni<strong>de</strong>ntität<br />
– es ist nicht mehr alles fließend. Da man solchen Fragen sowieso nicht ausweichen<br />
kann, ist es besser, theologisch reflektiert zu arbeiten und dabei auch Traditionen zu be<strong>de</strong>nken.<br />
3.3. Biblische Hilfen zu »Einheit und Abson<strong>de</strong>rung«<br />
Als <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung ist die Bibel für uns sehr wichtig – und das zu Recht! Ich will versuchen, von <strong>de</strong>r<br />
Bibel her einige Hilfen für <strong>de</strong>n Spannungsbogen zwischen »Einheit« und »Abson<strong>de</strong>rung« zu geben.<br />
Bei dieser Frage geht es immer um irgendwelche Inhalte: Was glaubt jemand, mit <strong>de</strong>m ich Gemeinschaft<br />
haben will o<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>m ich mich trennen will – bzw. was glaubt er nicht? Wenn man allerdings<br />
konsequent <strong>de</strong>nkt, wird man feststellen, dass es keine völlige Übereinstimmung zwischen zwei<br />
Personen in allen möglichen Details gibt. Also eine sehr schlechte Voraussetzung für »Einheit«, <strong>de</strong>nn<br />
dafür braucht man ja min<strong>de</strong>stens zwei Menschen! Man kommt also nicht umhin, die trennen<strong>de</strong>n<br />
Inhalte zu strukturieren – sonst ist Gemeinschaft nicht möglich. Auch wird man die Unterschie<strong>de</strong><br />
hinsichtlich ihrer Be<strong>de</strong>utung klassifizieren müssen. Man kann sicher darüber diskutieren, ob man<br />
eine Tube Zahnpasta in <strong>de</strong>r Mitte o<strong>de</strong>r am En<strong>de</strong> drückt. Von wirklicher Be<strong>de</strong>utung ist dieser »wichtige«<br />
Unterschied allerdings nicht! Überhaupt: Wenn man sich auf Trennen<strong>de</strong>s konzentriert, nimmt<br />
die Menge <strong>de</strong>r zur Trennung herausfor<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Punkte immer mehr zu!
Ralf Kaemper: Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung 48<br />
3.3.1. Wir erkennen nie das Ganze<br />
Wir erkennen nie die ganze Wahrheit. Das ist selbstverständlich, <strong>de</strong>nn sonst wären wir ja Gott. Wir<br />
sind aber begrenzte Menschen. Auch wenn wir – untypisch für die Postmo<strong>de</strong>rne – von einer allgemein<br />
gültigen Wahrheit ausgehen – und das tue ich –, erkennen wir diese Wahrheit niemals vollständig.<br />
Gott ist immer größer als unsere Erkenntnis. Als begrenzte Menschen und Christen erkennen<br />
wir immer nur einen Teil <strong>de</strong>s Ganzen.<br />
In <strong>de</strong>r philosophischen Diskussion wird häufig die Unterscheidung von Wahrheit (o<strong>de</strong>r Tatsachen)<br />
und Interpretationen genannt (Nietzsche). Vom Neuen Testament her möchte ich auf die Unterscheidung<br />
von Wahrheit und Erkenntnis hinweisen.<br />
»Die Liebe vergeht niemals; … sei es Erkenntnis, sie wird weggetan wer<strong>de</strong>n. Denn wir erkennen<br />
stückweise, und wir weissagen stückweise; wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was<br />
stückweise ist, weggetan wer<strong>de</strong>n. Als ich ein Kind war, re<strong>de</strong>te ich wie ein Kind, dachte wie ein<br />
Kind, urteilte wie ein Kind; als ich ein Mann wur<strong>de</strong>, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen<br />
jetzt mittels eines Spiegels, un<strong>de</strong>utlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich<br />
stückweise, dann aber wer<strong>de</strong> ich erkennen, wie auch ich erkannt wor<strong>de</strong>n bin« (1Kor 13,8–12).<br />
Erkenntnis steht also unter folgen<strong>de</strong>n Vorbehalten:<br />
– Erkenntnis ist vorläufig: Sie wird einmal weggetan wer<strong>de</strong>n.<br />
– Erkenntnis ist bruchstückhaft: Wir sehen immer nur Teile <strong>de</strong>s Ganzen.<br />
– Auch wenn Erkenntnis wachstümlich ist, bleibt sie im Verhältnis zur ganzen Wahrheit »un<strong>de</strong>utlich«.<br />
In Eph 3,18f. betont Paulus, dass Erkenntnis ein »Gemeinschaftsprojekt« ist: »Damit ihr imstan<strong>de</strong><br />
seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen<br />
die die Erkenntnis übersteigen<strong>de</strong> Liebe <strong>de</strong>s Christus, damit ihr erfüllt wer<strong>de</strong>t zur ganzen Fülle<br />
Gottes.«<br />
– Erkenntnis ist <strong>de</strong>mnach Gemeinschaftssache: Wir erfassen <strong>zusammen</strong> mit allen Heiligen die<br />
umfassen<strong>de</strong>n Dimensionen <strong>de</strong>r Liebe und <strong>de</strong>s Werkes Christi.<br />
Wir sehen also: Menschliche Erkenntnis, die für uns <strong>de</strong>n Zugang zur Wahrheit und zu <strong>de</strong>n Tatsachen<br />
be<strong>de</strong>utet, unterliegt Einschränkungen. Erkenntnis ist eben vorläufig, bruchstückhaft und braucht<br />
Gemeinschaft.<br />
Sollen wir nun die Erkenntnis beiseite lassen? Nein, auf keinen Fall! Das kann kein Aufruf zu<br />
Gleichgültigkeit und Primitivität sein. Erkenntnis ist und bleibt wichtig, unbedingt nötig. In Eph 4,13<br />
schreibt Paulus, dass alle Gaben <strong>de</strong>s Geistes dazu dienen sollen, dass »wir alle hingelangen zur Einheit<br />
<strong>de</strong>s Glaubens und <strong>de</strong>r Erkenntnis <strong>de</strong>s Sohnes Gottes«. In Phil 1,9 betet er, »dass eure Liebe noch mehr<br />
und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht«. Und Petrus for<strong>de</strong>rt uns auf: »Wachst aber in<br />
<strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong> und Erkenntnis unseres Herrn und Heilan<strong>de</strong>s Jesus Christus« (2Petr 3,18).<br />
Erkenntnis ist und bleibt zentral für <strong>de</strong>n christlichen Glauben. Aber wegen ihrer Einschränkungen<br />
braucht sie einen Ausgleich – einen »weichen Faktor«, <strong>de</strong>r ihre »Schwächen« ausgleicht. In 1Kor 8,1<br />
schreibt Paulus im Zusammenhang mit <strong>de</strong>m Essen von Götzenopferfleisch, »dass wir alle Erkenntnis<br />
haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut«. Das Korrektiv und die Ergänzung zur Erkenntnis<br />
ist die Liebe. Liebe be<strong>de</strong>utet keine undifferenzierte Sentimentalität, son<strong>de</strong>rn ist <strong>de</strong>r Wille<br />
zur Gemeinschaft – und damit auch zur Ergänzung und Korrektur durch <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren. Denn Erkenntnis<br />
kann Stolz för<strong>de</strong>rn, und Stolz verhin<strong>de</strong>rt Gemeinschaft. Der Aufruf zur Liebe ist <strong>de</strong>r Vorläufigkeit<br />
und »Stückhaftigkeit« menschlicher Erkenntnis angemessen. Wir brauchen diesen »weichen Faktor«,<br />
weil die (vermeintlich!) »harten Faktoren« eben die erwähnten Einschränkungen haben.<br />
All das kann niemals ein Grund sein, Erkenntnis über Bord zu werfen o<strong>de</strong>r gering zu achten, <strong>de</strong>nn<br />
wir brauchen sie ganz dringend. Sie ist und bleibt unser menschlicher Zugang zur Wahrheit. Wir<br />
müssen uns aber ihrer Einschränkungen bewusst sein und mit ihnen rechnen, um korrekturbereit zu
Ralf Kaemper: Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung 49<br />
bleiben. Das wird uns durch die Liebe geschenkt, in<strong>de</strong>m wir bewusst die Gemeinschaft – die Einheit<br />
– mit <strong>de</strong>n Geschwistern suchen.<br />
Darf es nun keine festen Überzeugungen mehr geben? Wird alles butterweich und relativ? Nein,<br />
auf keinen Fall! Denn es gibt Eckdaten unseres Glaubens, die fix sind und nie zur Disposition stehen<br />
können. Mit meinem zweiten biblischen Hinweis zu unserer Thematik will ich dazu eine Hilfe geben.<br />
3.3.2. Es gibt eine Hierarchie von Wahrheiten<br />
Die Bibel ist eine großartige Bibliothek: eine Vielfalt von Stilen, Autoren und Inhalten. Diese Inhalte<br />
müssen verstan<strong>de</strong>n und ge<strong>de</strong>utet wer<strong>de</strong>n – sie sollen Teil unserer Erkenntnis wer<strong>de</strong>n. Aber da wir ein<br />
sehr vielfältiges Buch haben, müssen wir be<strong>de</strong>nken: Nicht alle biblischen Wahrheiten sind auf einer<br />
Ebene zu sehen. Nicht alles ist gleich wichtig für uns. Das ist keine Anmaßung, es ist eine Aussage, die<br />
die Schrift selber macht. In <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung Jesu mit <strong>de</strong>n Pharisäern <strong>fin<strong>de</strong>n</strong> wir eine interessante<br />
Äußerung:<br />
»Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und <strong>de</strong>n<br />
Anis und <strong>de</strong>n Kümmel und habt die wichtigeren Dinge <strong>de</strong>s Gesetzes beiseite gelassen: das Gericht<br />
und die Barmherzigkeit und <strong>de</strong>n Glauben; diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen« (Mt<br />
23,23).<br />
Jesus unterschei<strong>de</strong>t also zwischen »wichtig« und »wichtiger« – nicht zwischen »wichtig« und »unwichtig«!<br />
Deshalb ist es sinnvoll und auch biblisch, Fragen, in <strong>de</strong>nen wir zu unterschiedlichen Ergebnissen<br />
kommen, in ihrer Wichtigkeit zu bewerten.<br />
Eine mögliche Kategorisierung wäre:<br />
1. absolut zentrale Wahrheiten (damit steht und fällt <strong>de</strong>r christliche Glaube: Existenz Gottes, Gottessohnschaft<br />
Jesu u. a.)<br />
2. wichtige biblische Wahrheiten (Ethik/Heiligung)<br />
3. biblische Ordnungen (z. B. Ehe, Familie, Gemein<strong>de</strong>)<br />
4. Adiaphora (Dinge, die sowohl gut als auch schlecht sein können)<br />
5. Freiheit (Geschmacksfragen ohne ethische Relevanz)<br />
Spannend ist natürlich, wo man eine Frage einordnet. Das ist beson<strong>de</strong>rs zwischen <strong>de</strong>n Kategorien 2<br />
und 3 nicht immer klar. Je höher eine Streitfrage angesie<strong>de</strong>lt wird, <strong>de</strong>sto schwieriger wird es wer<strong>de</strong>n,<br />
unterschiedliche Sichten gemeinsam auszuhalten. Wichtig ist aber an dieser Stelle, dass wir nicht<br />
versuchen, das Zentrale zu schützen, in<strong>de</strong>m wir die Rän<strong>de</strong>r sichern. Hier gibt es manchmal eine falsche<br />
Sicht von <strong>de</strong>r »Treue im Kleinen«. Man wird das Zentrum nicht schützen, in<strong>de</strong>m man die Rän<strong>de</strong>r<br />
festklopft.<br />
Ich glaube, dass ein großes Problem <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung war, dass sie Fragen <strong>de</strong>r Kategorie 3 (Biblische<br />
Ordnungen) zu Fragen <strong>de</strong>r Kategorie 1 o<strong>de</strong>r 2 erhoben hat. Dies ist m. E. bis heute so: Gemein<strong>de</strong>ordnungsfragen<br />
(die eine Gemein<strong>de</strong> vor Ort sicher regeln muss und auch darf!) wer<strong>de</strong>n zum<br />
Kennzeichen für Rechtgläubigkeit erhoben, an <strong>de</strong>r sogar die Möglichkeit zur Gemeinschaft festgemacht<br />
wird. Das war früher die Frage nach <strong>de</strong>m »Tisch <strong>de</strong>s Herrn«, das sind heute vielleicht die Fragen<br />
um die Auswirkung <strong>de</strong>r Geschlechterrollen in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>.<br />
3.4. Von Trennen<strong>de</strong>m, Verboten und Geboten<br />
Generell hat die Konzentration auf das Trennen<strong>de</strong> eine eigene Dynamik, <strong>de</strong>nn die Menge <strong>de</strong>r Punkte,<br />
die trennen, nimmt immer mehr zu, wenn man sich darauf konzentriert. Konzentriert man sich dagegen<br />
auf das Zentrum, dann können wir viel mehr Divergenz ertragen. Ebenso verhält es sich mit <strong>de</strong>r<br />
Frage nach <strong>de</strong>m »Verbotenen«, das ja dann häufig zur Trennung führt.
Ralf Kaemper: Die Spannung zwischen Einheit und Abson<strong>de</strong>rung 50<br />
Roland Deines weist in seinem Aufsatz »Pharisäer und Pietisten – ein Vergleich zwischen zwei<br />
analogen Frömmigkeitsbewegungen« 33 darauf hin, dass die Pharisäer meistens nach Verbotenem und<br />
Erlaubtem fragen. Jesus jedoch weist sie auf das Gebotene hin (z. B. Mt 12,10ff.; 19,3ff.; 22,17ff.). Deines<br />
macht <strong>de</strong>utlich, dass <strong>de</strong>r natürliche Mensch <strong>de</strong>m Verbot näher steht als <strong>de</strong>m Gebot:<br />
»Denn das Einhalten von Verboten kann sich <strong>de</strong>r Mensch selbst bescheinigen. Solange das Verbot<br />
zentral ist, lässt sich das Maß <strong>de</strong>s Gehorsams messen und eingrenzen. Wo das Gebot die Führung<br />
übernimmt, da ist das Maß <strong>de</strong>s Gehorsams grenzenlos, weil die Liebe als Inbegriff <strong>de</strong>s Gebots grenzenlos<br />
ist. Das Ausstrecken nach <strong>de</strong>m Gebot macht beschei<strong>de</strong>n, weil es hinter <strong>de</strong>m Ziel zurückbleibt.<br />
So verweist das Gebot auf die Gna<strong>de</strong>, das Verbot dagegen verleitet zur Selbstgerechtigkeit.«<br />
Ich glaube, dass das auch ein Kernproblem <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung ist. Es liegt in <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>r Sache:<br />
Wer <strong>de</strong>n Fokus auf das Trennen<strong>de</strong> – die Abson<strong>de</strong>rung vom Bösen – legt, muss ständig die Grenzen<br />
<strong>de</strong>s Erlaubten formulieren. Deines schreibt weiter:<br />
»Im Laufe <strong>de</strong>r Zeit verwan<strong>de</strong>lte sich die Dynamik <strong>de</strong>s Gebotes zur Fixierung auf das Verbotene.<br />
Aus <strong>de</strong>m Blick nach vorne, aus <strong>de</strong>m Ausrichten <strong>de</strong>s Willens auf ein Ziel hin, wur<strong>de</strong> auch ein Blick<br />
zurück und zur Seite. Statt Gottes Willen nachzujagen, bemühte man sich, das von Gott Gebotene<br />
zu <strong>de</strong>finieren, zu präzisieren und durch einen Zaun weiterer Verbote zu schützen. Nun richtete<br />
sich <strong>de</strong>r Blick auf <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r die Verbote übertrat. Nun begann das Schei<strong>de</strong>n in Gehorsame und Ungehorsame,<br />
in Gerechte und Ungerechte, in Reine und Unreine. Der Maßstab dafür war das Verbot,<br />
das einen nicht zum an<strong>de</strong>ren wies, son<strong>de</strong>rn ermöglichte, sich über <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren zu erheben. Die<br />
Konzentration auf das Verbot macht Gott zum Verbieter, die andauern<strong>de</strong> Beschäftigung mit <strong>de</strong>m<br />
zu Mei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n verdarb die Schöpfung […]. Hinter <strong>de</strong>r Fixierung auf das Verbot steht ein Misstrauen<br />
Gott und seiner Schöpfung gegenüber (vgl. Apg 10,14f.; 11,8f.) […]. Das Gebot führt zum<br />
Nächsten um seines Heiles willen (Apg 10,28.34f.). Sein Ziel ist, <strong>de</strong>m Nächsten zum Guten zu<br />
leben, nicht, über ihn zu richten.«<br />
Wichtig für die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung wird bleiben, sich an <strong>de</strong>n ursprünglichen Impuls <strong>de</strong>r Einheit zu<br />
erinnern und <strong>de</strong>n Weg zum Bru<strong>de</strong>r und zur Schwester bewusst zu suchen – und nicht ständig das zu<br />
fixieren, was trennt.<br />
33 Jahrbuch für evangelikale Theologie 14 (2000), S. 113–133.
Fares Marzone<br />
Die IBCM-Konferenzen als Einheit stiften<strong>de</strong><br />
Einrichtung <strong>de</strong>r weltweiten <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung<br />
Ich behandle das Thema mit großer Freu<strong>de</strong>, da ich sehr stark von <strong>de</strong>r Wichtigkeit <strong>de</strong>r Einheit überzeugt<br />
bin. Es war unser Herr, <strong>de</strong>r gesagt hat: »Ich bitte für die, welche durch ihr Wort an mich glauben,<br />
damit sie alle eins seien« (Joh 17,20). Und <strong>de</strong>r Apostel Paulus zählt in Eph 4,6 sieben Kernpunkte<br />
dieser Einheit auf, in<strong>de</strong>m er entsprechend <strong>de</strong>m hebräischen Stil mit <strong>de</strong>m Endresultat beginnt: »Da ist<br />
ein Leib …«.<br />
Unsere Gemein<strong>de</strong>bewegung bil<strong>de</strong>t nur einen kleinen Teil dieses großen Leibes. Vielleicht zitieren<br />
wir häufig Ps 133,1 (manchmal missbräuchlich): »Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong><br />
einträchtig beieinan<strong>de</strong>r wohnen.« (Natürlich sind dabei nicht nur die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung<br />
gemeint!). Trotz<strong>de</strong>m müssen wir zugeben, dass ein Problem, das uns in unserer beinahe 200-jährigen<br />
Geschichte immer verfolgt hat, die Spannung zwischen Einheit und Vielfalt, Unabhängigkeit und<br />
Gemeinschaft gewesen ist. Das war immer eine große Herausfor<strong>de</strong>rung auf lokaler, nationaler und<br />
internationaler Ebene.<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>versammlungen haben versucht, diese Spannung auf zweierlei<br />
Weise aufzulösen. In manchen Län<strong>de</strong>rn leben die Gemein<strong>de</strong>n in völliger Unabhängigkeit voneinan<strong>de</strong>r.<br />
In einigen Gegen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Welt beobachtet man, dass Gemein<strong>de</strong>n, die geographisch nahe beieinan<strong>de</strong>r<br />
liegen, sich gegenseitig völlig ignorieren. Manchmal hängt das mit Verhaltensweisen <strong>zusammen</strong>,<br />
die in einer speziellen Kultur üblich sind. Ein an<strong>de</strong>res Mal sind kleinere Lehrunterschie<strong>de</strong><br />
dafür verantwortlich, öfter aber größere persönliche Probleme zwischen <strong>de</strong>n Leitern. In vielen Fällen<br />
jedoch ignoriert man sich ohne beson<strong>de</strong>ren Grund. Ich wür<strong>de</strong> sagen, dass das durch die Betonung <strong>de</strong>r<br />
völligen Unabhängigkeit <strong>de</strong>r lokalen Gemein<strong>de</strong> bedingt ist, die im Neuen Testament keinerlei Grundlage<br />
hat, auch nicht im Verhalten <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s 1. Jahrhun<strong>de</strong>rts.<br />
Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite <strong>fin<strong>de</strong>n</strong> sich <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n, die auf lokaler Ebene o<strong>de</strong>r auch in einem<br />
Bund auf nationaler Ebene verbun<strong>de</strong>n sind. In diesem Fall wird manchmal an <strong>de</strong>r Unabhängigkeit <strong>de</strong>r<br />
Ortsgemein<strong>de</strong> festgehalten; in einigen Län<strong>de</strong>rn spielt sie allerdings überhaupt keine Rolle. Dort entschei<strong>de</strong>n<br />
nationale Komitees, in<strong>de</strong>m sie die Gemein<strong>de</strong>n auf vielfältige Weise o<strong>de</strong>r sogar vollständig<br />
leiten. Das ruft oft Spannungen hervor, die zu Spaltungen führen können, wie die Geschichte lehrt.<br />
Meiner beschei<strong>de</strong>nen Meinung nach stimmt keine <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Positionen, also we<strong>de</strong>r die totale<br />
Unabhängigkeit noch die totale Abhängigkeit voneinan<strong>de</strong>r, wirklich mit <strong>de</strong>n Aussagen <strong>de</strong>s Neuen<br />
Testaments überein. Dabei muss man natürlich nicht erwähnen, dass Einheit nicht Einförmigkeit<br />
(also völlig <strong>de</strong>ckungsgleiche Formen) be<strong>de</strong>utet. Nebenbei gesagt, steckt auch dahinter ein kulturelles<br />
Problem. So haben die Gemein<strong>de</strong>n in einigen osteuropäischen Län<strong>de</strong>rn einen historischen und kulturellen<br />
Hintergrund, <strong>de</strong>r sie zwingt, miteinan<strong>de</strong>r vernetzt zu bleiben, wobei auch eine zentrale Stelle<br />
existiert, die Anweisungen an die Gemein<strong>de</strong>n gibt. Die normale Tradition ist aber, dass die einzelnen<br />
Gemein<strong>de</strong>n auf je<strong>de</strong>r Ebene unabhängig sind.<br />
Trotz dieser Ausgangssituation hat es in <strong>de</strong>n vergangenen zwei Jahrzehnten einige Anzeichen von<br />
Verän<strong>de</strong>rung gegeben. Dabei hat die IBCM (International Brethren Conference on Mission, eine weltweite<br />
Konferenz verantwortlicher Leiter <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung) sicher eine Rolle gespielt. Sie wird<br />
ihren Einfluss behalten, da sie die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> immer ermutigt hat, <strong>zusammen</strong> die Gegenwart <strong>de</strong>s Herrn zu<br />
suchen sowie Vernetzung, Gemeinschaft und gemeinsames Gebet zu stärken. Berichte, die jeweils<br />
nach <strong>de</strong>n vergangenen fünf Konferenzen geschrieben wur<strong>de</strong>n, bestätigen einige ihrer Ziele:<br />
– Die Konferenz ist je<strong>de</strong>s Mal größer und besser gewor<strong>de</strong>n. Die Zahl <strong>de</strong>r Teilnehmer wuchs von<br />
194 (aus 22 Län<strong>de</strong>rn) bei <strong>de</strong>r IBCM1 in Singapur auf 480 (aus 93 Län<strong>de</strong>rn) bei <strong>de</strong>r IBCM5 in<br />
Straßburg.
Fares Marzone: Die IBCM-Konferenzen als Einheit stiften<strong>de</strong> Einrichtung 52<br />
– Als Erstes und Wichtigstes: Es waren unvergessliche Konferenzen, bei <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Herr geehrt<br />
und verherrlicht wur<strong>de</strong>.<br />
– Es war eine sehr ermutigen<strong>de</strong> und wun<strong>de</strong>rschöne Zeit, <strong>de</strong>n Herrn <strong>zusammen</strong> mit <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n und<br />
Schwestern von überall in <strong>de</strong>r Welt anzubeten.<br />
– Viele wichtige Beziehungen wur<strong>de</strong>n in dieser Zeit begonnen o<strong>de</strong>r weitergeführt.<br />
– Die tiefe Freu<strong>de</strong> und immer neue Erfahrung, nämlich dass Gott überall auf <strong>de</strong>r Welt mächtig am<br />
Wirken ist, ist wie das Atmen frischer Luft.<br />
– Mit Sicherheit hat diese gewaltige Erfahrung einer solchen internationalen Gemeinschaft im<br />
Herrn wertvolle Eindrücke in je<strong>de</strong>m Leben hinterlassen.<br />
Folgen<strong>de</strong> fünf IBCM-Konferenzen haben bisher stattgefun<strong>de</strong>n:<br />
– IBCM1 in Singapur, 9.–15. Juni 1993, mit 194 Leitern, hauptberuflichen Mitarbeitern und Missionaren;<br />
Thema: »Der Beitrag <strong>de</strong>r ›<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>‹ zur weltweiten Mission <strong>de</strong>r Kirche«.<br />
– IBCM2 in Rom, 17.–21. Juni 1996; Thema: »Neue Horizonte in <strong>de</strong>r Mission«.<br />
– IBCM3 in Hermannstadt/Rumänien, 30. Juni – 4. Juli 2004; Thema: »Der Herr tat täglich hinzu«.<br />
– IBCM4 in Wie<strong>de</strong>nest, 25. Juni – 1. Juli 2007, mit 409 Teilnehmern aus 77 Län<strong>de</strong>rn. Ungewöhnliche<br />
Län<strong>de</strong>r wie Alaska, Grönland, die Andamansen, Madagaskar, Jordanien und Nepal waren<br />
vertreten, aber auch Län<strong>de</strong>r mit großen Zahlen von <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n wie Angola, Argentinien,<br />
Sambia, Tschad und Indien. Thema: »… um etliche zu gewinnen«.<br />
– IBCM5 in Straßburg, 13.–17. Juni 2011; Thema: »Ich will meine Gemein<strong>de</strong> bauen«.<br />
Seit ihren Anfängen hat die IBCM <strong>de</strong>n wichtigen Dienst geleistet, die Einheit <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n<br />
zu beeinflussen, in<strong>de</strong>m sie die Versammlungen auf nationaler Ebene und weltweit mehr miteinan<strong>de</strong>r<br />
verbun<strong>de</strong>n hat, auch wenn das oft nicht sofort bemerkt wur<strong>de</strong>.<br />
Ein Schlüsselwort in <strong>de</strong>r Abkürzung IBCM ist »Mission«. Wir alle wissen, dass die »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in<br />
<strong>de</strong>r Mission immer eifrig gewesen sind. Dabei haben wir unter Mission <strong>de</strong>n gesamten Auftrag Jesu<br />
Christi an seine Gemein<strong>de</strong> verstan<strong>de</strong>n. Wir wollen also weltweit Gemein<strong>de</strong>n ermutigen, seinen Auftrag<br />
im weitesten Sinne engagiert zu leben.<br />
Lassen Sie mich nun einige Beispiele neuer Aktivitäten, Entwicklungen und Verbindungen erwähnen,<br />
die weltweit durch die IBCM inspiriert wur<strong>de</strong>n. Gute Zeugnisse kommen bereits direkt von <strong>de</strong>r<br />
ersten Konferenz. Vor <strong>de</strong>r IBCM1 kannten sich die Gemein<strong>de</strong>n in Singapur und respektierten sich<br />
gegenseitig, aber nach <strong>de</strong>r Konferenz begannen sie mehrere Aktivitäten miteinan<strong>de</strong>r. Als wir als internationales<br />
Leitungskomitee die IBCM4 in Wie<strong>de</strong>nest organisierten, war es großartig zu sehen, dass<br />
sich in Deutschland ein Nationales Komitee aus <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n bil<strong>de</strong>te, die aus unterschiedlichen Hintergrün<strong>de</strong>n<br />
kamen. Trotz <strong>de</strong>r Unterschiedlichkeit hatten wir immer das Emp<strong>fin<strong>de</strong>n</strong> einer großen Einheit<br />
unter <strong>de</strong>n <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n. Einige davon sind heute hier.<br />
Auf internationaler Ebene begann bei <strong>de</strong>r IBCM2 etwas Neues, das die Einheit in einem weiteren<br />
Sinne beeinflussen sollte. Die afrikanischen Leiter hatten ein separates Treffen, wo sie die Möglichkeit<br />
diskutierten, sich zu eigenen Konferenzen <strong>zusammen</strong>zu<strong>fin<strong>de</strong>n</strong>. Aber danach geschah zunächst nichts.<br />
Der Wen<strong>de</strong>punkt für internationale Netzwerkaktivitäten ergab sich erst auf <strong>de</strong>r IBCM3 in Rumänien.<br />
Diese Aktivitäten haben seit <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n letzten Konferenzen in Deutschland und Frankreich ständig<br />
zugenommen. So gibt es sechs Hauptgebiete, auf <strong>de</strong>nen die IBCM einen Beitrag zur Einheit <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung<br />
geleistet hat, entsprechend ihren Hauptzielen. (Die IBCM hat sieben Hauptziele, das siebte<br />
ist, »<strong>zusammen</strong> die Gegenwart und Führung <strong>de</strong>s Herrn zu suchen«.) Dazu gehören:<br />
1. Praktische Erfahrungen, I<strong>de</strong>en und Metho<strong>de</strong>n weitergeben<br />
Das wur<strong>de</strong> in einigen Plenumsveranstaltungen am Morgen erreicht, aber auch in <strong>de</strong>n Abendveranstaltungen,<br />
wo spezielle Aspekte <strong>de</strong>r Arbeit in einigen ausgewählten Län<strong>de</strong>rn weitergegeben wur<strong>de</strong>n. Wir<br />
haben gelernt, wie die Arbeit in »schwierigen« und »neuen« Län<strong>de</strong>rn durchgeführt wird. Manchmal<br />
haben sich echte Hilfen für geistliche o<strong>de</strong>r materielle Nöte ergeben, z.B. finanzielle Unterstützung zur
Fares Marzone: Die IBCM-Konferenzen als Einheit stiften<strong>de</strong> Einrichtung 53<br />
Veröffentlichung christlicher Literatur o<strong>de</strong>r Spen<strong>de</strong>n zur Katastrophenhilfe. Es war auch bereichernd,<br />
auf <strong>de</strong>n Fluren miteinan<strong>de</strong>r Zeit im Gespräch zu verbringen.<br />
2. Das Bewusstsein für geistliche Herausfor<strong>de</strong>rungen aktueller gesellschaftlicher Trends und kultureller<br />
Entwicklungen för<strong>de</strong>rn<br />
Das erfolgt beson<strong>de</strong>rs in Workshops, aber auch im Plenum, z. B. als Gerd Goldmann auf <strong>de</strong>r IBCM3<br />
zwölf spezielle Herausfor<strong>de</strong>rungen in Bezug auf Evangelisation ansprach, die alle auf <strong>de</strong>r Konferenz<br />
vorkamen. Dazu gehört auch die Notwendigkeit von Partnerschaften und Netzwerken, die Einmischung<br />
in die Gesellschaft und soziale Aktivitäten sowie die Notwendigkeit, das Evangelium in <strong>de</strong>r<br />
eigenen Kultur und in <strong>de</strong>r transkulturellen Verkündigung so weiterzugeben, dass die Menschen seine<br />
Be<strong>de</strong>utung für ihr Leben erkennen.<br />
3. Leitern <strong>de</strong>r weltweiten Gemein<strong>de</strong> die Möglichkeit eröffnen, einan<strong>de</strong>r wahrzunehmen und zu<br />
ermutigen<br />
Nach <strong>de</strong>r IBCM2 berichtete z.B. Ken Newton (Australien), dass es eine beson<strong>de</strong>re Information für ihn<br />
war, dass in Angola trotz <strong>de</strong>s langen Bürgerkriegs mehr als tausend <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n existieren.<br />
Außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong>n Konferenzredner in an<strong>de</strong>re Län<strong>de</strong>r eingela<strong>de</strong>n, um dort zu predigen und/o<strong>de</strong>r zu<br />
lehren. Einige Beispiele waren René Daidanso, Don Fleming, Ken Fleming, Oscar Muriu, Ken Newton<br />
o<strong>de</strong>r Neil Summerton. Auch ich selbst wur<strong>de</strong> in einige Län<strong>de</strong>r eingela<strong>de</strong>n, nämlich nach Kanada,<br />
Sambia, Tschad, Rumänien, Deutschland, Frankreich, Polen, Indien, Myanmar, Sudan. Einige Referenten<br />
<strong>de</strong>r IBCM wur<strong>de</strong>n gebeten, Artikel für verschie<strong>de</strong> Zeitschriften <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« zu schreiben.<br />
Manche Teilnehmer <strong>de</strong>r IBCM2 kamen mit <strong>de</strong>r Einschätzung zur Konferenz, dass die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung<br />
fast am En<strong>de</strong> sei – und fan<strong>de</strong>n es erfrischend, wie lebendig die Bewegung in vielen Teilen <strong>de</strong>r<br />
Welt dasteht. Sie fuhren mit einer neuen Sicht und stark ermutigt nach Hause. Ein zusätzliches Ziel<br />
war die Ermutigung junger Leiter. Dabei hatten wir mehr als ein Problem zu überwin<strong>de</strong>n, aber inzwischen<br />
ist es ein stabiles Projekt. Wir hoffen, dass auf <strong>de</strong>r nächsten Konferenz <strong>de</strong>r Anteil an jungen<br />
Leitern erneut wachsen wird.<br />
4. Regionale Konferenzen mit ähnlichen Zielen anstoßen und durchführen<br />
Seit <strong>de</strong>r IBCM3 haben wir die Geburt und das Wachstum regionaler Konferenzen erlebt. Inzwischen<br />
gibt es eine ganze Reihe solcher regionaler Konferenzen in verschie<strong>de</strong>nen Teilen <strong>de</strong>r Welt. Die IBCM<br />
hat das Ziel, solche Konferenzen anzuregen, zu ermutigen und zu unterstützen. Alle diese Konferenzen<br />
und Konsultationen waren für die Teilnehmer ein großer Segen, da sie unterschiedliche Situationen<br />
besser kennengelernt haben und Beziehungen sowohl in geistlicher Hinsicht als auch auf sozialer<br />
Ebene entstan<strong>de</strong>n sind.<br />
In Europa waren bereits vor unserem Start verschie<strong>de</strong>nartige an<strong>de</strong>re Konferenzen durchgeführt<br />
wor<strong>de</strong>n. Unsere erste europäische Konferenz war <strong>de</strong>r »Europa-Tag« 2005 in Wie<strong>de</strong>nest, dann »Brethren<br />
in Europe« 2009 in <strong>de</strong>r Slowakei.<br />
In Afrika fand die erste »Pan-African Conference on Missions« 2004 in Johannesburg mit 100<br />
Teilnehmern aus 14 afrikanischen Län<strong>de</strong>rn und 4 Teilnehmern aus westlichen Län<strong>de</strong>rn statt. 2013 wird<br />
es die dritte Konferenz geben. Ermutigt durch die afrikanische Konferenz begann ein weiteres sehr<br />
wichtiges Treffen: »The Great Lakes Brethren Conference«. Vertreter <strong>de</strong>r ostafrikanischen Län<strong>de</strong>r<br />
trafen sich 2005 in Nairobi, 2006 in Ruanda, 2008 in Moshi/Tansania und 2010 wie<strong>de</strong>r in Nairobi, wo<br />
85 Teilnehmer aus fünf ostafrikanischen Staaten und einige aus nichtafrikanischen Län<strong>de</strong>rn <strong>zusammen</strong><br />
waren. Die nächste Konferenz fin<strong>de</strong>t im August 2013 in Nairobi statt.<br />
In Asien gibt es eine ähnliche Entwicklung. Die erste Konferenz fand 2009 in Malaysia statt, mit<br />
360 Teilnehmern aus 30 Län<strong>de</strong>rn. Eines <strong>de</strong>r Ergebnisse war <strong>de</strong>r Beginn einer Arbeit unter <strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n«<br />
aus Malaysia, mit <strong>de</strong>m sie ausländischen Flüchtlingen helfen (Christian Brethren Ventures).<br />
Für 2013 ist eine weitere Konferenz auf <strong>de</strong>n Philippinen geplant.<br />
Auch in <strong>de</strong>r Karibik hat es Konsultationen/Konferenzen gegeben; die nächste ist für 2014 geplant.<br />
Die portugiesisch sprechen<strong>de</strong>n Versammlungen hatten im September 2012 eine Konferenz in Rio <strong>de</strong>
Fares Marzone: Die IBCM-Konferenzen als Einheit stiften<strong>de</strong> Einrichtung 54<br />
Janeiro, die spanisch sprechen<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n sich in 2013 in Buenos Aires treffen. Bei diesen bei<strong>de</strong>n<br />
Konferenzen diskutiert man mehr über praktische Aspekte – abgesehen von <strong>de</strong>m Nutzen, <strong>de</strong>n man<br />
natürlich aus <strong>de</strong>r Gemeinschaft zieht.<br />
5. Geburt und Wachstum <strong>de</strong>s Brethren Information Network (BIN) und <strong>de</strong>s Brethren Educational<br />
Network (BEN), jetzt Brethren Training Network (BTN)<br />
Das Ziel von BIN ist es, eine »Landkarte« über die Situation <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n im internationalen<br />
Kontext zu schaffen, mit Adressen und an<strong>de</strong>ren Informationen. Das ist vor allem durch die Veröffentlichung<br />
<strong>de</strong>s sehr wichtigen Buches The Brethren Movement Worldwi<strong>de</strong>: Key Information auf <strong>de</strong>r IBCM4<br />
erfolgt. Das Buch wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>m Englän<strong>de</strong>r Dr. Harald Rowdon herausgegeben und enthält Informationen<br />
über 61 Län<strong>de</strong>r. Seit<strong>de</strong>m sind zwei weitere Auflagen erschienen, die letzte bei <strong>de</strong>r IBCM5 von<br />
Ken Newton und Andrew Chan. Sie enthält Informationen über 96 Län<strong>de</strong>r. Dieses für die internationalen<br />
Beziehungen extrem wichtige Instrument beinhaltet eine Menge Informationen über die<br />
Geschichte und die Entwicklung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n in je<strong>de</strong>m Land, über ihre hauptsächlichen Aktivitäten,<br />
Adressen nationaler Organisationen, <strong>de</strong>n Stellenwert, <strong>de</strong>r einer biblischen Ausbildung gegeben<br />
wird (z. B. durch Bibelschulen), Zeitschriften, Verlage sowie Grün<strong>de</strong> zum Danken und spezielle Gebetsanliegen.<br />
Ein an<strong>de</strong>rer wichtiger Beitrag <strong>de</strong>r IBCM zur Unterstützung <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« ist die Bildung<br />
<strong>de</strong>s Brethren Educational Network (BEN), das 2012 umbenannt und unter <strong>de</strong>m Namen Brethren Training<br />
Network (BTN) neu gestartet wur<strong>de</strong>. Zwei größere Konsultationstreffen wur<strong>de</strong>n am Emmaus Bible<br />
College in Dubuque/USA 2005 (30 Teilnehmer aus 16 Län<strong>de</strong>rn) und 2010 (50 Teilnehmer aus 30 Län<strong>de</strong>rn)<br />
durchgeführt. Außer<strong>de</strong>m gab es bei <strong>de</strong>r IBCM5 einen gut besuchten Workshop, wo <strong>de</strong>r Fortschritt<br />
bewertet wur<strong>de</strong>. Das Ziel von BTN ist es, Bildung und Training für Leiterschaft und Dienst in<br />
örtlichen Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung zu för<strong>de</strong>rn, auch durch entstehen<strong>de</strong> Bibelschulen und<br />
Trainingskurse, die diesen Gemein<strong>de</strong>n dienen.<br />
Bewertung und Zusammenfassung<br />
Die IBCM hat <strong>de</strong>n Gedanken <strong>de</strong>r weltweiten Einheit <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung transportiert und wird diese<br />
I<strong>de</strong>e weiter för<strong>de</strong>rn. Damit wird nicht die Unabhängigkeit <strong>de</strong>r örtlichen Gemein<strong>de</strong>n abgewertet. Vielmehr<br />
soll die Energie genutzt wer<strong>de</strong>n, die durch Netzwerkbildung, Gemeinschaft und Zusammenarbeit<br />
für Gottes Reich entfacht wird. Wir müssen weiterhin hart arbeiten, und wir beten, dass dieser<br />
Einsatz unserer Bewegung helfen wird, weltweit zu wachsen.
Neil Summerton<br />
Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in weltweiter Sicht<br />
Wenn man charakteristische Eigenschaften <strong>de</strong>r weltweiten Bewegung <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« herausarbeiten<br />
will, beschreibt man sie am besten auf <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r heute statt<strong>fin<strong>de</strong>n</strong><strong>de</strong>n Globalisierung,<br />
beson<strong>de</strong>rs auch <strong>de</strong>r evangelikalen Bewegung.<br />
Wir leben in <strong>de</strong>r Tat in einer globalisierten Welt. Vielleicht weil sie im Ebenbild Gottes geschaffen<br />
sind, haben die Menschen immer die Neigung gehabt, über ihren geographischen Rahmen hinauszu<strong>de</strong>nken.<br />
In je<strong>de</strong>r Generation gibt es eine Menge Leute, die sich über das eigene Land hinausbewegen,<br />
sei es aus persönlichem Interesse o<strong>de</strong>r um ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern. Wenn es Vorteile<br />
brachte, entstand ein florieren<strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l o<strong>de</strong>r Austausch von Gütern; <strong>de</strong>r heutige Han<strong>de</strong>l über große<br />
Entfernungen und <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong> Finanztransfer sind keineswegs neue Erscheinungen. Eröffnet<br />
wur<strong>de</strong>n diese Chancen durch einfachere Reisemöglichkeiten <strong>zusammen</strong> mit Fortschritten in <strong>de</strong>r<br />
Transporttechnik. Das beobachtet man bereits in <strong>de</strong>r griechisch-römischen Welt, wo die bei<strong>de</strong>n Faktoren<br />
eines sich über das gesamte römische Reich erstrecken<strong>de</strong>n Straßennetzes und die Überwindung<br />
großer Entfernungen auf <strong>de</strong>m Seeweg <strong>zusammen</strong>kamen. In <strong>de</strong>n letzten bei<strong>de</strong>n Jahrhun<strong>de</strong>rten haben<br />
ein ständig verbesserter Güterverkehr sowie das Aufkommen elektrischer und elektronischer Kommunikationstechniken<br />
die Möglichkeit zu weltweitem persönlichem Kontakt von Menschen eröffnet.<br />
Gleichzeitig stellen die Medien heute Informationen weltweit ohne nennenswerte Zeitverzögerung<br />
zur Verfügung. Das hat die Entwicklung <strong>de</strong>r globalen Finanzmärkte ermöglicht, auf <strong>de</strong>nen zeitgleich<br />
agiert wird. Noch be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r sind jedoch vielleicht die kulturellen Auswirkungen. Diese neuen<br />
Möglichkeiten haben nämlich auch die Tür zur Globalisierung <strong>de</strong>r menschlichen Kultur geöffnet, was<br />
seinen beson<strong>de</strong>ren Ausdruck in <strong>de</strong>r Vereinheitlichung <strong>de</strong>r Jugendkultur – im Wesentlichen nach<br />
amerikanischem Standard – fin<strong>de</strong>t. Neben Kleidung, Musik, Filmen und Vi<strong>de</strong>os betrifft das auch<br />
Essen und Trinken. (Natürlich gibt es dagegen auch Wi<strong>de</strong>rstand, z. B. von westlichen Intellektuellen<br />
o<strong>de</strong>r von traditionalistischen religiösen Bewegungen wie <strong>de</strong>m Islam und <strong>de</strong>m militanten Hinduismus.)<br />
Dabei kann behauptet wer<strong>de</strong>n, dass auch das Christentum selbst als be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r kultureller Faktor<br />
<strong>de</strong>r Globalisierung unterliegt und dass beson<strong>de</strong>rs die Evangelikalen sich – grundsätzlich zu ihrem<br />
Vorteil – an <strong>de</strong>r globalen Nivellierung <strong>de</strong>r Kultur beteiligen. Biblisches Christentum ist ja in seinen<br />
Aussagen universell. Wir erwarten <strong>de</strong>n Tag, an <strong>de</strong>m die ganze Er<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Erkenntnis <strong>de</strong>s Herrn<br />
erfüllt ist, wie von Wassern, die das Meer be<strong>de</strong>cken. Wir folgen einem Retter, <strong>de</strong>ssen letzte Worte<br />
davon sprachen, dass ihm alle Autorität im Himmel und auf Er<strong>de</strong>n gegeben ist, und <strong>de</strong>r <strong>de</strong>shalb seine<br />
Jünger verpflichtete, weltweit alle Nationen zu erreichen. Es steht fest, dass es einen Tag geben wird,<br />
an <strong>de</strong>m ihn je<strong>de</strong>s Auge sehen und je<strong>de</strong>s Knie sich vor ihm beugen wird. Die Gemein<strong>de</strong> hat eine weltweite<br />
Aus<strong>de</strong>hnung: Sie muss Jesus bis an die äußersten En<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong> bezeugen und das Evangelium<br />
<strong>de</strong>r ganzen Schöpfung und allen Nationen predigen. Und die Gemein<strong>de</strong> versteht sich selbst als globale<br />
und universelle Gemeinschaft, <strong>de</strong>ren I<strong>de</strong>ntität alle lokalen, kommunalen und nationalen Beson<strong>de</strong>rheiten<br />
überbrückt, ohne sie abzuschaffen: Es gibt nur eine Kirche, <strong>de</strong>r je<strong>de</strong>r wie<strong>de</strong>rgeborene Christ<br />
angehört, ohne Rücksicht auf seine Abstammung o<strong>de</strong>r seinen kulturellen Hintergrund, ja sogar davon,<br />
ob er diese Tatsache anerkennt o<strong>de</strong>r nicht.<br />
Über die Herausfor<strong>de</strong>rungen biblischer Mission gibt es ein weltweit anerkanntes Verständnis <strong>de</strong>r<br />
Christenheit, nie<strong>de</strong>rgelegt in internationalen Verpflichtungen evangelischer Christen seit Beginn <strong>de</strong>r<br />
Mission zwischen 1650 und 1730. 1 Diese Vereinbarungen sind im Laufe <strong>de</strong>s globalen Wachstums <strong>de</strong>r<br />
1 Vgl. dazu W. R. Ward, The Protestant Evangelical Awakening, Cambridge 1992, und Early Evangelicalism: A Global Intellectual<br />
History, 1670–1789, Cambridge 2006. Einige Historiker versuchen allerdings zwischen europäischem Pietismus<br />
und evangelischem Christentum zu unterschei<strong>de</strong>n.
Neil Summerton: Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in weltweiter Sicht 56<br />
Evangelikalen und <strong>de</strong>r Pfingstbewegung neu überdacht wor<strong>de</strong>n. (Die Pfingstgemein<strong>de</strong>n sind unbestreitbar<br />
Bestandteil <strong>de</strong>r evangelikalen Bewegung, auch wenn manche Evangelikale das nicht anerkennen<br />
mögen.) In <strong>de</strong>n frühen Stadien <strong>de</strong>r evangelikalen Erweckung vor 250 Jahren gab es erst wenige<br />
Evangelikale, die weitestgehend auf Großbritannien und Nordamerika beschränkt waren. Heute sind<br />
die Evangelikalen eine weltweite Bewegung mit etwa 700–800 Millionen Christen. Die Umsetzung<br />
<strong>de</strong>r erwähnten Verpflichtungen zur weltweiten Mission wur<strong>de</strong> in hohem Maße durch die Globalisierung<br />
<strong>de</strong>s Güteraustauschs, <strong>de</strong>r elektronischen Kommunikation und <strong>de</strong>r westlichen Kultur in <strong>de</strong>n<br />
vergangenen 200 Jahren ermöglicht.<br />
Aus diesen Grün<strong>de</strong>n kann die Bewegung <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« als voll im Mainstream <strong>de</strong>r evangelikalen<br />
Bewegung liegend gesehen wer<strong>de</strong>n. Die »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« leisteten einen be<strong>de</strong>utsamen Beitrag zu<br />
dieser Entwicklung, sowohl in praktischer Hinsicht als auch in Bezug auf manche entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />
I<strong>de</strong>en und Praktiken, die das weltweite Wachstum von Evangelikalen und Pfingstbewegung geför<strong>de</strong>rt<br />
haben. Als wichtigste Beiträge sind hier die Prinzipien <strong>de</strong>r »Glaubensmission« und <strong>de</strong>s »Laiendienstes«<br />
zu erwähnen. Lei<strong>de</strong>r hat <strong>de</strong>r Trend zur Abson<strong>de</strong>rung bis hin zur Sektiererei, <strong>de</strong>r Teile <strong>de</strong>r Bewegung<br />
<strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« kennzeichnet (an manchen Orten haben Missionare dazu ermutigt), die<br />
Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung für die Gesamtgemein<strong>de</strong> ein Stück verdunkelt, sodass häufig die<br />
Gefahr einer konfessionellen, um nicht zu sagen sektiererischen 2 »Kleinstaaterei« entstand. Gemäß<br />
dieser Haltung besteht keine Notwendigkeit, sich darüber zu informieren, was weltweit bei Evangelikalen<br />
und Pfingstlern geschieht; es wird vielmehr als ziemlich gefährlich angesehen, sich damit zu<br />
beschäftigen, weil die Gefahr ekklesiologischer Verunreinigung bestehe. Daraus entspringt auch <strong>de</strong>r<br />
Wunsch, Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in gewissen Län<strong>de</strong>rn sogar vor <strong>de</strong>r Zusammenarbeit mit<br />
»Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« an<strong>de</strong>rer Län<strong>de</strong>r zu schützen. Diese Abson<strong>de</strong>rung wird durch die Betonung <strong>de</strong>r<br />
Sicht verstärkt, dass je<strong>de</strong> einzelne lokale Gemein<strong>de</strong> die einzige sichtbare Darstellung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong><br />
Christi auf Er<strong>de</strong>n sei. Die Existenz <strong>de</strong>r universellen Kirche wird zwar theologisch anerkannt, aber es<br />
wird geleugnet, dass man sie gegenwärtig sehen kann. Einige bezweifeln zusätzlich, ob die existenten<br />
konfessionellen Körperschaften überhaupt als akzeptabler Ausdruck <strong>de</strong>s Wirkens Gottes angesehen<br />
wer<strong>de</strong>n können. Sie zweifeln sogar an <strong>de</strong>r Legitimation von Jugendarbeit in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>.<br />
Aus meiner Sicht müssen solche Haltungen bekämpft wer<strong>de</strong>n, da sie sowohl die Erkenntnis als<br />
auch die praktische Erfahrung <strong>de</strong>r entschei<strong>de</strong>nd wichtigen Einheit <strong>de</strong>s Leibes Christi unterminieren,<br />
die unter allen bibeltreuen Christen gelebt wer<strong>de</strong>n sollte. Das war eine <strong>de</strong>r biblischen Schlüsselerkenntnisse<br />
<strong>de</strong>r frühen »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«. In <strong>de</strong>r Praxis behin<strong>de</strong>rn sie die Arbeit im Reich Gottes mit<br />
ihren vielfältigen Möglichkeiten.<br />
Der Hauptpunkt, <strong>de</strong>n man in diesem Zusammenhang erwähnen muss, ist aber, dass es heute in<br />
<strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« weltweit zwei große Trends gibt.<br />
Zunächst gibt es einen Einfluss <strong>de</strong>r Bewegung <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« selbst mit ihren Missionaren,<br />
die in <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>n Hauptkanal für diesen Einfluss bil<strong>de</strong>ten. Wenn man die ganze Welt betrachtet,<br />
kann man sagen, dass die anglo-keltischen Missionare außeror<strong>de</strong>ntlich erfolgreich waren, wenn<br />
es darum ging, <strong>de</strong>n von ihnen gegrün<strong>de</strong>ten Gemein<strong>de</strong>n eine mehr o<strong>de</strong>r weniger einheitliche geistliche<br />
Haltung, Eschatologie, Ekklesiologie und Gemein<strong>de</strong>praxis einzuimpfen. Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« sind bis heute durch eine überraschen<strong>de</strong> Einheitlichkeit in Lehre und Gemein<strong>de</strong>praxis gekennzeichnet,<br />
ohne die riesigen kulturellen Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n unterschiedlichen Kontinen-<br />
2 Unter »sektiererisch« soll im Unterschied zu »konfessionell« die Sicht verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, »wir« allein seien die<br />
Gruppe, <strong>de</strong>ren Ekklesiologie und Gemein<strong>de</strong>praxis wirklich richtig o<strong>de</strong>r biblisch sei, und alle an<strong>de</strong>ren seien entwe<strong>de</strong>r<br />
absolut falsch (d.h. nicht wirklich christlich) o<strong>de</strong>r so stark mit Irrtümern behaftet, dass ihre christlichen Glaubensüberzeugungen<br />
dadurch stark angezweifelt wer<strong>de</strong>n müssten. Eine Konfession sieht sich im Gegensatz dazu als<br />
unterscheidbare Gruppe unter an<strong>de</strong>ren Gruppen, die entwe<strong>de</strong>r als gleichwertig betrachtet o<strong>de</strong>r doch wenigstens<br />
unter biblischen o<strong>de</strong>r christlichen Aspekten akzeptiert wer<strong>de</strong>n. Interessant ist, dass einige Vertreter <strong>de</strong>r »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« die historisch gewachsenen protestantischen Konfessionen als »Sekten« bezeichnet haben, ein Standpunkt,<br />
<strong>de</strong>r nach meiner Definition nur als sektiererisch bezeichnet wer<strong>de</strong>n kann (auch wenn seine Vertreter dachten,<br />
dass gera<strong>de</strong> sie es waren, die damit die biblische Lehre von <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>r Kirche verwirklichten).
Neil Summerton: Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in weltweiter Sicht 57<br />
ten und Län<strong>de</strong>rn zu berücksichtigen. Das geht so weit, dass sie dazu neigen, überall dieselben Stärken<br />
und Schwächen zu zeigen. Mit Ausnahme einer Handvoll westlicher Län<strong>de</strong>r ist die Ähnlichkeit <strong>de</strong>r<br />
Gemein<strong>de</strong> mit einer großen Familie immer noch überall erkennbar.<br />
Der zweite große weltweite Einfluss geht von <strong>de</strong>n weltweiten Evangelikalen und beson<strong>de</strong>rs von<br />
pfingstgemeindlichen und charismatischen Richtungen aus. Vor allem bei jungen Leuten ist dieser<br />
Einfluss an <strong>de</strong>n erwähnten weltweiten kulturellen Mainstream gekoppelt. Tatsache ist nämlich, dass<br />
Christen (und damit auch »Offene <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«) in vielen Län<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Welt über Satellitenfernsehen<br />
Zugang zu einer breiten Vielfalt von Fernsehevangelisten und Fernsehlehrern haben, die sie nicht nur<br />
durch ihre Lehre beeinflussen, son<strong>de</strong>rn auch durch ihre Art von »Worship« und »Entertainment«.<br />
Diese Angebote wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Pfingstbewegung beherrscht, vor allem von <strong>de</strong>nen, die spezielle<br />
Positionen in Bezug auf Heilung, Reichtum und Wohlstand vertreten. Wegen <strong>de</strong>r unbestreitbaren<br />
Erfolge <strong>de</strong>r Pfingstbewegung bei <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>gründung in vielen Län<strong>de</strong>rn (im Jahrhun<strong>de</strong>rt nach<br />
1906 wuchsen die Pfingstgemein<strong>de</strong>n von 0 auf 400 Millionen Mitglie<strong>de</strong>r weltweit – wahrlich ein<br />
Phänomen!) sind an<strong>de</strong>re bibeltreue Christen in ständigem Kontakt mit ihnen und ihrer Art <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>praxis.<br />
Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« vergleichen ihr schwaches Abschnei<strong>de</strong>n häufig mit <strong>de</strong>n offensichtlichen<br />
Erfolgen <strong>de</strong>r Pfingstbewegung und <strong>de</strong>r Charismatiker. Hier soll we<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Erfolg <strong>de</strong>r unterschiedlichen<br />
Zweige <strong>de</strong>r Pfingstgemein<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r Ausweitung <strong>de</strong>s Reiches Gottes infrage gestellt<br />
wer<strong>de</strong>n noch ihr enormer sozialer Einfluss, <strong>de</strong>n sie an vielen Orten auf die Gesellschaft ausüben. Es<br />
geht vielmehr darum, auf die Ten<strong>de</strong>nz zur Gespaltenheit bei <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« an vielen Orten<br />
hinzuweisen.<br />
Ich möchte meinen Punkt durch ein Beispiel illustrieren. Ich besuchte eine Versammlung <strong>de</strong>r<br />
»Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« irgendwo in einem Land, das stark von <strong>de</strong>r amerikanischen Kultur und ihren Medien<br />
beeinflusst wird. Vor <strong>de</strong>m Gottesdienst gab es viel lebendiges Singen, das von zwei jüngeren<br />
Männern mit einem Keyboard in anerkennenswert mo<strong>de</strong>rner Weise geleitet wur<strong>de</strong>. Der »Worship<br />
Lea<strong>de</strong>r« hatte die Gabe, nahtlos von einem Lied zum an<strong>de</strong>ren überzuleiten und seinem Begleiter die<br />
entsprechen<strong>de</strong>n Einsätze zu geben. Die Gemein<strong>de</strong> kam mit Begeisterung zur Anbetung – aufrichtig,<br />
in Geist und Wahrheit, wie ich empfand. Zu einer festgelegten Zeit kam dann einer <strong>de</strong>r Ältesten auf<br />
die Bühne und kündigte mit ziemlich monotoner Stimme an, dass jetzt die »eigentliche Versammlung<br />
beginne« – mit einem alten Lied von Sankey, das von einem Harmonium begleitet wur<strong>de</strong>, mit<br />
katastrophalem Effekt auf die vorher so gute Atmosphäre <strong>de</strong>r Anbetung. Von da an folgte die Gemein<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>m unter <strong>de</strong>n »Versammlungen« weltweit üblichen Muster. Es war schon eine Herausfor<strong>de</strong>rung,<br />
danach in <strong>de</strong>r Predigt wirklich etwas zu erreichen. Der Kontrast zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n<br />
Kulturen hätte kaum spürbarer sein können. Es hätte auch nicht offensichtlicher sein können, welche<br />
Richtung die große Mehrheit <strong>de</strong>r anwesen<strong>de</strong>n Gläubigen bevorzugte. Unter diesen Umstän<strong>de</strong>n ist es<br />
kein Wun<strong>de</strong>r, dass viele einfach in eine an<strong>de</strong>re Richtung verschwin<strong>de</strong>n.<br />
Ähnliche Spannungen habe ich in mehr o<strong>de</strong>r weniger hohem Maß in vielen an<strong>de</strong>ren Län<strong>de</strong>rn<br />
beobachtet. Ich habe auch Gemein<strong>de</strong>leitungen gesehen, die nicht in <strong>de</strong>r Lage sind, die kulturellen<br />
Wünsche und Neigungen <strong>de</strong>r jüngeren Leute, die sich noch in ihren Gemein<strong>de</strong>n be<strong>fin<strong>de</strong>n</strong>, zu erkennen<br />
und sich darauf einzustellen. Diesen Leitungen stellt sich die wichtige Frage, ob sich ihre Gemein<strong>de</strong><br />
auch in 10 o<strong>de</strong>r 20 Jahren noch einer solchen Loyalität ihrer jungen Leute erfreuen kann,<br />
wenn die momentanen Leiter we<strong>de</strong>r die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Wechsels <strong>de</strong>r allgemeinen populären religiösen<br />
Kultur erkennen noch ihre starke i<strong>de</strong>ntifizieren<strong>de</strong> Wirkung auf die jüngere Generation o<strong>de</strong>r generell<br />
die starken Auswirkungen externer religiöser und kultureller Einflüsse. Man kann mit Recht<br />
behaupten, dass das frühe <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>tum eine neue religiöse Kultur geschaffen hat, die zu <strong>de</strong>n Bedürfnissen<br />
ihrer Zeit passte. Beson<strong>de</strong>rs bei <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« wur<strong>de</strong> diese religiöse Kultur dann mit<br />
<strong>de</strong>r populären Kultur <strong>de</strong>r anglo-keltischen Erweckungen verschmolzen. Aber wird das <strong>de</strong>n Ansprüchen<br />
aller Zeiten und Orte gerecht? Gemein<strong>de</strong>leiter müssen selbstverständlich versuchen, <strong>de</strong>n unterschiedlichen<br />
kulturellen Präferenzen in ihren Gemein<strong>de</strong>n Rechnung zu tragen, und zur gegenseitigen<br />
Barmherzigkeit aufrufen. Aber sie dürfen auf keinen Fall die Macht <strong>de</strong>r herrschen<strong>de</strong>n kulturellen<br />
Wünsche und Neigungen und die Gefahr, die davon auf ihre Gemein<strong>de</strong> ausgeht, unterschätzen.
Neil Summerton: Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in weltweiter Sicht 58<br />
Es stellt sich nun die kritische Frage, welcher <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n erwähnten globalen Trends heute einen<br />
größeren Einfluss auf die Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« ausübt. Mein Eindruck ist, dass es, wenn<br />
man alles <strong>zusammen</strong> betrachtet, <strong>de</strong>r zweite Einfluss ist.<br />
Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« heute<br />
1. Charakteristische Merkmale und Herausfor<strong>de</strong>rungen<br />
Bei weltweiter Betrachtung stellt man fest, dass die Bewegung <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« immer noch<br />
große Stärken aufweist.<br />
Sie ist immer noch von einer Lei<strong>de</strong>nschaft für Evangelisation, Gemein<strong>de</strong>gründung und transkulturelle<br />
Mission gekennzeichnet. Das ist in <strong>de</strong>r Tat ein wesentliches Element in <strong>de</strong>r DNA <strong>de</strong>r »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«. Im großen Ganzen bleiben die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« Leute <strong>de</strong>s Evangeliums. An vielen Orten<br />
verfolgen sie eine nach vorn gewandte Strategie in Bezug auf Gemein<strong>de</strong>wachstum und Mission. Beispiele<br />
dafür sind die min<strong>de</strong>stens 1000 Evangelisten, die im Kontext <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in Indien<br />
arbeiten; die Strategie zur Gemein<strong>de</strong>gründung, die die einheimischen Gemein<strong>de</strong>n im Tschad konsequent<br />
verfolgen; die Gemein<strong>de</strong>n in Sambia, die Missionare in vielen afrikanischen Län<strong>de</strong>rn und sogar<br />
darüber hinaus unterstützen. Diese Beobachtung kann man auch in vielen an<strong>de</strong>ren Län<strong>de</strong>rn machen,<br />
selbst wenn es nur wenige <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n gibt wie in <strong>de</strong>r Slowakei o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Staaten <strong>de</strong>s ehemaligen<br />
Jugoslawien.<br />
Abgesehen von einigen Ausnahmen in <strong>de</strong>n alten anglo-keltischen Län<strong>de</strong>rn (wo viele »progressive«<br />
Gemein<strong>de</strong>n Einzelne berufen und als »Pastoren« bezeichnen) gibt es immer noch eine strikte Weigerung,<br />
eine beson<strong>de</strong>re Gruppe von Einzelpersonen hervorzuheben, die sich durch <strong>de</strong>n Vorzug einer<br />
Ausbildung, beruflicher religiöser Qualifikationen und Erfahrungen o<strong>de</strong>r intensiveren geistlichen<br />
Lebens von an<strong>de</strong>ren unterschei<strong>de</strong>n, sodass sie die Last <strong>de</strong>s Gemein<strong>de</strong>lebens und <strong>de</strong>s Dienstes allein<br />
tragen. Im Gegenteil gibt es immer noch die Erwartung, selbst in <strong>de</strong>n erwähnten »progressiven«<br />
Gemein<strong>de</strong>n, dass die Leitung im Team erfolgen soll und dass je<strong>de</strong>r Gläubige entsprechend seinen<br />
Gaben Verantwortung für <strong>de</strong>n Dienst in allen seinen Varianten hat. Es gibt immer noch die Erwartung,<br />
dass je<strong>de</strong>s Gemein<strong>de</strong>glied seinen Beitrag zum Gemein<strong>de</strong>leben und zum Dienst leistet.<br />
An vielen Orten besteht ein elementares Interesse an Ausbildung, Training und Weiterentwicklung<br />
auf verschie<strong>de</strong>nen Stufen, um sicherzustellen, dass es einen Kreis von Männern und Frauen gibt,<br />
die besser für ihren Dienst ausgerüstet sind, auf welchem Gebiet auch immer. Man kann bei <strong>de</strong>n »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« also eine Neigung zu langfristiger Schulung feststellen – ein starker Gegensatz zu <strong>de</strong>r<br />
Angst vor Bildung, um nicht zu sagen Bildungsfeindlichkeit, die man ebenfalls noch an vielen Orten<br />
fin<strong>de</strong>t.<br />
Außerhalb <strong>de</strong>r anglo-keltischen Län<strong>de</strong>r und Europas beobachtet man als Teil <strong>de</strong>r Arbeit von Gemein<strong>de</strong>n<br />
und einzelnen Christen fast durchgängig ein starkes Engagement auf sozialem Gebiet, in<br />
Fürsorgemaßnahmen und Entwicklungsprojekten (beson<strong>de</strong>rs auf <strong>de</strong>n Gebieten <strong>de</strong>r Medizin, <strong>de</strong>s<br />
Schulwesens, <strong>de</strong>r Ausbildung und <strong>de</strong>r Fürsorge für Waisen). Solche Arbeiten geschehen normalerweise<br />
in kleinem Maßstab, vor Ort und im Stillen. Das stimmt mit <strong>de</strong>r Tradition <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«<br />
überein, die stark durch das Beispiel und die Lehre Georg Müllers beeinflusst wur<strong>de</strong>.<br />
2. Unterschiedlichkeit<br />
Wie man es von einer Bewegung erwartet, die in min<strong>de</strong>stens 130 Län<strong>de</strong>rn zuhause ist und ihre Wurzeln<br />
in verschie<strong>de</strong>nen europäischen Leitkulturen hat, gibt es bei <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« eine Fülle<br />
von Unterschie<strong>de</strong>n. Und in <strong>de</strong>r Tat erlaubt die gemeindliche Struktur <strong>de</strong>r »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« solche Unterschie<strong>de</strong>,<br />
för<strong>de</strong>rt sie sogar im positiven Sinn.<br />
Wie bereits festgestellt, ist die Stärke <strong>de</strong>r Bewegung in <strong>de</strong>n einzelnen Län<strong>de</strong>rn unterschiedlich. In<br />
einigen Län<strong>de</strong>rn gibt es viele lokale Gemein<strong>de</strong>n. Typischerweise jedoch sind die Bewegungen in <strong>de</strong>n<br />
einzelnen Län<strong>de</strong>rn klein, was die Notwendigkeit län<strong>de</strong>rübergreifen<strong>de</strong>r Kontakte erhöht. In <strong>de</strong>n alten<br />
anglo-keltischen Län<strong>de</strong>rn sind die I<strong>de</strong>ntitätskrise und <strong>de</strong>r gleichzeitige Rückgang <strong>de</strong>r konservativeren<br />
Gemein<strong>de</strong>n sehr ausgeprägt. An<strong>de</strong>rswo auf <strong>de</strong>r Welt haben die »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« kein Problem mit ihrer<br />
I<strong>de</strong>ntität, sie ist im Gegenteil eine Quelle <strong>de</strong>s Selbstbewusstseins und <strong>de</strong>r Stärke. Ein wichtiger spe-
Neil Summerton: Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in weltweiter Sicht 59<br />
zieller Grund <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntitätskrise in Großbritannien, Australien und Neuseeland war die starke Kritik<br />
in Presse und Fernsehen an <strong>de</strong>n exklusiven Raven-Taylor-<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n, die aufgrund <strong>de</strong>r Namensgleichheit<br />
zu Verwirrung und Verdächtigungen seitens an<strong>de</strong>rer Evangelikaler führte, sodass die »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in <strong>de</strong>r allgemeinen Öffentlichkeit praktisch allein stan<strong>de</strong>n. Einigen schien es daher wichtig<br />
für ihre evangelistischen Bemühungen, <strong>de</strong>n Namen »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« aufzugeben. Und wo es Zweifel an <strong>de</strong>r<br />
I<strong>de</strong>ntität gibt, ist <strong>de</strong>r Weg nicht mehr weit, dass Gemein<strong>de</strong>leitungen ihre Gemein<strong>de</strong> in an<strong>de</strong>re Gruppierungen<br />
integrieren, die erfolgreicher zu sein scheinen. Das ist schnell getan, allerdings gibt man<br />
damit die Unabhängigkeit <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> und die einfache Struktur <strong>de</strong>r Bewegung auf. (Das Gefühl,<br />
Teil von etwas Erfolgreichem zu sein, verbun<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r emotionalen Sicherheit, die daraus entspringt,<br />
ist in <strong>de</strong>r momentanen westlichen Kultur ein wichtiges psychisches Ziel.)<br />
Für die Organisation <strong>de</strong>r Ebene oberhalb <strong>de</strong>r Ortsgemein<strong>de</strong> sind unterschiedliche organisatorische<br />
Traditionen verantwortlich. Im anglo-keltischen Teil ist die Tradition durch freiwillige Bündnisse<br />
ohne staatlichen Einfluss nach <strong>de</strong>m Vorbild <strong>de</strong>r »Freibauern« und durch Misstrauen gegenüber starken<br />
Zentralregierungen geprägt. Daraus ergibt sich ein <strong>de</strong>utliches Misstrauen gegenüber <strong>de</strong>m Nutzen<br />
einer formalen Organisation o<strong>de</strong>r von Einrichtungen auf <strong>de</strong>r Ebene oberhalb <strong>de</strong>r Ortsgemein<strong>de</strong>n.<br />
Man ist davon überzeugt, dass die Gesundheit <strong>de</strong>r Bewegung in Gottes Hand liegt und nicht bei<br />
menschlichen Maßnahmen. In <strong>de</strong>n französisch sprechen<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn neigt man dagegen nicht zu<br />
solchen Vorbehalten gegenüber zentralen Organisationen, son<strong>de</strong>rn nimmt vielmehr die Vorteile<br />
wahr, die sie haben können. Hier erscheint es viel selbstverständlicher, die Gemein<strong>de</strong>n zu einer nationalen<br />
Organisation zu vernetzen, und man neigt dazu, über die entsprechen<strong>de</strong> englische Abneigung<br />
ein wenig <strong>de</strong>n Kopf zu schütteln. In konservativen und ehemaligen Ostblock-Län<strong>de</strong>rn sowie in<br />
ehemaligen Kolonien sind die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« gewohnt, eine formale zentrale Organisation zu<br />
haben, um <strong>de</strong>n Kontakt zur Regierung zu halten und die Aktivitäten <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n vor <strong>de</strong>m Staat zu<br />
vertreten. Diese kulturell unterschiedlichen Auffassungen über eine zentrale Organisation wirken<br />
sich auch auf die Haltung zu internationalen Beziehungen und auf die Bewertung weltweiter und<br />
kontinentaler Konferenzen für nationale geistliche Leiter aus.<br />
Es gibt auch erhebliche Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Lehre, sogar in Fragen <strong>de</strong>r Eschatologie und entsprechen<strong>de</strong>n<br />
dispensationalistischen Auffassungen, von <strong>de</strong>nen man eigentlich <strong>de</strong>nken wür<strong>de</strong>, dass sie für<br />
die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung charakteristisch seien. Selbst innerhalb <strong>de</strong>r »Standard-Eschatologie« hat es<br />
immer unterschiedliche Interpretationen gegeben, was in manchen Fällen heftige öffentliche o<strong>de</strong>r<br />
persönliche Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen verursachte. Es wur<strong>de</strong> für unterschiedliche eschatologische Zeittafeln<br />
und verschie<strong>de</strong>ne dispensationalistische Systeme gekämpft. Auf <strong>de</strong>r konservativen Seite <strong>de</strong>r<br />
Bewegung stan<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Dispensationalismus und eine futuristische Eschatologie außer Frage, soweit<br />
die Materie von ihren Anhängern wirklich verstan<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n war. Auf <strong>de</strong>r progressiveren Seite<br />
zumin<strong>de</strong>st <strong>de</strong>r jüngsten Generation wur<strong>de</strong>n eher die mo<strong>de</strong>rnen und traditionellen evangelikalen<br />
Positionen üblich. Auch <strong>de</strong>r Calvinismus gewann an Einfluss. Während in Fragen <strong>de</strong>r Trinität, Christologie<br />
und Soteriologie weitgehen<strong>de</strong> Übereinstimmung mit <strong>de</strong>n evangelikalen Positionen herrscht,<br />
hat die Bereitschaft, Unterschiedlichkeit auch auf <strong>de</strong>m lange sorgfältig gepflegten Gebiet <strong>de</strong>r Eschatologie<br />
zuzulassen, die erfor<strong>de</strong>rliche Authentizität <strong>de</strong>r Bewegung <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« gestärkt. Es hat<br />
sich eine Akzeptanz unterschiedlicher lehrmäßiger Positionen herausgebil<strong>de</strong>t, die man auf <strong>de</strong>m Gebiet<br />
<strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>praxis oft vergeblich sucht. Diese Akzeptanz galt sogar in schweren Krisenzeiten,<br />
z. B. wenn es manche Gemein<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Weltkriegen <strong>de</strong>m persönlichen Urteil einzelner Gläubiger<br />
überließen, ob sie am Militärdienst teilnahmen o<strong>de</strong>r nicht.<br />
Trotz all dieser Unterschie<strong>de</strong> und <strong>de</strong>r großen kulturellen Verschie<strong>de</strong>nheit zwischen <strong>de</strong>n einzelnen<br />
Gesellschaften und Län<strong>de</strong>rn gibt es unter <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in <strong>de</strong>r ganzen Welt<br />
doch eine bemerkenswerte Gleichartigkeit. Das zeugt von <strong>de</strong>r Gründlichkeit, mit <strong>de</strong>r die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>, die<br />
die verschie<strong>de</strong>nen Bewegungen ins Leben riefen, ihre Prinzipien weitergaben. Die grundsätzlichen<br />
Merkmale wur<strong>de</strong>n bereits behan<strong>de</strong>lt, sodass sie nicht erneut beschrieben wer<strong>de</strong>n müssen: die Verpflichtung<br />
zu Evangelisation, Gemein<strong>de</strong>gründung und transkultureller Mission, die Leitung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong><br />
durch ein Team von »Laien«, die breite Mitarbeit im Gemein<strong>de</strong>leben, <strong>de</strong>r Dienst aller Gemein<strong>de</strong>glie<strong>de</strong>r<br />
und die Be<strong>de</strong>utung einer bestimmten Gemein<strong>de</strong>praxis.
Neil Summerton: Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in weltweiter Sicht 60<br />
3. Herausfor<strong>de</strong>rungen<br />
Die Erwähnung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>praxis führt automatisch zu einer Auflistung beson<strong>de</strong>rer Herausfor<strong>de</strong>rungen,<br />
<strong>de</strong>nen sich die Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« heute stellen müssen.<br />
(a) Das erste, vermutlich am weitesten verbreitete Problem liegt im Traditionalismus bzw. in einem<br />
Phänomen, das als »Kanonisierung« von Einzelheiten <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>praxis bezeichnet wer<strong>de</strong>n<br />
könnte. Hier ist eine Gesetzlichkeit zu beobachten, die von <strong>de</strong>r Theologie und Ekklesiologie <strong>de</strong>r »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« eigentlich als prinzipiell unbiblisch abgelehnt wer<strong>de</strong>n müsste, aber an vielen Orten<br />
große Schwierigkeiten verursacht. Bestimmte Dinge im Gemein<strong>de</strong>leben, beson<strong>de</strong>rs wenn sie mit<br />
Anbetung und Dienst zu tun haben, gewinnen einen so hohen Stellenwert, dass sie fundamental und<br />
unverän<strong>de</strong>rlich wer<strong>de</strong>n. Oft erkennt man keinerlei Bereitschaft, Än<strong>de</strong>rungen o<strong>de</strong>r Abweichungen bei<br />
<strong>de</strong>n praktizierten Formen zuzulassen. Manchmal geht es bis in Details, z. B. bei <strong>de</strong>r Frage, ob Musikbegleitung<br />
erlaubt ist – überhaupt o<strong>de</strong>r beim Brotbrechen – o<strong>de</strong>r welche Art von Begleitung zulässig<br />
ist (Orgel o<strong>de</strong>r Klavier o<strong>de</strong>r Gitarre o<strong>de</strong>r Schlagzeug) o<strong>de</strong>r welches Lie<strong>de</strong>rbuch verwen<strong>de</strong>t wird o<strong>de</strong>r<br />
welcher Stil von Musik o<strong>de</strong>r Lie<strong>de</strong>rn angemessen ist. Manchmal geht es um möglicherweise be<strong>de</strong>utsamere<br />
Fragen, z.B. ob man beim Abendmahl nur einen gemeinsamen Kelch o<strong>de</strong>r zwei o<strong>de</strong>r mehrere<br />
gemeinsame Kelche o<strong>de</strong>r Einzelkelche benutzt. Manchmal geht es um die Frage, ob Anpassungen <strong>de</strong>r<br />
traditionellen Gemein<strong>de</strong>praxis zulässig sind, wenn man dadurch Evangelisation o<strong>de</strong>r Kontakte zur die<br />
Gemein<strong>de</strong> umgeben<strong>de</strong>n Gesellschaft ermöglicht. Manchmal stellt sich die Frage, ob sich Kultur, Lebensstil<br />
o<strong>de</strong>r die Atmosphäre <strong>de</strong>s Miteinan<strong>de</strong>rs entsprechend <strong>de</strong>m kulturellen Umfeld än<strong>de</strong>rn dürfen.<br />
Manchmal spielen alle diese Aspekte gleichzeitig eine Rolle.<br />
Es geht dabei um eine biblische Schlüsselfrage. Anscheinend können wir die ständige Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
Jesu mit <strong>de</strong>n Schriftgelehrten und Pharisäern o<strong>de</strong>r die Kapitel 10–15 <strong>de</strong>r Apostelgeschichte<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Brief an die Galater lesen, ohne dass wir auch nur anfangen zu verstehen, wie sehr<br />
diese Texte unsere eigene Gemein<strong>de</strong>praxis betreffen. Vor allem sind wir oft unfähig, <strong>de</strong>n ungeheuer<br />
hohen Grad von Freiheit im Gemein<strong>de</strong>leben zu erkennen, <strong>de</strong>n die Jerusalemer Gemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r in Antiochia<br />
zugestand, obwohl sie selbst kulturell in das Ju<strong>de</strong>ntum <strong>de</strong>s 1. Jahrhun<strong>de</strong>rts eingebettet war. Sie<br />
stimmte nämlich <strong>de</strong>m Rat <strong>de</strong>s Jakobus zu, »man solle die, welche sich von <strong>de</strong>n Nationen zu Gott<br />
bekehren, nicht beunruhigen, son<strong>de</strong>rn ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von <strong>de</strong>n Verunreinigungen<br />
<strong>de</strong>r Götzen und von <strong>de</strong>r Unzucht und vom Erstickten und vom Blut« (Apg 15,19f.). Im kulturellen<br />
Kontext waren das sehr beschränkte For<strong>de</strong>rungen, die durch die spätere neutestamentliche<br />
Belehrung teilweise sogar noch weiter eingeschränkt wur<strong>de</strong>n. Lei<strong>de</strong>r macht es die Gesetzlichkeit in<br />
Bezug auf Aspekte <strong>de</strong>s Gemein<strong>de</strong>lebens bei <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« oft jenen Menschen schwer, die<br />
einfach nur <strong>de</strong>m Herrn besser dienen wollen.<br />
Ein an<strong>de</strong>res Problem betrifft die Auslegung <strong>de</strong>r Schrift: Gibt das Neue Testament verbindliche<br />
Anweisungen zur Gemein<strong>de</strong>praxis, o<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n vielmehr Prinzipien vorgegeben, die es in ihrer<br />
Anwendung erlauben, das Gemein<strong>de</strong>leben in je<strong>de</strong>r Generation neu anzupassen? Häufig beobachtet<br />
man, dass Vorschriften bis in Einzelheiten hinein aus <strong>de</strong>r Praxis <strong>de</strong>r neutestamentlichen Gemein<strong>de</strong>n<br />
abgeleitet wer<strong>de</strong>n, um nicht zu sagen hineingelesen wer<strong>de</strong>n. Wo ist z. B. <strong>de</strong>r biblische Beleg dafür,<br />
dass die Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Neuen Testaments in ihren Zusammenkünften Musikinstrumente benutzten<br />
o<strong>de</strong>r nicht benutzten? Und wo ist <strong>de</strong>r Beleg, dass die Art, wie die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« traditionell das<br />
Abendmahl feiern, mit <strong>de</strong>r Praxis <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Neuen Testaments übereinstimmt? Es gibt in<br />
<strong>de</strong>r Tat nur wenig o<strong>de</strong>r gar keine Beschreibung, wie die Gemein<strong>de</strong>n das Abendmahl und die zugehörige<br />
Anbetung praktizierten. Was man allerdings erkennen kann, z. B. die Verbindung <strong>de</strong>r Mahlfeier<br />
mit einem Liebesmahl am Abend o<strong>de</strong>r die Art <strong>de</strong>r Zusammenkunft, auf die Paulus in 1Kor 14 hinweist,<br />
<strong>de</strong>utet darauf hin, dass die Gottesdienste im Neuen Testament völlig an<strong>de</strong>rs waren als praktisch<br />
alle Anbetungsstun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«. (Ich halte es übrigens für gut, dass das Neue Testament<br />
keine genaue Beschreibung <strong>de</strong>r damaligen Gottesdienste gibt, sonst hätte diese Praxis zu einer fixierten<br />
Liturgie in <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n aller Zeiten und Orte geführt.)<br />
(b) Das zweite Feld von Herausfor<strong>de</strong>rungen hat mit <strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« weitverbreiteten<br />
Annahme zu tun, dass sie ein einmalig perfektes Verständnis über die Wahrheiten von <strong>de</strong>r<br />
Gemein<strong>de</strong> bekommen hätten, also einen vollständigen Zugang zu <strong>de</strong>r Art, wie das Gemein<strong>de</strong>leben
Neil Summerton: Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in weltweiter Sicht 61<br />
praktiziert wer<strong>de</strong>n sollte. Bei solchen Gedanken – »unsere« Praxis sei besser als die aller an<strong>de</strong>ren und<br />
alle müssten mit »unserem« Gemein<strong>de</strong>verständnis übereinstimmen – han<strong>de</strong>lt es sich logischerweise<br />
um Sektiererei. Diese Sicht kann Hochmut zur Folge haben, was geistlich gesehen ein gefährliches<br />
Ergebnis ist. Aber sie bedingt auch ein statisches Konzept im Schriftverständnis. Es be<strong>de</strong>utet nicht<br />
nur, dass uns die vollständige Wahrheit offenbart wor<strong>de</strong>n ist, wir verstehen sie auch völlig und haben<br />
nichts mehr zu lernen, zumin<strong>de</strong>st insoweit das Leben und die Arbeit <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> betroffen sind.<br />
Das scheint die Belehrung <strong>de</strong>s Apostels Paulus zu ignorieren, dass wir zur gegenwärtigen Zeit nur<br />
stückweise erkennen und weissagen, dass unsere Sicht nur un<strong>de</strong>utlich ist, wie in einem antiken Spiegel<br />
(<strong>de</strong>r einfach aus einer blanken Metallplatte bestand), und dass unser Wissen nur unvollständig ist<br />
– mit <strong>de</strong>r nachteiligen Auswirkung, dass unser biblisches Verständnis momentan immer nur einen<br />
Bruchteil davon darstellt, was möglich ist (1Kor 13,8–12).<br />
Diese Auffassung lässt auch die dynamische Natur unseres Schriftverständnisses außer Acht, dass<br />
nämlich die Erkenntnis <strong>de</strong>r Wahrheit in <strong>de</strong>r Kirche prinzipiell und potenziell von Generation zu<br />
Generation zunehmen kann (wobei selbstverständlich auch die Möglichkeit einer Verkümmerung <strong>de</strong>r<br />
Erkenntnis besteht). So kündigte bereits John Robinson, ein englischer Puritaner, <strong>de</strong>n »Pilgrim Fathers«<br />
1620 bei ihrem Aufbruch in die Neue Welt an, dass noch mehr Licht aus Gottes heiligem Wort<br />
hervorbrechen wer<strong>de</strong>. Diese Warnung galt einer Gruppe, die dachte, sie hätten eine einzigartige Erkenntnis<br />
<strong>de</strong>r christlichen Wahrheit und seien dabei, in Neuengland eine perfekte christliche Gesellschaft<br />
zu grün<strong>de</strong>n. Man kann festhalten, dass die »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in <strong>de</strong>n 1830er und 1840er Jahren <strong>zusammen</strong><br />
mit an<strong>de</strong>ren zeitgenössischen Gruppen tatsächlich die Erkenntnis über Wesen und Praxis <strong>de</strong>r<br />
Kirche ausgeweitet haben. Aber man muss auch feststellen, dass z. B. das biblische und praktische<br />
Verständnis über das Wirken <strong>de</strong>s Heiligen Geistes und das Wesen und die Funktion <strong>de</strong>r geistlichen<br />
Gaben heute größer ist als vor 175 Jahren, teilweise auch dank <strong>de</strong>r Schwerpunkte <strong>de</strong>r Pfingstgemein<strong>de</strong>n<br />
und <strong>de</strong>r charismatischen Bewegung. Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« müssen die Notwendigkeit erkennen,<br />
von an<strong>de</strong>ren zu lernen, genauso wie sie an<strong>de</strong>re belehren sollen – selbst auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Wahrheit<br />
über die Gemein<strong>de</strong>.<br />
(c) Drittens gibt es ein weitverbreitetes Bedürfnis nach besserer Leiterschaft, sowohl in <strong>de</strong>n Ortsgemein<strong>de</strong>n<br />
als auch in <strong>de</strong>r gesamten nationalen und internationalen Bewegung. In Großbritannien<br />
geht dieser Mangel mit <strong>de</strong>m weitgehen<strong>de</strong>n Fehlen neuer Leiter in <strong>de</strong>r gesamten evangelikalen Bewegung<br />
einher. Doch unter <strong>de</strong>n »<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« gibt es ein spezielles Problem. Allzu häufig gehen Überlegungen<br />
von einer falschen Sichtweise aus, die entwe<strong>de</strong>r die Existenz <strong>de</strong>r Gabe <strong>de</strong>s Leiters verneint<br />
o<strong>de</strong>r behauptet, die Gemein<strong>de</strong> habe keine menschliche Leitung nötig, da Gott allein die Gemein<strong>de</strong><br />
ohne menschliche Hilfe o<strong>de</strong>r menschliches Eingreifen leite. Es ist hier nicht <strong>de</strong>r Platz, diese theologischen<br />
Positionen zu wi<strong>de</strong>rlegen, abgesehen von <strong>de</strong>r Feststellung, dass sie biblisch gesehen unsinnig<br />
sind. Die schwache Leitung bei <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« ist aber auch das Ergebnis <strong>de</strong>r Annahme, dass<br />
Leitung einfach »passiere« und daher keine Notwendigkeit bestehe, konkrete Schritte zu unternehmen,<br />
um Leiter zu ermutigen und zu entwickeln. Sie ist auch eine Folge <strong>de</strong>r gewohnheitsmäßigen<br />
Weigerung, überhaupt über biblische Leiterschaft nachzu<strong>de</strong>nken, neue Leiter zu i<strong>de</strong>ntifizieren, persönlich<br />
durch Mentoring zu betreuen, auszubil<strong>de</strong>n und zu entwickeln. Die Betonung, die heute in<br />
vielen Gesellschaften weltweit auf die Ausbildung und Entwicklung von Leitungspersönlichkeiten<br />
gelegt wird, hat glücklicherweise in vielen Län<strong>de</strong>rn unter jungen Leuten einen regelrechten Durst<br />
nach mehr Vorbereitung auf Leitungsaufgaben erzeugt. Daher ist es ermutigend zu sehen, dass auch<br />
die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« viele Anstrengungen unternehmen, um Mechanismen zur Ausbildung und<br />
Entwicklung von Leitern zu schaffen. Solche Mechanismen sind teilweise <strong>de</strong>n speziellen Bedürfnissen<br />
<strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung angepasst. Es liegt in <strong>de</strong>r Natur von Ausbildung und Training, dass man Zeit<br />
braucht, um Ergebnisse zu erzielen. Aber die Aufgabe ist so wichtig, dass man überall so schnell wie<br />
möglich beginnen muss.<br />
(d) Ein damit <strong>zusammen</strong>hängen<strong>de</strong>s Problem ist eine falsche Haltung <strong>de</strong>r Alten gegenüber <strong>de</strong>n<br />
Jungen an vielen Orten. Oft wollen die Älteren nur wi<strong>de</strong>rwillig ihre Macht aufgeben und <strong>de</strong>nken, es<br />
müssten viele Jahre vergehen, bis jemand schließlich reif genug sei, um einen wichtigen Dienst zu tun.<br />
Natürlich muss man an diesem Punkt vorsichtig sein. Trotz aller Lippenbekenntnisse <strong>de</strong>r westlichen
Neil Summerton: Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in weltweiter Sicht 62<br />
Welt in Bezug auf die Altersdiskriminierung triumphiert dort <strong>de</strong>r »Jugendkult«. In an<strong>de</strong>ren Kulturen<br />
ist <strong>de</strong>r umfassen<strong>de</strong> Respekt vor <strong>de</strong>m Alter sehr wichtig. Dort erwartet man aus Respekt, dass die Alten<br />
entschei<strong>de</strong>n und führen. Deshalb braucht man gutes kulturelles Einfühlungsvermögen. Dennoch<br />
bleibt die Tatsache bestehen, dass dynamische Fortschritte in religiösen Bewegungen in <strong>de</strong>r Regel von<br />
jungen Leuten ausgelöst wer<strong>de</strong>n und dass neue Bewegungen von Leuten im Alter zwischen 20 und 30<br />
Jahren ausgehen. John und Charles Wesley waren als Enddreißiger schon relativ alt, als sie bei <strong>de</strong>r<br />
Entstehung <strong>de</strong>r evangelikalen Erweckung im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt eine wichtige Rolle spielten. Die Jünger<br />
Jesu waren mit Sicherheit zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung selbst wur<strong>de</strong> von Leuten<br />
zwischen 20 und 30 ins Leben gerufen. Die Konsequenz, mit <strong>de</strong>r ältere Leute an <strong>de</strong>r Macht festhalten,<br />
hat unmittelbar zur Folge, dass viele junge Leute mit <strong>de</strong>m Potenzial und <strong>de</strong>r geistlichen Gabe <strong>de</strong>r<br />
Leitung sich verpflichtet fühlen, ihre Gabe an an<strong>de</strong>rer Stelle auszuüben. Sie können das in christlichen<br />
Werken und Aktionen o<strong>de</strong>r in an<strong>de</strong>ren Gemein<strong>de</strong>gruppierungen tun, wo sie bereits bemerkenswerte<br />
Dinge bewegt haben. Die Schwäche <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« ist oft eine direkte Folge dieses Effekts.<br />
Es ist wie im übrigen Leben: Verantwortliche Leiter müssen jüngere, begeisterte Nachfolger<br />
för<strong>de</strong>rn – und sie müssen wissen, wann sie Verantwortung abgeben.<br />
(e) Eine weitere charakteristische Herausfor<strong>de</strong>rung bil<strong>de</strong>n die Einschränkungen in Bezug auf die<br />
Beiträge und die Rolle <strong>de</strong>r Frauen. Die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung ist <strong>de</strong>swegen in Verruf geraten und wird<br />
belächelt, sogar von solchen evangelikalen Gruppen, die selbst Schwierigkeiten mit diesen Fragen<br />
haben. Und die Frustration, die Frauen an manchen Orten bei <strong>de</strong>n »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>n« emp<strong>fin<strong>de</strong>n</strong>, ist<br />
nur zu offensichtlich. Diese Frustration wird oft noch verstärkt durch die Wahrnehmung <strong>de</strong>r Defizite,<br />
<strong>de</strong>s schlechten Vorbilds und <strong>de</strong>r mangelhaften Leistungen <strong>de</strong>r Männer sowie dadurch, dass Männer<br />
häufig <strong>de</strong>nken, dass Frauen auf geistlichem Gebiet nicht wirklich zählen. Männer müssen sich nicht<br />
vor ihnen rechtfertigen, es gibt über diese Probleme keine wirkliche Kommunikation zwischen Männern<br />
und Frauen. Frauen wissen allzu oft, was man eigentlich tun müsste, und haben <strong>de</strong>n Wunsch, es<br />
auch auszuführen. Aber sie haben stillzusitzen, während die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong> es nicht o<strong>de</strong>r wenigstens nicht auf<br />
kompetente Weise schaffen.<br />
Das Ganze ist nicht so sehr eine Frage <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s »Hauptseins« o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r »Unterordnung«<br />
o<strong>de</strong>r davon, ob eine Frau Männer lehren kann o<strong>de</strong>r sollte, nicht einmal davon, ob sich Frauen auf<br />
hörbare Weise an <strong>de</strong>n Gottesdiensten beteiligen dürfen. Auf diese Punkte scheint sich die Diskussion<br />
zu fokussieren, wobei man die Benutzung von externem Schrifttum ausschließt. Die wirkliche<br />
Schwierigkeit liegt darin, dass die Frauen in <strong>de</strong>r Tradition <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« dazu neigen, eine<br />
Stellung und Rolle einzunehmen, die weit niedriger ist als in <strong>de</strong>r Schrift für sie vorgesehen. Sie wer<strong>de</strong>n<br />
als dritt- o<strong>de</strong>r viertklassige Christen angesehen, die geistlich gesehen nicht zählen. In<strong>de</strong>m man das<br />
Gespräch auf die Be<strong>de</strong>utung von drei kurzen Passagen in <strong>de</strong>n Briefen reduziert, lässt man die Ermutigungen,<br />
die Frauen an vielen an<strong>de</strong>ren Stellen für ihr geistliches Leben und ihren Dienst gegeben wer<strong>de</strong>n,<br />
einfach beiseite. Dazu gehören auch die Belehrungen <strong>de</strong>s Herrn und seine Haltung gegenüber<br />
Frauen. So neigt man dazu, Frauen als geistlich unbe<strong>de</strong>utend anzusehen. Man gesteht ihnen keine<br />
geistlichen Gaben zu, die sie zum Nutzen <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> einsetzen können, obwohl die meisten <strong>de</strong>r<br />
ungefähr zwanzig im Neuen Testament erwähnten Gaben ohne irgen<strong>de</strong>ine theologische Schwierigkeit<br />
von Frauen und Männern ausgeübt wer<strong>de</strong>n können. Rat und Seelsorge von Frauen wer<strong>de</strong>n z. B. nirgends<br />
ernsthaft in Zweifel gezogen. Die Abwertung von Frauen ist sowohl unbiblisch als auch unvernünftig.<br />
Oft lehnen die Gemein<strong>de</strong>n je<strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utsamen Beitrag von Frauen ab, obwohl Frauen typischerweise<br />
zwei Drittel <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r ausmachen. Mit einer neuen Haltung zu <strong>de</strong>n Frauen und ihren möglichen<br />
Beiträgen wür<strong>de</strong> sich in dieser Frage viel än<strong>de</strong>rn, ohne dass man sich durch die Fragestellungen<br />
fesseln lassen sollte, auf die sich die Diskussion in <strong>de</strong>r Regel konzentriert. Erfreulicherweise hat die<br />
weltweite Mission <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« über mehr als ein Jahrhun<strong>de</strong>rt Frauen eine Möglichkeit zu<br />
gesegnetem Dienst geboten, oft im Wi<strong>de</strong>rspruch zu <strong>de</strong>n Einschränkungen, die ihre Heimatgemein<strong>de</strong>n<br />
ihnen auferlegten.<br />
In diesem Zusammenhang muss man sicher die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s kulturellen Kontextes anerkennen:<br />
Was in <strong>de</strong>r westlichen Welt möglich und angemessen ist, wird z.B. in <strong>de</strong>r indischen o<strong>de</strong>r islamischen
Neil Summerton: Die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in weltweiter Sicht 63<br />
Gesellschaft noch lange nicht möglich und angemessen sein. Schnelle Verän<strong>de</strong>rungen in dieser Frage<br />
können vielmehr Skandale verursachen und die Ausbreitung <strong>de</strong>s Evangeliums behin<strong>de</strong>rn. Aber die<br />
geistliche Stellung <strong>de</strong>r Frau ist ein wichtiges Gebiet, auf <strong>de</strong>m die Belehrung <strong>de</strong>r Schrift und ihre Beispiele<br />
(beson<strong>de</strong>rs von Jesus) die kulturellen Gewohnheiten radikal verschoben haben. Und es gibt<br />
keinen Grund, warum die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« dahinter zurückbleiben sollten.<br />
Geistliche Kraft als Herausfor<strong>de</strong>rung?<br />
Noch eine letzte überall wichtige Frage soll behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n. Es ist die Frage nach <strong>de</strong>m Maß geistlicher<br />
Kraft, das die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung heute erfährt.<br />
Trotz <strong>de</strong>r erwähnten Schubkraft für Evangelisation und Mission und trotz <strong>de</strong>s dynamischen<br />
Wachstums, das die Bewegung in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts auf <strong>de</strong>n britischen Inseln<br />
und in einer Reihe an<strong>de</strong>rer Län<strong>de</strong>r erlebte, muss man die Frage stellen, ob die Bewegung <strong>de</strong>r »Offenen<br />
<strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« jemals die Art explosiven Wachstums durch Evangelisation erfahren hat, die z. B. die Pfingstbewegung<br />
<strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts charakterisierte. Wenn man viele Missionsberichte aus <strong>de</strong>m 19. o<strong>de</strong>r<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt o<strong>de</strong>r von heute o<strong>de</strong>r Gebetsbriefe von Evangelisten liest, gewinnt man in <strong>de</strong>r Regel<br />
<strong>de</strong>n Eindruck, dass es bei <strong>de</strong>n Bekehrungen nur ein wenig »tröpfelt«, hier ein bisschen und da ein<br />
bisschen. Auf vielen Schauplätzen scheinen die Gemein<strong>de</strong>n mehr von biologischem Wachstum o<strong>de</strong>r<br />
Transferwachstum zu profitieren als von Bekehrungswachstum. Das kann etwas mit <strong>de</strong>m im Wesentlichen<br />
intellektuellen Anspruch <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung zu tun haben o<strong>de</strong>r auch mit <strong>de</strong>r stark angemahnten<br />
Opferbereitschaft aller Gemein<strong>de</strong>glie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, verglichen mit <strong>de</strong>r mehr<br />
diese Welt betreffen<strong>de</strong>n Sicht, wie sie beispielsweise von <strong>de</strong>n Pfingstlern geboten wird. Außer<strong>de</strong>m ist<br />
festzustellen, dass die entwickelte westliche Welt, wo die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« im Nie<strong>de</strong>rgang begriffen<br />
scheinen, zurzeit generell ein zum Verzweifeln schwieriges Umfeld für christliche Arbeit bietet. Interessant<br />
ist, dass das einzige christliche Segment, das hier am Wachsen ist, anscheinend die Migrantengemein<strong>de</strong>n<br />
aus <strong>de</strong>r Zweidrittelwelt bil<strong>de</strong>n.<br />
Dennoch stellt sich die Frage, welche Resultate die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« aufzuweisen haben – bei<br />
ihrem zweifellos starken Engagement in Evangelisation und Mission, bei allen evangelistischen Aktivitäten<br />
und aller harten Arbeit, die sie vorbildlich geleistet haben. Warum hat sich in <strong>de</strong>n letzten zwei<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rten so wenig Erweckung unter ihnen ergeben? Warum haben die großen Anstrengungen<br />
in vielen Län<strong>de</strong>rn nur wenig Ergebnisse in Bezug auf die Anzahl an Gemein<strong>de</strong>n erzeugt? Warum<br />
bleibt die Arbeit insgesamt schwach, in manchen Fällen stagnierend? Warum gibt es so viele lokale<br />
Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>«, wo mit viel Disziplin relevante und treue Arbeit getan wird, man<br />
aber trotz<strong>de</strong>m nur wenig von <strong>de</strong>m erhofften Fortschritt erkennen kann? Wie kommt es, dass sie nicht<br />
ins »Wasser kommen können«, so ähnlich wie <strong>de</strong>r Mann am Teich von Bethesda? Wie kommt es,<br />
dass die »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« das bemerkenswerte Wachstum offenbar nicht erfun<strong>de</strong>n haben, im Vergleich<br />
zu an<strong>de</strong>ren evangelikalen Gruppen?<br />
Allerdings gilt das nicht überall. Wenn man alles in Betracht zieht, ent<strong>de</strong>ckt man in Äthiopien ein<br />
außeror<strong>de</strong>ntlich gut gegrün<strong>de</strong>tes und geordnetes Wachstum <strong>de</strong>r <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>gemein<strong>de</strong>n. In Burundi haben<br />
sich die Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« in <strong>de</strong>n letzten bei<strong>de</strong>n Jahrzehnten trotz Zusammenbruch<br />
und Bürgerkrieg vervielfacht. Im Sü<strong>de</strong>n Tansanias ist in <strong>de</strong>n letzten bei<strong>de</strong>n Generationen durch die<br />
Missionsarbeit von Wie<strong>de</strong>nest eine bemerkenswerte Arbeit entstan<strong>de</strong>n. Und seit 1960 gibt es ein<br />
großartiges Wachstum in Papua-Neuguinea unter <strong>de</strong>r Leitung <strong>de</strong>r »Offenen <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>« aus Australien<br />
und Neuseeland. Es gibt auch bemerkenswerte Zeugnisse christlicher Liebe bei <strong>de</strong>r Lin<strong>de</strong>rung von<br />
Krankheiten und <strong>de</strong>r Entwicklungshilfe, z. B. durch <strong>de</strong>n »Christian Mission Charitable Trust« in<br />
Chennai (Indien) und durch an<strong>de</strong>re, weniger bekannte Projekte, die <strong>de</strong>n Fußspuren Georg Müllers aus<br />
<strong>de</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt folgen. Es gibt keinen Zweifel, dass die <strong>Brü<strong>de</strong>r</strong>bewegung als Ganzes von diesen<br />
Beispielen lernen muss. Deshalb ist noch mehr internationale Vernetzung gerechtfertigt und notwendig.
Die Kasseler Erklärung<br />
Foto: Jesaja / photocase.com