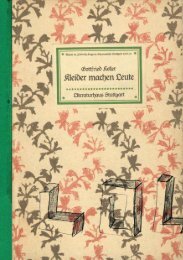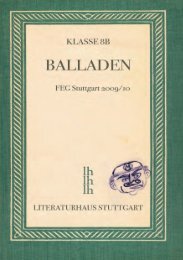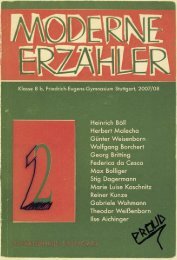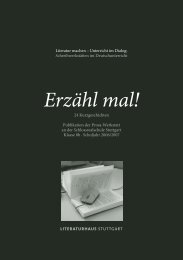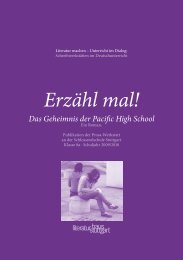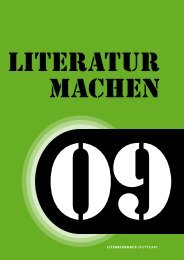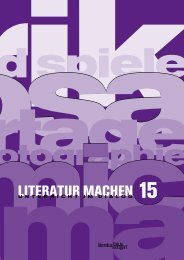Anspannung vor jeder nachricht - Literaturmachen
Anspannung vor jeder nachricht - Literaturmachen
Anspannung vor jeder nachricht - Literaturmachen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 8 Bulletin N– o 05 – Zeitung für Reportagen – Literaturhaus Stuttgart und Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart – Schuljahr 2010/2011 Bulletin N– o 05 – Zeitung für Reportagen – Literaturhaus Stuttgart und Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart – Schuljahr 2010/2011 Seite 9<br />
Kalt und ungemütlich ist es auf dem grauen<br />
Marienplatz. Zur linken Seite ist eine Baustelle,<br />
auf der demnächst ein neues Café<br />
entstehen soll. Zur rechten sind die eingangsschächte<br />
zur u-Bahnstation. Langsam<br />
versammeln sich die gäste um einen Mitarbeiter<br />
der Straßenzeitung trottwar.<br />
Der Stadtführer, er stellt sich als Heinz Lüttgens<br />
<strong>vor</strong>, ist ein freundlich aussehender, 51<br />
Jahre alter Mann, der sehr lebhaft und fesselnd<br />
erzählt. Auch er lebte einmal auf der Straße,<br />
kämpfte sich, nachdem er seine Beteiligung<br />
einer Firma an seine Frau verloren hatte, von<br />
Stadt zu Stadt, bis er eine Anstellung bei Trottwar<br />
fand, und kann so, wie alle Mitarbeiter, aus<br />
eigener Erfahrung sprechen.<br />
Er fängt an, über den Marienplatz zu erzählen.<br />
Früher war dieser eine Grünanlage mit Rasen,<br />
Büschen, Bäumen, Parkbänken und einem<br />
Kiosk, jetzt ist er nur noch ein riesiger, mit<br />
grauen Steinplatten belegter Platz. Er wurde<br />
umgebaut, wegen der vielen Obdachlosen. Laut<br />
Lüttgens war es der Streife wohl zu anstrengend,<br />
aus dem Auto zu steigen und hinter die<br />
Büsche zu schauen. Auch die U-Bahn-Station<br />
wurde mit Gittern versehen, damit sich dort<br />
nachts niemand mehr aufhalten kann.<br />
Über die Hauptstätter Straße gelangt man zur<br />
nächsten Station. Erstaunt erfährt man, was<br />
sich hinter der unscheinbaren Fassade befindet,<br />
an der tagtäglich hunderte Passanten <strong>vor</strong>beigehen.<br />
Das Winternotquartier ist genau das, was<br />
der Name schon sagt. Hier dürfen sich Obdachlose<br />
eine Nacht lang aufhalten, um dem Erfrieren<br />
zu entkommen. Eine Nacht, dann müssen<br />
Grau in Grau: Kaum <strong>vor</strong>stellbar, dass es auf<br />
dem Marienplatz einmal Rasen und Büsche gab<br />
Elinor Kath<br />
Zwischen Schule<br />
und Beruf<br />
Ein Besuch bei einem Zivildienstleistenden<br />
Lange war Kriegsdienstverweigerung die lästige<br />
Haltung einer Randgruppe. In der Bundesrepublik<br />
Deutschland steht schon im<br />
Nico Beck<br />
Die Kehrseite<br />
der Medaille<br />
Die Straßenzeitung „Trottwar“ bietet<br />
eine alternative Stadtführung durch weniger<br />
schöne „Sehenswürdigkeiten“ Stuttgarts an.<br />
sie wieder gehen. Es gibt weder Frühstück noch<br />
finanzielle Hilfe. Die Einrichtung ist zweckmäßig<br />
und spartanisch. Die Tapete ist feuerfest,<br />
die Möbel sind aus Metall. Bett, Tisch, Stuhl;<br />
das muss reichen. Zusätzliche Einrichtungsgegenstände<br />
gingen nur kaputt.<br />
Nun gelangt die Führung bei der Redaktion von<br />
Trottwar an. Sie liegt in einem kleinen Reihenhaus<br />
in einer Nebengasse und nimmt zwei<br />
Stockwerke ein. Im unteren befindet sich ein<br />
gemütlicher Aufenthaltsraum neben einer kleinen<br />
Küche. Der Raum wird fast gänzlich von<br />
einem großen, runden Tisch eingenommen. Auf<br />
ihm liegen Prospekte und Broschüren der Straßenzeitung.<br />
Drum herum hängen Pinnwände.<br />
In diesen Raum erzählt Heinz Lüttgens alles<br />
über die Zeitung Trottwar und beantwortet Fragen.<br />
Die 1994 gegründete Straßenzeitung soll Obdachlosen<br />
helfen, eine feste und sichere Arbeit<br />
zu bekommen. Je nach Anzahl der verkauften<br />
Zeitungen steigt man langsam auf, bekommt einen<br />
höheren Lohn und andere Vergünstigungen.<br />
In der ersten Stufe, als freier Verkäufer, werden<br />
die Zeitungen zum halben Preis von Trottwar<br />
gekauft. Der Verkäufer bekommt so die Hälfte<br />
des Gewinnes. In der höchsten Stufe, als fester<br />
Verkäufer, muss man die Zeitungen nicht mehr<br />
Trottwar abkaufen. Man erhält einen festen<br />
Monatslohn, wenn man eine bestimmte Anzahl<br />
verkauft. Außerdem wird eine Wohnung von<br />
der Zeitung finanziert. Auch für ein würdiges<br />
Begräbnis sorgt Trottwar. Laut Gesetz stehen<br />
den Armen nur Massengräber zu. All dies kostet<br />
natürlich und lässt sich niemals nur durch den<br />
Verkauf bezahlen. Trottwar ist auf die Spendebereitschaft<br />
reicherer Bürger angewiesen.<br />
Grundgesetz, kein Mann dürfe zum Dienst an<br />
der Waffe gezwungen werden. Heute steht im<br />
Artikel 12a des Grundgesetzes: „(1) Männer<br />
können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr<br />
an zum Dienst in den Streitkräften (…) verpflichtet<br />
werden. (2) Wer aus Gewissensgründen den<br />
Dienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem<br />
Ersatzdienst verpflichtet werden. (…)“<br />
Zivildienststellen gibt es viele, alle mit verschiedenen<br />
Aufgabenbereichen. Als Altenpfleger,<br />
Hausmeister, Kindergärtner oder im<br />
Krankenhaus. Die Liste ist lang. Auch manche<br />
Privatpersonen mit Behinderung beschäftigen<br />
Zivis, anders könnten sie ihren Alltag nicht<br />
„Als wir die Idee der Stadtführung hatten, haben<br />
wir erst einmal nach solchen Orten gesucht<br />
und waren überrascht, wie viele es davon gibt<br />
und wie dicht sie beieinander liegen.“ (Helmut<br />
Schmidt, Geschäftsführer von Trottwar)<br />
Tatsächlich ist die schiere Anzahl der sozialen<br />
Einrichtungen, die in einem in wenigen Stunden<br />
begehbaren Gebiet liegen, überwältigend.<br />
Man fängt an, sich zu fragen, warum so etwas<br />
in Deutschland, einem der reichsten Länder der<br />
Welt, nötig ist.<br />
Außer den bereits erwähnten Stationen lernt<br />
man auch noch acht weitere Orte kennen. So<br />
zum Beispiel auch die Franziskaner Stube, hier<br />
gibt es kostenlos Frühstück, oder die Pauls-<br />
kirche in der Nähe des Charlottenplatzes. In<br />
ihrem beheizten Saal können sich Obdachlose<br />
tagsüber aufhalten und ein billiges Mittagessen<br />
erhalten.<br />
Die Stadtführung endet auf dem Marienplatz.<br />
Das Gesehene und Gehörte versetzt einen in<br />
wahrhaft düstere Stimmung, die durch den<br />
Ort noch gesteigert wird. Grau, langweilig und<br />
monoton reiht sich Stein an Stein. Grau, genau<br />
wie die dunkle Wolkendecke, die von der untergehenden<br />
Sonne nur ein düsteres Dämmerlicht<br />
übrig lässt. Hier scheint es kein Leben zu geben,<br />
keine Hoffnung.<br />
Doch die geschäftigen Leute gehen darüber<br />
hinweg, als wollten sie die Trostlosigkeit und<br />
Kargheit unter ihren Füßen nicht sehen. Denn<br />
einfach wegzuschauen, so zu tun, als würde<br />
man es nicht bemerken, ist der bequemste Weg,<br />
sich <strong>vor</strong> sich selber zu rechtfertigen. Bedrohlich<br />
ballen sich die Wolken zusammen. Die ersten<br />
Regentropfen fallen auf den Marienplatz.<br />
Heinz Lüttgens zeigt seinen Zuhörern<br />
eine andere, dunklere Seite von Stuttgart<br />
bewältigen. Außerdem muss nur ein Teil des<br />
Soldes bezahlt werden, den größten Teil zahlt<br />
der Staat. Ohne Zivis könnten viele Einrichtungen<br />
nicht bestehen, <strong>vor</strong> allem Diakonie oder<br />
Caritas.<br />
Patrick Hoffmann ist Zivildienstleistender im<br />
Evangelischen Jugendwerk Kirchheim/Teck,<br />
kurz „ejKi“. Für ihn war die Frage, ob Zivildienst<br />
oder Bund, immer klar. Er hatte nichts<br />
gegen den Dienst an der Waffe, aber gegen<br />
den Umgang in der Bundeswehr: „Du kommst<br />
zu spät, mach mal 20 Liegestützen. Und dann<br />
mach gleich noch mal 10, ich mag dein Gesicht<br />
nicht. Das muss nicht sein.“<br />
Im ejKi ist das alles ganz anders. „Ich bin hier<br />
aufgewachsen, alles ist vertraut. Und ich dachte,<br />
ich kenne das Jugendwerk. Aber wie gesagt,<br />
ich dachte.“ Der Zwanzigjährige kann seine<br />
Tätigkeit am besten mit „Hausmann“ erklären,<br />
mit vielfältigen Aufgaben: Einkaufen, Post verteilen,<br />
Mails beantworten, aufräumen und sortieren,<br />
Kurierdienste, bei größeren Aktionen<br />
mitarbeiten. „Ich bin ein Mädchen für alles“,<br />
werde ich aufgeklärt.<br />
Das ejKi organisiert Zeltlager, Konficamps und<br />
Freizeiten allgemein, Jugendgottesdienste und<br />
sonstige Veranstaltungen oder Aktionen. Die<br />
Zelte, Feldbetten, die Technik, kurz: alle Materialien<br />
sind fein säuberlich in den Lagern hier<br />
einsortiert. Diese auf Fehlstellen zu überprüfen,<br />
zu pflegen oder den Verleih zu überwachen<br />
oder zu koordinieren, ist eine seiner umfangreichen<br />
Aufgaben.<br />
In der Verwaltung gibt es auch viel zu tun. Hier<br />
wird geplant, besprochen. Oft kommt aber auch<br />
einfach jemand <strong>vor</strong>bei und bleibt auf einen Kaffee.<br />
„Und den Kaffee mache ich dann zum Beispiel“,<br />
schmunzelt Patrick.<br />
Patrick Hoffmann ist mit seiner<br />
Zivi-Stelle zufrieden und sieht sich als<br />
„Hausmeister“ und „Mädchen für alles“<br />
Die frage, ob man mit dem essen spielt, hat<br />
Molekularkoch Bastian Pfeifer für sich selbst<br />
längst beantwortet. Der ehemalige Sternekoch<br />
gibt Kochkurse, in denen er mit Hilfe<br />
von Stickstoff und anderen chemischen<br />
Substanzen die form von Lebensmitteln von<br />
grund auf verändert.<br />
Als Bastian Pfeifer <strong>vor</strong> vier Jahren an einem<br />
Kochseminar in Frankfurt teilnahm, fand er<br />
sein Hobby und seinen Job: die Molekularküche.<br />
Molekularküche oder auch Molekular-<br />
gastronomie ist das Umstrukturieren von Lebensmitteln.<br />
So gibt es zum Beispiel ein Gericht<br />
namens Melonenkaviar, das mit Hilfe des<br />
chemischen Stoffes Kalzid hergestellt wird. Diese<br />
Speise sieht aus wie Kaviar, schmeckt aber<br />
fruchtig wie eine Melone.<br />
Der Melonenkaviar ist sehr beliebt bei den Gästen,<br />
genau wie die Fruchtpüree-Sorbets, welche<br />
gerne <strong>vor</strong> den Gästen zubereitet werden. Sie<br />
werden in flüssigen Stickstoff gehalten. Sehr<br />
zur Belustigung der Zuschauer entsteht dabei<br />
Dampf. Durch den Stickstoff gefrieren die Sorbets<br />
sofort. Manchmal können dabei sogar Teile<br />
der Zunge etwas gefrieren.<br />
Die Erfindung der Molekularküche geht auf<br />
Ferran Adrià zurück, einen Spanier, welchem<br />
beim Anblick eines Fruchtschaumes eine ungewöhnliche<br />
Idee kam. Er übertrug die Technik<br />
des Schaummachens einfach auf andere<br />
Lebensmittel und erfand neue Kreationen, wie<br />
zu Olivenöl geformte Bonbons oder Salzstreuer,<br />
die einen besonders aromatischen Kunstnebel<br />
verströmen. Erstaunlich ist, dass man zum Kochen<br />
von molekularen Speisen keine Küche mit<br />
Zivildienst ist eine sowohl sinnvolle als auch<br />
lohnenswerte Idee. Warum soll sie dann ausgesetzt<br />
werden? Eigentlich wird der Wehrdienst<br />
ausgesetzt. Der Zivildienst ist aber nur als Ersatzdienst<br />
<strong>vor</strong>gesehen. Daher: Kein Wehrdienst,<br />
kein Zivildienst.<br />
Viele, oft ehrenamtliche Einrichtungen sehen<br />
sich <strong>vor</strong> einem Problem: Woher in Zukunft Arbeitskräfte<br />
bekommen? Die Zivildienstleistenden<br />
werden ja zum größten Teil vom Staat be-<br />
Philipp Rasspe<br />
Mit essen spielt<br />
man nicht?<br />
Bei Molekularkoch Bastian Pfeifer<br />
gleicht die Küche einem Labor<br />
besonderen Geräten braucht. So finden Pfeifers<br />
Kochkurse in einer ganz normalen Großküche<br />
statt. Töpfe und Pfannen reihen sich aneinander,<br />
zahlreiche Schneebesen, Kochlöffel und<br />
Schöpfkellen hängen an der Wand. Es riecht<br />
nach frischen Kräutern und gebratenem Fisch.<br />
„Die Gerichte, die ich zubereite, sind ja nicht<br />
vollständig molekular“, so Bastian Pfeifer. „Lediglich<br />
das, was dem Gericht den letzten Schliff<br />
gibt, stammt aus der molekularen Trickkiste.“<br />
Denn die Molekularküche unterscheidet sich<br />
lediglich in wenigen Zutaten vom normalen<br />
Kochen. So stehen in einem kleinen Regal<br />
chemische Substanzen wie Stickstoff, Kalzid,<br />
Algin, Patazeta oder Agar.<br />
Viele Menschen glauben, dass der Einsatz dieser<br />
biochemischen Mittel gefährlich ist. Diese<br />
Zweifel sind jedoch unbegründet. Molekularküche<br />
ist weder giftig noch gefährlicher als die<br />
herkömmliche Küche. „Mein Lieblingsgericht?“,<br />
lacht Bastian Pfeifer. „Das werde ich oft gefragt.“<br />
Dann erzählt er von einem brausearti-<br />
gen Pulver von Stecknadelkopfgröße, das auf<br />
der Zunge knistert.<br />
zahlt, und daher geschickt. Als Ersatz soll es<br />
nun den Bundesfreiwilligendienst (BFD) geben<br />
oder FSJ. FSJ-Stellen werden allerdings nicht<br />
vom Staat bezahlt, BFD-Stellen zum Teil. Durch<br />
die Doppeljahrgänge im Abi wird der Andrang<br />
für FSJ die nächsten Jahre jedoch wohl kaum<br />
allzu groß sein. „Aber es lohnt sich“, meint<br />
mein Gesprächspartner. „Es lohnt sich wirklich.<br />
Man lernt viele interessante Menschen und<br />
Tätigkeiten kennen.“<br />
Für den eigenen Gebraucht zu Hause eignet<br />
sich die Molekularküche jedoch nicht, da das<br />
Herstellen lange Zeit braucht und sehr aufwendig<br />
ist. „Mir gefallen auch die traditionellen<br />
Gerichte, die ich für mich zu Hause koche. Da<br />
koche ich wie <strong>jeder</strong> andere auch.“ Das hat seinen<br />
Grund, denn der Aufwand beim Molekularkochen<br />
ist in etwa doppelt so groß. Wenn man<br />
für ein normales Restaurant vier Köche benö-<br />
tigt, so braucht man für ein molekulargastronomisches<br />
Restaurant gleicher Größe mindestens<br />
acht Köche.<br />
Ein gutes Beispiel für diese aufwendige Art zu<br />
kochen ist die Idee, ein Schnitzel in flüssiger<br />
Form anzubieten. Bastian Pfeifer erklärt, dass<br />
man das Schnitzel langsam in Kalbsbrühe aufkochen<br />
muss. Die Brühe soll den Geschmack des<br />
Schnitzels annehmen. Und damit nicht genug:<br />
Der Molekularkoch geht noch einen Schritt<br />
weiter. Er möchte das Schnitzel wieder in seine<br />
ursprüngliche Form bringen. Dazu muss er die<br />
Brühe mit Hilfe von Agar zu einem Gelee binden,<br />
und dieses dann wieder in Schnitzelform<br />
bringen. So hätte man ein Gericht, das wie ein<br />
Schnitzel aussieht, wie ein Schnitzel schmeckt,<br />
aber gar kein Schnitzel mehr ist. „Viele Leute<br />
halten diese Idee für verrückt, aber mir macht<br />
es Spaß, aus herkömmlichen Produkten neue<br />
Dinge zu schaffen, die voller Überraschungen<br />
stecken“, lässt Bastian Pfeiffer wissen.<br />
Bastian Pfeifer findet: „Molekularküche ist<br />
mehr Kunst als Kochen.“ Damit liegt er ganz<br />
nahe bei Adriàs Einstellung. Auch der Begründer<br />
des molekularen Kochens sah sein Restaurant<br />
sowohl als Bühne als auch als Form der Kommunikation<br />
– und eben nicht als Geschäft.