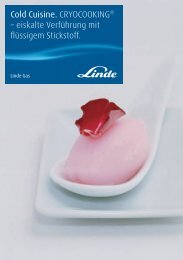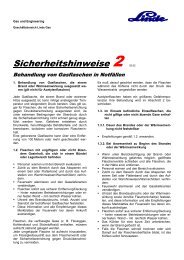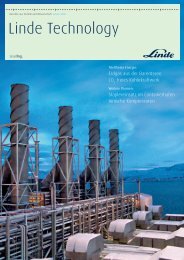Download Linde Technology 1 | 2008 (PDF 2,5 - Linde Gas
Download Linde Technology 1 | 2008 (PDF 2,5 - Linde Gas
Download Linde Technology 1 | 2008 (PDF 2,5 - Linde Gas
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
stehen selbst in hoch industrialisierten Ländern wie England nur<br />
wenige solcher Kammern zur Verfügung und eine wochenlange Nutzung<br />
wäre extrem teuer. Zum anderen würden sich für ein solches<br />
Experiment wohl nur wenige Freiwillige finden. Denn: Wer will sich<br />
schon wochenlang mit wildfremden Menschen in eine enge Kammer<br />
einsperren lassen – ohne eine Chance, sich irgendwann einmal<br />
zurückzuziehen? „Eine solche Studie wäre vielleicht für Psychiater<br />
interessant“, sagt Grocott leicht schmunzelnd, „für uns aber wenig<br />
hilfreich“.<br />
Eine Tour auf den Mount Everest dagegen bietet gleich in<br />
mehrfacher Hinsicht optimale Bedingungen. Mit zunehmender Höhe<br />
nimmt nicht nur der Sauerstoffgehalt der Luft kontinuierlich ab: Auf<br />
5.300 Metern Höhe beträgt er nur noch die Hälfte des Wertes auf<br />
Meereshöhe, am Gipfel sogar nur noch ein Drittel. Während des Aufstiegs<br />
konnten die Forscher auch kontinuierlich<br />
untersuchen, wie sich der Körper der Probanden<br />
„DIE SAUERSToFF-<br />
MENGEN IM BLUT<br />
SIND AUF DEM<br />
MoUNT EVEREST<br />
VIEL NIEDRIGER<br />
ALS ERWARTET.“<br />
nach und nach auf den Sauerstoffmangel einstellt<br />
und verändert.<br />
Nach Teilnehmern mussten die Forscher<br />
nicht lange suchen. Schon nach kurzer Zeit hatten<br />
sich mehr Interessierte gemeldet, als die Wissenschaftler<br />
mitnehmen konnten. Die glücklichen<br />
„Auserwählten“ – eine Gruppe von 200 Männern<br />
und Frauen im Alter von 18 bis 73 Jahren – durchliefen<br />
zunächst einen Tag lang mehrere Tests, um<br />
den Stoffwechsel ihres Körpers auf Meereshöhe<br />
zu bestimmen. Jeder der Probanden wurde dabei von Kopf bis Fuß<br />
durchgecheckt: Mit Hilfe spezieller Infrarotmessgeräte bestimmten die<br />
Forscher die Durchblutung des Gehirns und der Muskeln, sie maßen<br />
die Fließgeschwindigkeit des Blutes, prüften per Ultraschall die Funktion<br />
der Lungenarterien und setzen die Teilnehmer schließlich auf ein<br />
Ergometer, auf dem sie bis an ihre absolute Leistungsgrenze strampeln<br />
mussten.<br />
Für manch einen Hobby-Sportler unter den Teilnehmer war<br />
allein der Check auf dem Ergometer schon eine neue Erfahrung.<br />
„Ich ging schon damals drei bis vier Mal pro Woche ins Fitness-<br />
studio“, erzählt Greg McNeill, Public Relations Manager bei <strong>Linde</strong>,<br />
der als Versuchsperson ebenfalls an den Testreihen in England teilgenommen<br />
hat. „Erst durch die Studie habe ich aber erfahren, dass<br />
meine maximale Leistungsgrenze viel höher liegt, als ich dachte. Normalerweise<br />
pusht man seinen Körper einfach nicht so weit über die<br />
Komfortzone hinaus, dass man an diese Grenze herankommt“, so<br />
McNeill.<br />
Kurze Zeit später hieß es für alle „Caudwell Xtreme Everest“–<br />
Teilnehmer: auf nach Nepal, zum ersten „mobilen Labor“ in Kathmandu<br />
– 1.400 Meter über dem Meeresspiegel. Was wie eine entspannte<br />
Reise klingt, setzte jedoch auch logistische Höchstleistungen<br />
voraus. Denn für ihre Expedition brauchten die Forscher nicht nur Klei-<br />
auTOrIN:<br />
cornelia Stolze arbeitet als freie Wissenschafts- und Medizinjournalistin<br />
in hamburg und schreibt unter anderem für „zeit“, „Stern“ und<br />
„Süddeutsche zeitung“.<br />
mOuNT EVErEsT // LINDE TECHNOLOGY<br />
31<br />
dung, Zelte, Verpflegung und ein komplettes Set an bergsteigerischem<br />
Equipment. Sie mussten auch Ergometer, Messgeräte, Computer und<br />
die komplette Technik für alle medizinischen Untersuchungen in den<br />
Himalaja befördern. Insgesamt eine 26 Tonnen schwere Fracht von<br />
900 Containern, deren Inhalt zum Mount Everest zu befördern war.<br />
Außer in Kathmandu waren auch mobile Labore auf 3.400 Metern und<br />
4.200 Metern sowie am Basislager (5.300 Meter) zu errichten. „Das<br />
Schwierigste daran“, erzählt Mac Mackenny, im Team für die Logistik<br />
zuständig, „war sicherzustellen, dass jedes Teil am richtigen Ort landete.<br />
Wenn wir aus Versehen etwas ins Base Camp geschickt hätten,<br />
das in Kathmandu sein sollte, hätte es zwei Wochen gedauert, es<br />
zurückzuholen“.<br />
Doch die Logistik klappte – und wenige Wochen später kamen<br />
alle freiwilligen Expeditionsteilnehmer sicher im Basislager an. Hier<br />
untersuchten die Forscher – die fast zwei Wochen<br />
im Basislager verbrachten – erneut, wie sich Höhe<br />
und Sauerstoffmangel auf das Herz, die geistigen<br />
Funktionen sowie die Muskeln und das Blut der<br />
Teilnehmer auswirkten. Die Probanden hatten<br />
damit den höchsten Punkt ihrer Tour erreicht. Für<br />
Grocott, Montgomery und sieben weitere Forscher<br />
– allesamt erfahrene Bergsteiger, die in<br />
den vergangenen Jahren bereits mehrere Gipfel<br />
über 5.000 Meter erklommen hatten – begann<br />
hier jedoch der kniffligste Teil der Expedition, der<br />
Aufstieg zum höchsten Berg der Welt. Innerhalb<br />
weniger Tage mussten die Forscher nicht nur mit der extremen körperlichen<br />
Anstrengung fertig werden. Auf dem Weg zum Gipfel sollten sie<br />
an sich selbst weitere Messungen wie Blutprobenentnahmen und Muskelbiopsien<br />
vornehmen.<br />
Keine leichte Aufgabe. Denn spätestens in der so genannten<br />
Todeszone über 7.500 Metern heißt es für jeden Bergsteiger selbst<br />
mit Hilfe von zusätzlichem Sauerstoff: So schnell wie möglich auf- und<br />
wieder absteigen. Nur so lassen sich Schäden, die die lebensfeindliche<br />
Umgebung am menschlichen Körper anrichten kann, in Grenzen<br />
halten. Das außergewöhnliche Unterfangen glückte: Den Forschern<br />
gelang es, erstmals auf dem Gipfel des Mount Everest Blutproben zu<br />
entnehmen.<br />
Nach ihrer Rückkehr nach England stand den Forschern<br />
einer der wichtigsten Teile der Arbeit noch bevor. Sechs bis neun<br />
Monate, schätzt Grocott, wird es wohl dauern, bis die riesigen Mengen<br />
von Daten, die sie gesammelt haben, in eine Datenbank eingeflossen<br />
und noch Jahre, bis die Untersuchungen abschließend ausgewertet<br />
sind. Eines aber hat sich bereits in den ersten Analysen<br />
gezeigt: „Die Sauerstoffmengen im Blut sind in so extremen Höhen<br />
wie auf dem Mount Everest viel niedriger als wir je erwartet hätten,“<br />
verrät Hugh Montgomery. „Nach der gängigen Lehrmeinung<br />
hätte niemand diese Expedition überleben dürfen.“<br />
LINkS:<br />
www.caudwell-xtreme-everest.co.uk<br />
www.high-altitude-medicine.com<br />
www.linde-gastherapeutics.de