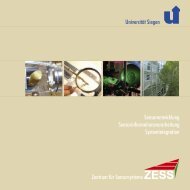Online Publikation - im ZESS - Universität Siegen
Online Publikation - im ZESS - Universität Siegen
Online Publikation - im ZESS - Universität Siegen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
EXPERIMENTELLE GRUNDLAGEN 15<br />
da hier die Co-Metabolite und Effektoren nicht eingezeichnet sind. Rot hervorgehoben<br />
sind zwei wichtige Reaktionswege, die Glykolyse und der Zitronensäurezyklus, die<br />
Teil des Zentralstoffwechsels sind. Andere Reaktionswege münden entweder in den<br />
Zentralstoffwechsel, um beispielsweise benötigte Metabolite zu liefern, oder entsprin-<br />
gen von ihnen für die Biosynthese.<br />
Obwohl durch diesen Ansatz viel über die Organisation des Stoffwechsels heraus-<br />
gefunden werden konnte, ist nach wie vor unklar, ob sich die einzelnen Bestandteile<br />
<strong>im</strong> Reagenzglas (in-vitro) - gereinigt und isoliert von allen anderen - anders als in der<br />
lebenden Zelle verhalten (in-vivo, Abb. 2.2). Die wichtigsten Gründe dafür sind:<br />
• Viele Substanzen, die durch die Reinigung entfernt wurden, hatten vielleicht<br />
doch eine Einwirkung auf das Enzym.<br />
• In Abb. 2.1 kann man sehen, dass vom Metabolit Pyruvat aus viele Linien abge-<br />
hen. Das bedeutet, dass hier viele Enzyme um das Pyruvat als Substrat konkur-<br />
rieren. In-vitro waren sie jedoch getrennt voneinander und man beobachtete das<br />
Verhalten ohne die Konkurrenz.<br />
• Die Enzymkonzentrationen in-vivo sind wesentlich höher als bei in-vitro Experi-<br />
menten.<br />
• Selbst nach Jahrzehnten der Enzymforschung sind noch <strong>im</strong>mer nicht alle Funk-<br />
tionsweisen der Enzyme <strong>im</strong> Zentralstoffwechsel entdeckt [Wiechert, 2002], was<br />
zur Folge hat, dass die Aufzeichnungen <strong>im</strong> Reaktionsnetzwerk (Abb. 2.1) unvoll-<br />
ständig sind.<br />
2.2. E. coli und C. glutamicum als Modellorganismen<br />
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •<br />
Wie das in 1.3 vorgestellte C. glutamicum, ist auch E. coli erfolgreich <strong>im</strong> Einsatz in in-<br />
dustriellen Produktionsprozessen und wird beispielsweise zur Herstellung von Insu-<br />
lin, Penicillin Acylase, Tryptophan oder Ethanol verwendet. Wie C. glutamicum gehört<br />
es zu der Klasse der Prokaryonten, die <strong>im</strong> Gegensatz zu den Eukaryonten einfacher<br />
aufgebaut und kleiner als 1 µm sind.<br />
Unter den E. coli Bakterien gibt es pathogene Stämme, die Infektionen in Darm,<br />
Blase, Lunge und Nervensystem hervorrufen können [Blattner et al., 1997]. Andere<br />
Stämme sind aber als Darmbakterium wichtige Helfer <strong>im</strong> Körper von Mensch und<br />
Tier. E. coli ist in der Lage außerhalb seines natürlichen Umfeldes zu überleben, mit<br />
einer Vielzahl von chemischen Umgebungsbedingungen fertig zu werden und sich<br />
trotzdem rasch zu vermehren. Im Labor ist das Kultivieren von E.coli-Stämmen nicht