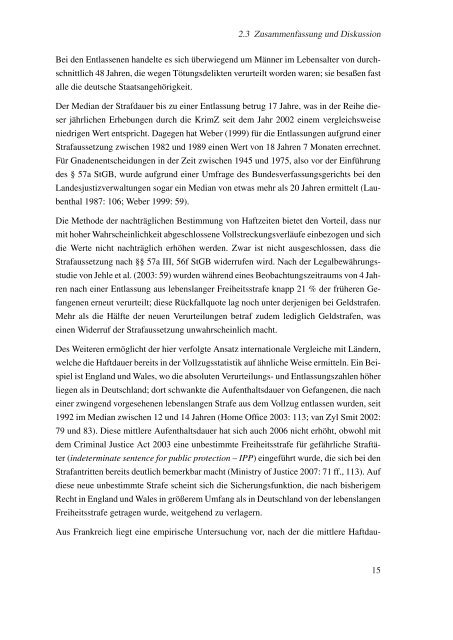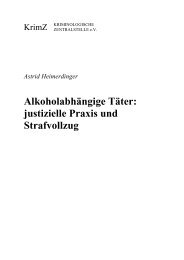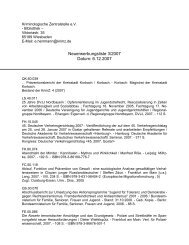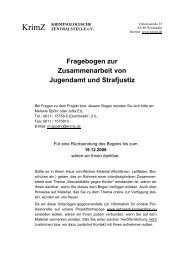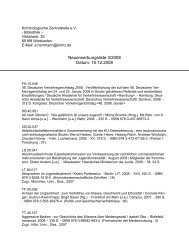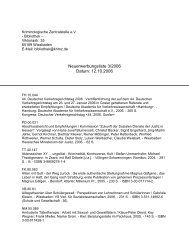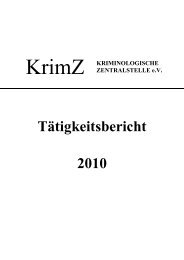Lebenslange Freiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung und ...
Lebenslange Freiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung und ...
Lebenslange Freiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.3 Zusammenfassung <strong>und</strong> Diskussion<br />
Bei den Entlassenen handelte es sich überwiegend um Männer im Lebensalter von durch-<br />
schnittlich 48 Jahren, die wegen Tötungsdelikten verurteilt worden waren; sie besaßen fast<br />
alle die deutsche Staatsangehörigkeit.<br />
Der Median der Strafdauer bis zu einer Entlassung betrug 17 Jahre, was in der Reihe die-<br />
ser jährlichen Erhebungen durch die KrimZ seit dem Jahr 2002 einem vergleichsweise<br />
niedrigen Wert entspricht. Dagegen hat Weber (1999) für die Entlassungen aufgr<strong>und</strong> einer<br />
Strafaussetzung zwischen 1982 <strong>und</strong> 1989 einen Wert von 18 Jahren 7 Monaten errechnet.<br />
Für Gnadenentscheidungen in der Zeit zwischen 1945 <strong>und</strong> 1975, also vor der Einführung<br />
des § 57a StGB, wurde aufgr<strong>und</strong> einer Umfrage des B<strong>und</strong>esverfassungsgerichts bei den<br />
Landesjustizverwaltungen sogar ein Median von etwas mehr als 20 Jahren ermittelt (Lau-<br />
benthal 1987: 106; Weber 1999: 59).<br />
Die Methode der nachträglichen Bestimmung von Haftzeiten bietet den Vorteil, dass nur<br />
mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeschlossene Vollstreckungsverläufe einbezogen <strong>und</strong> sich<br />
die Werte nicht nachträglich erhöhen werden. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass die<br />
Strafaussetzung nach §§ 57a III, 56f StGB widerrufen wird. Nach der Legalbewährungs-<br />
studie von Jehle et al. (2003: 59) wurden während eines Beobachtungszeitraums von 4 Jah-<br />
ren nach einer Entlassung aus lebenslanger <strong>Freiheitsstrafe</strong> knapp 21 % der früheren Ge-<br />
fangenen erneut verurteilt; diese Rückfallquote lag noch unter derjenigen bei Geldstrafen.<br />
Mehr als die Hälfte der neuen Verurteilungen betraf zudem lediglich Geldstrafen, was<br />
einen Widerruf der Strafaussetzung unwahrscheinlich macht.<br />
Des Weiteren ermöglicht der hier verfolgte Ansatz internationale Vergleiche mit Ländern,<br />
welche die Haftdauer bereits in der Vollzugsstatistik auf ähnliche Weise ermitteln. Ein Bei-<br />
spiel ist England <strong>und</strong> Wales, wo die absoluten Verurteilungs- <strong>und</strong> Entlassungszahlen höher<br />
liegen als in Deutschland; dort schwankte die Aufenthaltsdauer von Gefangenen, die nach<br />
einer zwingend vorgesehenen lebenslangen Strafe aus dem Vollzug entlassen wurden, seit<br />
1992 im Median zwischen 12 <strong>und</strong> 14 Jahren (Home Office 2003: 113; van Zyl Smit 2002:<br />
79 <strong>und</strong> 83). Diese mittlere Aufenthaltsdauer hat sich auch 2006 nicht erhöht, obwohl mit<br />
dem Criminal Justice Act 2003 eine unbestimmte <strong>Freiheitsstrafe</strong> für gefährliche Straftä-<br />
ter (indeterminate sentence for public protection – IPP) eingeführt wurde, die sich bei den<br />
Strafantritten bereits deutlich bemerkbar macht (Ministry of Justice 2007: 71 ff., 113). Auf<br />
diese neue unbestimmte Strafe scheint sich die Sicherungsfunktion, die nach bisherigem<br />
Recht in England <strong>und</strong> Wales in größerem Umfang als in Deutschland von der lebenslangen<br />
<strong>Freiheitsstrafe</strong> getragen wurde, weitgehend zu verlagern.<br />
Aus Frankreich liegt eine empirische Untersuchung vor, nach der die mittlere Haftdau-<br />
15