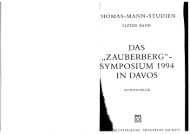Die Krankenschwesterfiguren im frühen Werk Thomas Manns unter ...
Die Krankenschwesterfiguren im frühen Werk Thomas Manns unter ...
Die Krankenschwesterfiguren im frühen Werk Thomas Manns unter ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
70<br />
<strong>Thomas</strong> Sprecher<br />
Eine besondere Nähe gewinnt sie zu Maria, der Muttergottes, der christlichen<br />
Magna Mater, H<strong>im</strong>melskönigin und Virgo Celestis. Settembrinis Bezeichnung<br />
»unsere verehrungswürdige Frau« (III, 88) deutet darauf hin, auch<br />
ihre weisse Jungfräulichkeit, ihre Christlichkeit, vielleicht auch ihr Vorname.<br />
<strong>Die</strong> roten Haare sprechen nicht dagegen: <strong>Die</strong> bildenden Künstler haben die<br />
Madonna in allen Haarfarben geschätzt und ihr insbesondere auch rote Haare<br />
zugedacht. 79 Auch das Dreieck Behrens - Krokowski - Mylendonk weist<br />
ihr als einziger Frau diese Rolle zu: Der Hofrat n<strong>im</strong>mt in dem Sanatorium<br />
eine (fast) allgewaltige Stellung ein, und Krokowski wird explizit mit »dem<br />
Herrn Jesus am Kreuz« (III, 183) verglichen. 80 Dazu passen ihre schon erwähnte<br />
Menschenmutterschaft und die Assoziation mit der Maria <strong>im</strong> Ährenkranz.<br />
Zur Interpretation der Mylendonk als Maria-Figur lädt auch die Tatsache<br />
ein, dass literarische Mariendarstellungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
keineswegs selten waren. 81 Das Interesse konzentrierte sich nicht auf marianische<br />
Frömmigkeit. Stefan George (<strong>Die</strong> Bücher der Hirten und Preisegedichte,<br />
der Sagen und Sänge und der Hängenden Gärten, 1895), Rilke (Gebete<br />
der Mädchen zu Maria, 1898; Marienleben, 1912), Döblin (Maria<br />
Empfängnis, 1911), Brecht (Weihnachtsgedichte, 1922-26), Hesse (<strong>unter</strong> anderem<br />
Narziss und Goldmund, 1930), ihnen allen war vielmehr daran gelegen,<br />
mit Maria als literarischer Figur Grundhaltungen des Menschen zur<br />
Wirklichkeit überhaupt zu spiegeln. 82<br />
Auch <strong>im</strong> Frühwerk <strong>Thomas</strong> <strong>Manns</strong> - der einmal eine Mary sogar heiraten<br />
wollte (vgl. XI, 117 f.) und der die von Heinrich Mann geschenkte Madonna<br />
Murillos »als Staffeleibild auf meinem Tisch« aufstellte (29.12.1900 an Heinrich<br />
Mann) - kommt Maria <strong>im</strong>mer wieder vor. Gleich zu Beginn von Gefallen<br />
(1894) begegnen »wächserne Madonnen« (VIII, 11). Über Hanno Buddenbrooks<br />
Bett hängt die Sixtinische Madonna (1901; I, 703). Natürlich wird<br />
79<br />
Brigitte Kronauer: Maria wie Milch und Blut, in: Neue Zürcher Zeitung, Jg. 217, Nr. 292,<br />
14715.12.1996, S. 67 f.<br />
80<br />
Eine »Maria«, eine <strong>im</strong> Mittelpunkt stehende Mutter mit Kind, taucht dann <strong>im</strong> Schneetraum<br />
wieder auf (III, 681). Vgl. <strong>Thomas</strong> Sprecher: Davos <strong>im</strong> »Zauberberg«. <strong>Thomas</strong> <strong>Manns</strong> Roman<br />
und sein Schauplatz, Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung 1996, S. 286 f. - Es h'esse sich auch<br />
von einer christlichen Trinität - Adriatica-Hermes als Heiliger Geist - oder von einer<br />
alchemistischen Trinität - gebildet von König, Sohn und Hermes - sprechen. Vgl. Jung, S. 392 ff.<br />
81<br />
Und schon der Protestant Novalis hatte 1800, die christliche Symbolik frei und überkonfessionell<br />
benutzend und zu individueller Blickweise und Darstellung an<strong>im</strong>ierend, gedichtet:<br />
»Ich sehe dich in tausend Bildern / Maria, lieblich ausgedrückt, /Doch keins von allen kann dich<br />
schildern, / Wie meine Seele dich erblickt.«<br />
82<br />
Auch an Max Grads 1896 publizierte Novelle Madonna (in: Neue deutsche Rundschau, Jg.<br />
7,1896, S. 988-996) ist zu denken, die, worauf Hans Rudolf Vaget hingewiesen hat, eine literarische<br />
Vorlage für die Madonna aus Gladius Dei darstellte.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Krankenschwesterfiguren</strong> <strong>im</strong> <strong>frühen</strong> <strong>Werk</strong> <strong>Thomas</strong> <strong>Manns</strong> 71<br />
in Buddenbrooks die Lübecker Marienkirche erwähnt (I, 589), und dann<br />
auch die Münchner Mariensäule (I, 308). Vielleicht darf noch das pikante<br />
Lied »That's Maria!« (I, 263) erwähnt werden, das Christian Buddenbrook<br />
so fasziniert und das übrigens schon in Luischen (1900; VIII, 176) vorkommt.<br />
83 In GUdius Dei (1902) wird eine wollüstige Madonna-Figur in der<br />
Kunsthandlung von M. Blüthenzweig zum Streitgegenstand. 84 In der Erzählung<br />
Be<strong>im</strong> Propheten (1904) heisst die Schwester des Propheten, als ob dessen<br />
<strong>im</strong>itatio Christi nicht schon augenfällig genug wäre, Maria Josefa (VIII,<br />
364). Im Zauberberg heisst die »Venus« Ziemssens, Castorps alter ego, Marusja,<br />
was »Marie« bedeutet (III, 104, 99).<br />
<strong>Die</strong> asketische, in leidende Spiritualität zurückgenommene Pietä 85 Naphtas<br />
ist geradezu seine Antwort auf die Sinnlichkeit von M. Blüthenzweigs<br />
Madonna. 86 Der Bezug der Pietä andererseits zu Schwester Adriatica wird,<br />
über die Christlichkeit hinaus, augenfällig durch ihre Hässlichkeit, ihr Alter<br />
- sie stammt aus dem 14. Jahrhundert (während die Oberin »nicht lange nach<br />
der Mitte des 13. Jahrhunderts« auf die Welt gekommen sein soll), es ist<br />
»Mittelalter, wie es <strong>im</strong> Buche steht« - und ihre rheinische Herkunft hergestellt.<br />
Ausserdem trägt auch die Gottesmutter eine Haube. Selbst die Farbe<br />
rot kommt vor: Der Sockel ist »rot verkleidet«, und beschrieben werden<br />
»Trauben geronnenen Bluts«. Schliesslich kann auch das Element »Kunst«<br />
genannt werden: Einem »Künstler« hat die Oberin ihre »Berghof«-Existenz<br />
zu verdanken (was ja auch <strong>im</strong> buchstäblichen Sinn gilt). <strong>Die</strong> »Geronnenheit«,<br />
überhaupt die Statue erinnern an »Versteinerung«, »Petrefakt«.<br />
- Im Horizont des Demeter-Persephone-Mythos stehen die Mylendonk<br />
und die Chauchat <strong>im</strong> Mutter-Tochter-Verhältnis zueinander. Sie sind von<br />
derselben Familie; ihre Identitäten decken sich teilweise.<br />
- Stellt die Mylendonk <strong>im</strong> Zeichen des Hermetisch-Vermittelnden wie des<br />
Mephistophelisch-Verführenden eine Kupplerin, eine Bordellmutter<br />
dar, 87 so wird Mme Chauchat zu ihrer Hure.<br />
83<br />
Vgl. auch Brief vom 26.1.1911 an Heinrich Mann.<br />
84<br />
VIII, 202 ff. Vgl. dazu auch Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches II, Der<br />
Wanderer und sein Schatten, Nr. 73.<br />
85<br />
III, 544. Vgl. Bild und Text bei <strong>Thomas</strong> Mann, hrsg. von Hans Wysling <strong>unter</strong> Mitarbeit von<br />
Yvonne Schmidlin, Bern/München: Francke 1975, S. 176 f.; Sandt, S. 315.<br />
" VIII, 202. <strong>Die</strong> Gegenbewegung führt <strong>im</strong> späten Krull dann zum »königlichen Busen« Maria<br />
Pias (VII, 661).<br />
87<br />
Vgl. III, 580, wo Hofrat Behrens das Kuppelei-Motiv unvermittelt aufbringt. Indem er sich<br />
von den Eigentümern des Sanatoriums distanziert - er sei nicht »Hüttchenbesitzer« und »Kuppelonkel«,<br />
sondern nur Angestellter (III, 576, 580) -, schreibt er dem »Berghof« gerade Bordellcharakter<br />
zu. Und übrigens ist das Sanatoriumsgebäude mit einem Kuppelturm versehen.