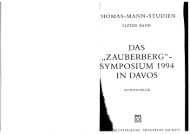Die Krankenschwesterfiguren im frühen Werk Thomas Manns unter ...
Die Krankenschwesterfiguren im frühen Werk Thomas Manns unter ...
Die Krankenschwesterfiguren im frühen Werk Thomas Manns unter ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
50 <strong>Thomas</strong> Sprecher<br />
<strong>Die</strong> <strong>Krankenschwesterfiguren</strong> <strong>im</strong> <strong>frühen</strong> <strong>Werk</strong> <strong>Thomas</strong> <strong>Manns</strong> 51<br />
<strong>Die</strong> passive Formulierung »klopfte es bei ihm, und es ergab sich« deutet an,<br />
dass da etwas Schicksal- 34 und Märchenhaftes, jedenfalls Bedeutendes passiert.<br />
Nun hat Castorp es geschafft. Objektiv verheisst der Besuch der Oberin<br />
Ungutes. Denn Zeit hat sie ja nur für Kranke. Ihre Tüchtigkeit und<br />
Flüchtigkeit entspricht der Flinkheit, Unbeständigkeit, Wandelbarkeit des<br />
Götterboten Hermes; nebenbei antizipiert es die zweckmässigen Irrläufe<br />
Hans Castorps <strong>im</strong> Krieg. N<strong>im</strong>mt man das Verb »auftauchen« wörtlich, so<br />
lassen sich damit die schon genannten Sinngehalte von Meer und Unterwelt<br />
verbinden. Ihre St<strong>im</strong>me ist unvorteilhaft: Sie quäkt, wie eine Kröte.<br />
Weiter heisst es:<br />
... durch seinen Katarrh herbeigezogen, klopfte sie knöchern hart und kurz an seine<br />
Stubentür und trat ein, fast bevor er Herein gesagt, indem sie sich auf der Schwelle<br />
noch einmal zurückbeugte, um sich der Z<strong>im</strong>mernummer gewiss zu machen. >VierunddreissigEs st<strong>im</strong>mt. [...]<<br />
Es fällt auf, dass der Akt des Klopfens zwe<strong>im</strong>al Erwähnung findet. Be<strong>im</strong><br />
zweitenmal nun in aktiver Wendung: Es ist die Oberin, die da »knöchern<br />
hart und kurz« an die Türe klopft. In der Vorstellung (knöchern 35 - Knochen<br />
- Skelett) klopft noch jemand mit: der bei jedem einmal klopft. 36 Das Klopfen<br />
der Äbtissin Mylendonk steht in Verbindung auch mit jenem der weltentsagenden<br />
Novizin (III, 25); und mit dem Klopfen des Hofrats (III, 250).<br />
Es ist der Rhythmus der Zauberbergmusik, zu der Mme Chauchat die Melodie<br />
- das »Miauen« 37 - beiträgt. Es ist das Schlagzeug der Totentanzmusik.<br />
<strong>Die</strong> Schwester auf der Schwelle - ein hermetischer Ort des Übergangs; zu<br />
Hermes' Aufgaben gehörte das Türhüten. Auch Mme Chauchat, eine weitere<br />
Hermes-Figuration, wird, als sie Castorp auffordert, ihr den Bleistift zurückzubringen,<br />
»rückwärts gewandt« auf der Schwelle stehen (III, 478). <strong>Die</strong><br />
Rück-Bewegung der Versicherung, die Überprüfung der Z<strong>im</strong>mernummer<br />
lenkt den Blick sodann auf die nicht zufällige Zahl. 38 Castorp ist in diesem<br />
34 Angespielt wird auch auf Beethovens Wort über das Klopfmotiv in seiner Fünften Symphonie<br />
(»So pocht das Schicksal an die Pforten«). Vgl. VII, 317, 366.<br />
35 Das Knöcherne steht in direkter Verbindung mit dem demeterkultischen Kindsopfer <strong>im</strong><br />
Schneetraum und den «spröden Knöchlein« (III, 683) des zerrissenen Kindes.<br />
36 In Tristan pocht Rätin Spatz an die Stubentür, als sie die Schreckensmeldung über den Gesundheitszustand<br />
Gabriele Klöterjahns bringt und so deren Tod ankündigt (VIII, 259).<br />
37 III, 491. Ihre Sprache wird gerade auch als »knochenlos« bezeichnet (III, 163).<br />
38 34 ist eine zusammengesetzte Zahl, deren Quersumme der leitmotivischen Siebenzahl entspricht.<br />
Vgl. Sandt, S. 45 ff., 304. Dort noch weitere, erwas spekulative kabbalistische Deutungen.<br />
-Vgl. auch CG. Jung: Psychologie und Alchemie (1944), Ölten: Walter 1972, S. 41 f.: »Vier<br />
hat die Bedeutung des Weiblichen, Mütterlichen, Physischen, Drei die des Männlichen, Väterlichen,<br />
Geistigen.«<br />
Moment keine Person, sondern Nummer. Nicht dass er in Z<strong>im</strong>mer 34 liegt,<br />
ist relevant, sondern dass er in Z<strong>im</strong>mer 34 liegt. Noch hat er keine Identität<br />
als Kranker, keine Krankengeschichte.<br />
<strong>Die</strong> Oberin lässt es an jeder Dezenz fehlen. Sie »quäkt« vielmehr, und zwar<br />
»ungedämpft«. Vielleicht weist ihr Auftritt schon voraus auf die okkulte Szene<br />
<strong>im</strong> Abschnitt »Fragwürdigstes«, wo es »laut und abgeschmackt« zugeht<br />
(III, 941). Im Reich der Schatten darf man keine Höflichkeit, keine bürgerlichen<br />
Rücksichten erwarten. 39<br />
>Menschenskind, on me dit, que vous avez pris froid, I hear, you have caught a cold,<br />
Wy, katschetsja, prostudilisj, ich höre, Sie sind erkältet? Wie soll ich reden mit Ihnen?<br />
Deutsch, ich sehe schon. Ach, der Besuch vom jungen Ziemssen, ich sehe schon. Ich<br />
muss in den Operationssaal. Da ist einer, der wird chloroformiert und hat Bohnensalat<br />
gegessen. Wenn man seine Augen nicht überall hat... Und Sie, Menschenskind,<br />
wollen sich hier erkältet haben?<<br />
Hans Castorp war verblüfft über diese Redeweise einer altadligen Dame. (III, 233 f.)<br />
Zum ersten Mal spricht sie ihn an, hört er, hören wir sie reden. Altadelig und<br />
vornehm ist es nicht, da hat Castorp ganz recht. (Für eine Oberschwester,<br />
die <strong>unter</strong> Dauerdruck steht, pausenlos Verantwortlichkeiten wahrzunehmen<br />
und nie genügend Zeit hat, scheint die Redeweise hingegen plausibel.) Sie<br />
spricht deutsch, französisch, englisch und russisch. Dass sie verschiedene<br />
Sprachen benutzt, lässt sich realistisch leicht motivieren: Sie hat ja Patienten<br />
aus aller Welt; auch auf dem Davoser Friedhof schweigt man in allen Zungen<br />
(III, 447). Ihre Vielsprachigkeit entspricht jener des Hofrats. Sie zeigt aber<br />
auch, dass die Oberin unvorbereitet zu Castorp kommt und ihn, seine Herkunft<br />
und Muttersprache nicht kennt. Noch anerkennt sie ihn nicht als Kranken;<br />
gleich will sie wieder weg. <strong>Die</strong> Redeweise der Oberin korrespondiert<br />
ihrer Körpersprache, dem Unsteten, Umkreisenden, dem Haltlosen. Und sie<br />
zeigt schliesslich eine gewisse verbale Beliebigkeit. Was und in welcher Sprache<br />
sie es sagt, ist nicht wichtig. So scheint es ihr jedenfalls selbst:<br />
Während sie sprach, ging sie über ihre eigenen Worte hinweg, indem sie unruhig, in<br />
rollender, schleifenförmiger Bewegung den Kopf mit suchend erhobener Nase hin<br />
und her wandte, wie Raubtiere <strong>im</strong> Käfig tun, und ihre sommersprossige Rechte, leicht<br />
geschlossen und den Daumen nach oben, vor sich <strong>im</strong> Handgelenk schlenkerte, als<br />
wollte sie sagen: >Rasch, rasch, rasch! Hören Sie nicht auf das, was ich sage, sondern<br />
reden Sie selbst, dass ich fortkomme!< (III, 234)<br />
39 Insofern müsste man die oben besprochene Szene mit dem Moribunden, der nicht sterben<br />
will (III, 81), dahingehend deuten, dass sich die ärztliche Rüge nicht auf die Laut- und Wildheit<br />
des Widerstandes, sondern auf den Widerstand als solchen bezieht.