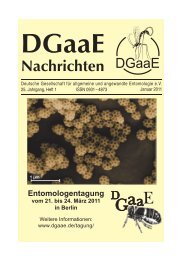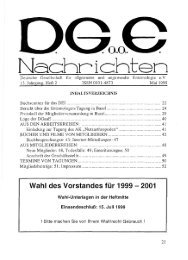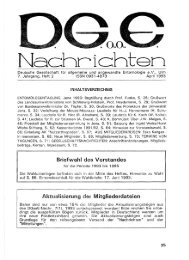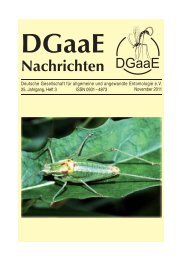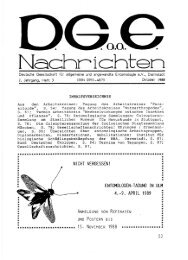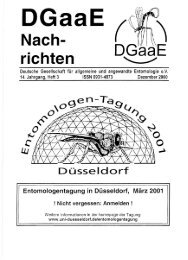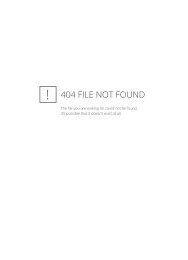Beiträge der Hymenopterologen-Tagung in Stuttgart (1 ... - DGaaE
Beiträge der Hymenopterologen-Tagung in Stuttgart (1 ... - DGaaE
Beiträge der Hymenopterologen-Tagung in Stuttgart (1 ... - DGaaE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Beitr. Hymenopt.-<strong>Tagung</strong> <strong>Stuttgart</strong> (2004) 11<br />
Die Mundwerkzeuge <strong>der</strong> Masar<strong>in</strong>ae (Vespidae):<br />
Evolution e<strong>in</strong>es Saugrüssels zur Nektaraufnahme bei Faltenwespen<br />
Harald W. KRENN 1 , Volker MAUSS 2 & John PLANT 1<br />
1 Institut für Zoologie, Universität Wien<br />
Althanstraße 14, A-1090, Wien, harald.krenn@univie.ac.at [H.W. Krenn] und a9709440@univie.ac.at [J. Plant]<br />
2 Staatliches Museum für Naturkunde, Abt. Entomologie<br />
Rosenste<strong>in</strong> 1, D-70191 <strong>Stuttgart</strong>, volker.mauss@stechimmenschutz.de<br />
Zusammenfassung: Die Masar<strong>in</strong>ae s<strong>in</strong>d blütenbesuchende Faltenwespen (Vespidae), welche<br />
ähnlich wie solitäre Bienen, an Blüten Nektar aufsaugen und für ihre Brut Pollen sammeln. Die<br />
Glossa ist an Nektaraufnahme angepasst und bei e<strong>in</strong>igen Arten länger als <strong>der</strong> Körper. Diese<br />
stark verlängerten Saugrüssel werden <strong>in</strong> Ruhestellung schl<strong>in</strong>genförmig <strong>in</strong> das Labium zurückzogen.<br />
Der Vergleich mit kurzrüsseligen Vertretern <strong>der</strong> Masar<strong>in</strong>ae erlaubt es, e<strong>in</strong>e<br />
Hypothese zur Evolution dieses ungewöhnlichen Saugrüssels aufzustellen und se<strong>in</strong>en Funktionsmechanismus<br />
zu rekonstruieren.<br />
E<strong>in</strong>leitung: Im Gegensatz zu Bienen gibt es nur bei wenigen Vespidae verlängerte Mundwerkzeuge,<br />
die zur Aufnahme von Nektar aus Blüten dienen. Die Masar<strong>in</strong>ae s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>nerhalb <strong>der</strong><br />
Vespidae e<strong>in</strong>zigartig, weil die Weibchen, ähnlich wie solitäre Bienen Bodennester bauen und<br />
ihre Larven mit Pollen und Nektar versorgen (MAUSS 1995, GESS 1996). Die Masar<strong>in</strong>ae werden<br />
<strong>in</strong> die Gayell<strong>in</strong>i und Masar<strong>in</strong>i unterteilt; die Masar<strong>in</strong>i umfassen die Monophyla Priscomasar<strong>in</strong>a,<br />
Paragi<strong>in</strong>a und Masar<strong>in</strong>a (CARPENTER 1982, 2001, GESS 1988). Die Vertreter <strong>der</strong> Masar<strong>in</strong>a<br />
besitzen e<strong>in</strong>en Rüssel zur Nektaraufnahme, <strong>der</strong> <strong>in</strong> Ruhestellung <strong>in</strong> das Labium zurückgezogen<br />
werden kann (SCHREMMER 1961, RICHARDS 1962, OSTEN 1982). An diesem außergewöhnlichen<br />
Beispiel blütenbesuchen<strong>der</strong> Faltenwespen lassen sich exemplarisch die morphologischen<br />
Innovationen untersuchen, die für die Bildung und das Funktionieren e<strong>in</strong>es langen<br />
Saugrüssels notwendig s<strong>in</strong>d (KRENN, MAUSS & PLANT 2002).<br />
Material und Methoden: Die Mundwerkzeuge von Priscomasaris namibiensis<br />
(Priscomasar<strong>in</strong>a), Paragia decipiens (Paragi<strong>in</strong>a), Ceramius hispanicus, C. fonscolombei,<br />
Masar<strong>in</strong>a familiaris, Jugurtia braunsi, Celonites peliostomi und Quart<strong>in</strong>ioides spec. (alle Masar<strong>in</strong>a)<br />
wurden mit Rasterelektronenmikroskopie und Semidünnschnitttechnik untersucht. Bei<br />
Ceramius konnte <strong>der</strong> Blütenbesuch im Freiland untersucht und Tiere mit unterschiedlicher<br />
Rüsselstellung anatomisch verglichen werden (KRENN, MAUSS & PLANT 2002).<br />
Ergebnisse und Diskussion: Die Beobachtung von europäischen Ceramius-Arten zeigte, dass<br />
die Weibchen ihre großen Mandibeln vor allem zum Graben <strong>der</strong> Bodennester und beim<br />
Pollensammeln benutzen; die Maxillen helfen Pollen aufzunehmen; das Labium h<strong>in</strong>gegen wird<br />
vor allem für die Flüssigkeitsaufnahme aus Blüten und vom feuchten Boden benutzt. Während<br />
die Mandibeln und Maxillen bei den untersuchten Arten weitgehend gleich gebaut s<strong>in</strong>d, weisen<br />
die Glossae und die basalen Teile des Labiums große Unterschiede <strong>in</strong> Länge, Proportionen und<br />
Ausprägungen <strong>der</strong> verschiedenen Merkmale auf. So ist die Glossa von Priscomasaris sehr kurz<br />
und hat auf <strong>der</strong> anterioren Seite im distalen Abschnitt zahlreiche Querrillen. Die Glossa von<br />
Paragia ist 1-2 mm lang und zweizipfelig. Sie weist viele Querlamellen auf, die im distalen und<br />
gegabelten Abschnitt so verlängert s<strong>in</strong>d, dass sie kurze, aber nicht abgedichtete Nahrungskanäle<br />
bilden. In Ruhestellung ist die Glossa Z-förmig vor den Kopf gefaltet. Die anatomische<br />
Untersuchung des Kopfes zeigt, dass zwei antagonistische Muskelpaare die Glossa strecken und<br />
e<strong>in</strong>falten.