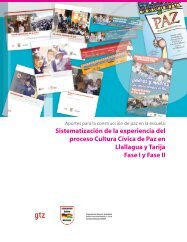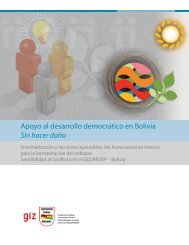Systemische Konflikttransformation. Konzept und Anwendungsgebiete
Systemische Konflikttransformation. Konzept und Anwendungsgebiete
Systemische Konflikttransformation. Konzept und Anwendungsgebiete
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gegenüber bevorzugen (müssen) <strong>und</strong> Schwierigkeiten mit inklusiven <strong>und</strong> allparteilichen<br />
Ansätzen haben, insbesondere wenn sich nicht eine baldige Beilegung des Konflikts<br />
abzeichnet, sondern dieser auf einem signifikanten Niveau kontinuierlicher<br />
Gewalthandlungen „eingefroren“ wird.<br />
Dies wird besonders deutlich anhand der Anreiz- <strong>und</strong> Sanktionsinstrumente, derer sich die<br />
Staatengemeinschaft bedient, um friedliche Orientierung zu belohnen <strong>und</strong><br />
Gewalthandlungen <strong>und</strong> Machtmissbrauch zu bestrafen. Anreize staatlicher Akteure, wie z. B.<br />
Entwicklungshilfe an nicht-staatliche Konfliktakteure, sind an die Zustimmung der jeweiligen<br />
Regierung geb<strong>und</strong>en, so dass dieser Weg oft nicht gangbar ist. Sanktionen wiederum, die<br />
gegen Menschenrechtsverletzungen verhängt werden, werden eher gegen<br />
Widerstandsbewegungen <strong>und</strong> ihre unterstützenden Organisationen verhängt, während die<br />
internationale Gemeinschaft mit Sanktionen gegen Staaten sehr viel zurück haltender ist.<br />
Eine solche Praxis verschärft eher die Asymmetrie als dass es sie abbaut.<br />
Aus Sicht internationaler Akteure bietet sich eine konstruktive Arbeitsteilung zwischen<br />
staatlichen <strong>und</strong> nicht-staatlichen Organisationen an, da staatliche Drittparteien aufgr<strong>und</strong><br />
ihres besonderen Zugangs direkt mit dem Staatsapparat kooperieren können, wohingegen<br />
nicht-staatliche Akteure in der Regel besser geeignet sind eine Position der Allparteilichkeit<br />
einzunehmen, um auch mit nicht-staatlichen Gewaltakteuren zu arbeiten. Aufgr<strong>und</strong> des<br />
hohen Polarisierungsdrucks bei langwierigen Konflikten <strong>und</strong> der in der Regel ungleich<br />
verteilten Macht zwischen den Konfliktparteien erfordert ein solches Vorgehen von den<br />
Drittparteien eine ausgeprägte Konfliktsensibilität sowie eine transparente, empathische<br />
Haltung gegenüber allen beteiligten Seiten. Wie die erfolgreiche Aushandlung von<br />
Friedensverträgen etwa im Sudan oder in Aceh/Indonesien zeigt <strong>und</strong> auch andere erfolgreiche<br />
Beispiele der Unterstützung von Friedensprozessen etwa im UN-Rahmen belegen, stellt eine<br />
konstruktive Prozessbegleitung <strong>und</strong> Dialog-facilitation seitens staatlicher <strong>und</strong> nichtstaatlicher<br />
Akteure eine Schlüsselaktivität der Friedensförderung dar. Zur Bearbeitung der<br />
Konfliktursachen sowie zur Absicherung von Friedensprozessen <strong>und</strong> zum Aufbau von<br />
Institutionen der konstruktiven Konfliktaustragung sind aber auch die strukturorientierten<br />
Maßnahmen der Friedensförderung wichtig, die häufig durch die Entwicklungszusammenarbeit<br />
gefördert werden. Diese erfolgreichen Ansätze unterstreichen die Bedeutung von<br />
vernetztem <strong>und</strong> sensiblem Vorgehen, <strong>und</strong> deuten gleichzeitig an, welche Herausforderungen<br />
es an die beteiligten Akteure der <strong>Konflikttransformation</strong> stellt.<br />
Bei der Betrachtung asymmetrischer Konflikte muss ein Umstand berücksichtigt werden, der<br />
erst in den letzten Jahren vermehrt Beachtung gef<strong>und</strong>en hat. Bis dahin lag ein großes<br />
Augenmerk auf den nicht-staatlichen Akteuren, ihrer Legitimität, ihrem Vorgehen usw.<br />
Zunehmend wird inzwischen jedoch beachtet, dass nicht alle staatlichen Akteure über gleiche<br />
Kompetenzen <strong>und</strong> Legitimation verfügen. Viele aktuelle Konflikte finden im Kontext<br />
schwacher oder versagender Staatlichkeit statt. Die in dieser Studie berücksichtigen Konflikte<br />
(Sri Lanka, Indonesien/Aceh, Georgien/Abchasien, Nepal, Sudan) können alle der Kategorie<br />
failing states zugeordnet werden, wenngleich die einzelnen Fälle sehr unterschiedlich<br />
gelagert sind. 11 Dabei kann Staatsversagen durchaus eine Auswirkung von Bürgerkriegen sein<br />
oder zumindest durch diese beschleunigt werden. Andererseits kann ein schwacher Staat oder<br />
ein Staat, der vorrangig der Durchsetzung von partikularen Gruppeninteressen dient,<br />
ursächlich an der Entstehung von Gewaltkonflikten beteiligt sein. So müssen bspw. im Sudan<br />
staatliche Akteure als Schlüsselakteure der vielfältigen innersudanesischen Konflikte gesehen<br />
werden, gleichzeitig repräsentieren diese Gruppen, die den Staatsapparat für ihre Interessen<br />
nutzen <strong>und</strong> instrumentalisierten, nur einen geringen Teil der sudanesischen Gesellschaft.<br />
Vertreter von Drittparteien, die einen Beitrag zur Konfliktbearbeitung <strong>und</strong> Friedensförderung<br />
11 Nach der Einteilung von Ulrich Schneckener (Hrsg.): States at Risk. Fragile Staaten als Sicherheits- <strong>und</strong><br />
Entwicklungsproblem, Berlin: SWP 2004. Zu berücksichtigen ist hier, dass die Begrifflichkeit selbst ein Politikum<br />
darstellt <strong>und</strong> oft von den betreffenden Staaten als interventionistische Zumutung interpretiert wird.<br />
BFPS Studie – <strong>Systemische</strong> <strong>Konflikttransformation</strong><br />
8