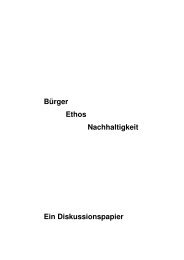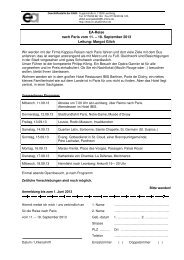Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sie traditionelle Redeweisen, Vorstellungen und Bilder für Gottes Realität und se<strong>in</strong> Handeln, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Sprache und <strong>in</strong> Bil-der<br />
übersetzen, die ihrer Situation und Bef<strong>in</strong>dlichkeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er und ihrem Verständnis von e<strong>in</strong>er wissenschaftlich <strong>in</strong> neuer Weise<br />
<strong>in</strong>terpretierten und technisch veränderten Welt besser entsprechen, so könnte e<strong>in</strong>e solche Ersetzung oder Überset-zung alter<br />
Dogmen und Formen der Verkündigung, e<strong>in</strong> breiteres Spektrum von Gläubigkeit abdecken, wenn man die alten Formen nicht<br />
bekämpft, um sie abzuschaffen, sondern wenn e<strong>in</strong> Nebene<strong>in</strong>anderbestehen alter und neuer Formen nicht nur als<br />
unvollkommenes Zwischenstadium h<strong>in</strong>genommen, sondern als mögliche und notwendige Koexistenz begriffen wird.<br />
Überzeugtes, nicht widerstrebendes Tolerieren unterschiedlicher Bilder und Vorstellungen von Gott und dem Göttlichen wird<br />
dann als Königsweg ersche<strong>in</strong>en.<br />
Wir s<strong>in</strong>d dann nicht auf die Alternative zurückgeworfen, die Wirklichkeit Gottes und der Welt nach dem Konstrukt der<br />
christlichen Weltsicht, wie sie von August<strong>in</strong>us vorgezeichnet und von Thomas noch e<strong>in</strong>mal konsolidiert worden war, noch <strong>in</strong><br />
der Weltsicht von Descartes und Newton, <strong>in</strong> der Gott zum großen Uhrmacher geworden war, zu begreifen oder aber nur <strong>in</strong> der<br />
Sicht e<strong>in</strong>er wissenschaftlich-technischen Moderne, die nicht mehr auf Gottesgnade und Erlösung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er jenseitigen Welt<br />
angewiesen zu se<strong>in</strong> glaubte.<br />
Sprache ist immer Versuch und die Grenzen von heute können morgen verschoben se<strong>in</strong>. Im Kirchenkampf bekam die<br />
Frömmigkeitssprache e<strong>in</strong>en kämpferischen Akzent. Fe<strong>in</strong>de wurden nicht mehr geliebt, sondern verurteilt. So erfahren wir es<br />
auch aus der grauen Vorzeit der biblischen Geschichten. Es gibt aber auch Grenzen des Wagnisses: Wer sich <strong>in</strong> die Freiheit<br />
<strong>in</strong>dividueller Verantwortung für se<strong>in</strong>e Vorstellungen von Gott und der Welt begibt, kann e<strong>in</strong>er gnadenlosen Absurdität der<br />
Welt ausgesetzt se<strong>in</strong>, die auf se<strong>in</strong>e Fragen vernunftwidrig schweigt. Camus hat das festgestellt. Nietzsche hat es erfahren. Ich<br />
empfehle die Lektüre von Jean Pauls "Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass ke<strong>in</strong> Gott ist“, <strong>in</strong> "Siehenkäs".“<br />
„Abweichende Gottesvorstellungen? Welche Vorstellung haben wir denn "nach bisherigem Verständnis"? Das sche<strong>in</strong>t mir schon<br />
sehr ausdifferenziert. (Wir mussten doch schon beim Abendmahlsverständnis mit der Leuenberger Konkordie erst e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>igung<br />
herstellen).“<br />
„Insgesamt fraglich bleiben mir die „Grenzen“ – denn sie s<strong>in</strong>d immer nur zeitnah: Wir s<strong>in</strong>d so lange frei zur Entwicklung<br />
eigener Gottesvorstellungen, so lange die sich ausrichten an den Inhalten der Botschaft Jesu und mit diesen Inhalten sachlich<br />
übere<strong>in</strong>stimmen. Die Grenzen liegen dort wo Zerrbilder dessen entstehen, was Jesus als se<strong>in</strong>en Gott (und Vater) verehrt hat.<br />
Z.B. wenn von e<strong>in</strong>em Gott die Rede ist, der menschenverachtende Gewalt rechtfertigt, etwa gar Krieg, und wenn Gott, die<br />
„Größere Wirklichkeit“, zur Glorifizierung politischer Macht missbraucht wird.<br />
„Auf die Dauer unserer Arbeit merke ich dort Grenzen, wo die Suche nach nonpersonaler Expression <strong>in</strong>s Leere führt. „Liebe“,<br />
„Friede“, „höhere Wirklichkeit“, „Geheimnis des Lebens“ erweisen sich als profillose Gebilde, wenn sie nicht zum Gegenüber<br />
werden, mit dem kommunikativ gelebt werden kann.“ Die christliche religiöse Sprache kommt doch von der Jesus-Christus-<br />
Erfahrung her und läuft darauf zurück. Jesus ist das große Du. Von ihm geht der Weg zum Du des „Vaters“ und des Hl. Geistes.<br />
Sie ist, f<strong>in</strong>de ich, von der jüdischen Wurzel nicht abzuschneiden. Die Psalmen s<strong>in</strong>d unersetzlich. Die Erfahrung, die das<br />
Tempelgebet Salomos umschreibt (1Kön 8, 27), die des Elia (1Kön 19, 12), dann die des Gottesknechtes (Jes 53) zeigen immer<br />
wieder die Weite der Frömmigkeit <strong>in</strong> der Bibel. Sie weicht auch der Fremdheit des Gegenübers nicht aus, wenn sie Liebe mit<br />
Wahrheit, Gerechtigkeit mit Gericht, Befreiung mit Entfremdung durch Sünde verb<strong>in</strong>det.<br />
Sprache ist immer Versuch, und die Grenzen von heute können morgen verschoben se<strong>in</strong>. Im Kirchenkampf angesichts e<strong>in</strong>er<br />
wahrhaftigen Irrlehre bekam die Frömmigkeitssprache kämpferische Töne; Fe<strong>in</strong>de wurden nicht geliebt, sondern verurteilt.<br />
Ähnliches gilt von grauer Vorzeit, aus der biblische Geschichten stammen.<br />
Die Korrektur durch das Non-Theistische könnte ohne e<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dung zu Stärke und Reichtum dessen, was kirchbildend<br />
überliefert wurde, privatistisch werden. Das ist an sich unbenommen, stellt nur die eigentliche Grenze dar.“<br />
Kirchengeme<strong>in</strong>schaft bewahren<br />
„Glaube lebt <strong>in</strong> der Kirchengeme<strong>in</strong>schaft, wie „unakzeptabel“ diese Kirche auch sche<strong>in</strong>en mag. Die Überlieferungsgeme<strong>in</strong>schaft,<br />
<strong>in</strong> der man lebt, hat e<strong>in</strong>en Umgang mit ihren Symbolen, der über tausend Jahre auf Lebensdienlichkeit getestet ist,<br />
mehrfach deshalb umgestellt und reformiert. Die Überlieferungsgeme<strong>in</strong>schaft weiß vom historisch Bed<strong>in</strong>gtem. Alles, was sie<br />
oder er von Gott, Jesus, Bibel, Bekennen weiß, hat sie aus dieser Überlieferungsgeschichte. Sie lernte – wenn sie überhaupt<br />
lernbegierig war – mit den Posaunen vor Jericho, mit Tritojesaja, mit der Weihnachtsgeschichte umzugehen. Auch mit der<br />
18