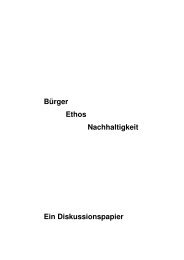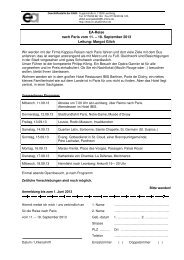Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Religionen nicht mehr geglaubt und vertreten werden.<br />
Vorherbestimmt zum Guten oder Bösen durch Gott?<br />
Dem Themenbereich „Gott als Richter“ kann auch der (<strong>in</strong> manchen Religionsgeme<strong>in</strong>chaften verbreitete) Glaube an die Prä-<br />
dest<strong>in</strong>ation (Vorherbestimmung) zugeordnet werden, der besagt, dass (e<strong>in</strong> als personal und allmächtig verstandener) Gott vor<br />
aller Zeit e<strong>in</strong>en Teil der Menschheit zum Heil bestimmt hat 33 , das also (schon deshalb) nicht durch Leistungen irgendwelcher<br />
Art „verdient“ werden kann. Die „doppelte Prädest<strong>in</strong>ation“ (u.a. vertreten von Johannes Calv<strong>in</strong> im 16. Jhd.) enthält<br />
außerdem die Auffassung, dass Gott e<strong>in</strong>en Teil der Menschheit zum Unheil bestimmt hat. Beide Glaubensaussagen ergeben sich<br />
e<strong>in</strong>erseits aus dem Glauben an Gott als dem absoluten Herrscher über Alles, andererseits haben sie die Heilsgewissheit mancher<br />
Christen bekräftigt.<br />
Sie stehen allerd<strong>in</strong>gs im Widerspruch zu e<strong>in</strong>em freien Willen beim Menschen, weil dieser sich letztlich weder für e<strong>in</strong>e zum<br />
Heil noch für e<strong>in</strong>e zum Unheil führende Lebensweise entscheiden kann. Die E<strong>in</strong>schränkung, dass nur das endgültige Schicksal<br />
e<strong>in</strong>es Individuums vorherbestimmt ist, se<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelnen Handlungen aber durchaus se<strong>in</strong>em freien Willen unterworfen s<strong>in</strong>d, kann<br />
diesen Widerspruch nicht auflösen, ganz abgesehen von der pr<strong>in</strong>zipiellen Widersprüchlichkeit e<strong>in</strong>es Gottesbildes, das Aussagen<br />
über Entscheidungen Gottes vor aller Zeit enthält. (Vor demselben Problem stehen allerd<strong>in</strong>gs auch analog Hirnforscher, die<br />
sowohl freie Entscheidungen des Menschen wie auch deren physiologische Determ<strong>in</strong>ation erkennen).<br />
E<strong>in</strong>e Neuformulierung der Prädest<strong>in</strong>ation wurde im 20. Jahrhundert von Karl Barth versucht. Ausgehend von Calv<strong>in</strong>s Lehre<br />
der doppelten Prädest<strong>in</strong>ation kommt Barth zu dem Schluss, dass sich Gottes Wille <strong>in</strong> Jesus Christus offenbart hat; wie er ist<br />
die ganze Menschheit zu Kreuz und Auferstehung vorherbestimmt, durch ihn s<strong>in</strong>d alle Menschen auserwählt. Allen Menschen ist<br />
die Erlösung versprochen.<br />
Die Lehre von der Vorherbestimmung kann bei entsprechender Interpretation dem Verlangen und der Bereitschaft entge-<br />
genkommen, lebens- und glaubensdienliche Vorgaben für die eigene Existenz zu entdecken und auszuschöpfen.<br />
Da das außerordentlich schwierig ist und sehr stark der <strong>in</strong>dividuellen Willkür oder der von Mitmenschen (oder nach der<br />
Überzeugung von Astrologen der Wirkung von Sternen) unterliegt, wird dieser frühere Glaubens<strong>in</strong>halt von vielen Christen<br />
heute praktisch nicht mehr beachtet. Wesentliche Lebensbestimmungen werden heute eher von der Zukunft als von der<br />
Vergangenheit erwartet.<br />
Jedenfalls kann nur wenig von dem, was unser Ergehen aus unserer Vergangenheit her bee<strong>in</strong>flusst haben mag, mit dem<br />
„Geheimnis unseres tiefsten Ursprungs“ verbunden werden, auch wenn das unser subjektives Bestreben ist.<br />
_____________________________<br />
Anmerkungen<br />
1. Auflage 2004 im Kohlhammer-‐Verlag, Stuttgart<br />
2. Klaus Peter Jörns „Die neuen Gesichter Gottes. Was die Menschen heute wirklich glauben“. C.H.Beck Verlag 1997<br />
Die Überlegungen, die von Kröger ausgehen, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie Gegenstände westeuropäischen Denkens. Reisen nach<br />
Mittel-‐ und Osteuropa und zu Kirchenleitungen und Geme<strong>in</strong>den führen zu Kontakten mit Frömmigkeitsstilen und<br />
theologischen Haltungen, wie wir sie hier nicht oder nicht mehr f<strong>in</strong>den. Die protestantischen M<strong>in</strong>derheitskirchen haben e<strong>in</strong><br />
sehr starkes Bedürfnis nach Sicherheit und klarem Profil, weshalb z. B. auch ökumenische Arbeit nur sehr zögerlich verläuft.<br />
E<strong>in</strong>e Grundsatzdiskussion im Krögerschen S<strong>in</strong>ne würde dort sicherlich als e<strong>in</strong> Signal der Auflösung empfunden werden. Wir<br />
sollten uns also darüber bewusst se<strong>in</strong>, dass wir uns bei dieser Thematik eher im deutschen bzw. westeuropäischen Raum<br />
bewegen.<br />
3. Die <strong>in</strong>dividuelle Vielfalt solcher "privater" Gottesvorstellungen entspr<strong>in</strong>gt allerd<strong>in</strong>gs geme<strong>in</strong>h<strong>in</strong> nicht e<strong>in</strong>em philosophi-‐<br />
schen Bemühen, sondern nährt sich aus e<strong>in</strong>em veränderten, von den Naturwissenschaften geprägten Weltbild, das dem der<br />
Frühantike und Antike, von dem die biblischen Berichte und weith<strong>in</strong> noch immer die Tradition kirchlicher Lehre und<br />
Verkündigung getragen werden, nicht mehr entspricht, ob das <strong>in</strong> jedem Fall stichhaltig zu begründen ist oder auch nicht.<br />
4. Dass dieses Wort Bonhoeffers "weith<strong>in</strong> Zustimmung" f<strong>in</strong>det, kann bezweifelt werden. Ihm steht Bonhoeffers nicht selten<br />
im Gottesdienst zustimmend gesprochenes Glaubensbekenntnis entgegen.<br />
5. Nach e<strong>in</strong>er lexikalische Bestimmung im Wörterbuch des Christentums, Gütersloh, die ihrerseits auf Kant zurückgreift, "<br />
glaubt der Deist an e<strong>in</strong>en Gott, der Theist aber an e<strong>in</strong>en lebendigen Gott". "Deismus ist hier also die Annahme e<strong>in</strong>er<br />
Beziehung zwischen der Welt und e<strong>in</strong>em nichtpersonalen Gott. Theismus zielt auf e<strong>in</strong>en Gott, der mit personenhaften<br />
Qualitäten ausgestattet ist."<br />
36