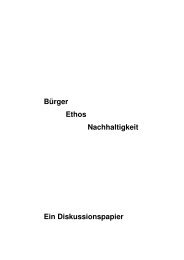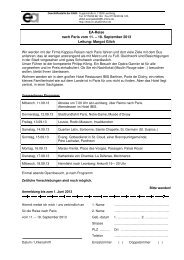Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zurück und werden an e<strong>in</strong> eher naturwissenschaftliches Weltbild angepasst. Der Glaube an Gott wird <strong>in</strong>dividueller und<br />
entspricht zunehmend nicht mehr den kirchlichen Vorgaben und Lehren. 2<br />
<strong>Kroeger</strong> geht von e<strong>in</strong>er Situation des Protestantismus aus, dem die Gläubigen abhanden kommen. Diesen Verlust führt er<br />
letzten Endes auf e<strong>in</strong>e Art theologischer Weltfremdheit zurück, die sich nicht darum kümmert, welches Bild sich die Men-schen<br />
<strong>in</strong> der wissenschaftlich-technischen Moderne von Gott und der Welt machen. Vielmehr hielten die Kirche und ihre Theologen<br />
an unverständlich gewordenen Formen der Lehre, der Verkündigung und der Liturgie fest, die mit dem Lebens-gefühl ihrer<br />
Mitglieder nicht mehr korrespondieren. Er spricht dabei auch das Bultmannsche Entmythologisierungsprojekt an, das zu früh<br />
abgebrochen worden sei.<br />
Der Glaube an e<strong>in</strong>en existierenden Gott (Theismus) ist nicht mehr selbstverständlich. Das Zitat Dietrich Bonhoeffers „E<strong>in</strong>en<br />
Gott, den es gibt, gibt es nicht“ f<strong>in</strong>det weith<strong>in</strong> (ohne Beachtung des Zusammenhangs bei B. ) Zustimmung 3 , auch wenn über-<br />
wiegend weiter von e<strong>in</strong>em handelnden, hörenden und e<strong>in</strong>greifenden Gott geredet wird :<br />
„Er“ „tut“, „plant“, „hilft“, „beschützt“, „ist ...“, „will“, belohnt und bestraft. Wir können nicht ernsthaft bezweifeln, dass sich<br />
das Gottesbild nicht weniger Christen bei uns verändert hat, selbst wenn das für die Christen <strong>in</strong> anderen Teilen der Welt<br />
offenbar <strong>in</strong> weit ger<strong>in</strong>gerem Maß zutrifft. Sie beten dann zu Gott nicht mehr als dem Allmächtigen, der direkt <strong>in</strong> den Ablauf<br />
irdischen Geschehens e<strong>in</strong>greift und die Geschicke der Völker nach se<strong>in</strong>em Heilsplan lenkt. Sie verb<strong>in</strong>den mit „Gott“ weniger die<br />
Vorstellung e<strong>in</strong>er Person, der man e<strong>in</strong>en Namen geben kann, von Jahwe wie im alten Testament, von Gott dem Vater Jesu<br />
Christi und letztlich aller Menschen. sondern <strong>in</strong> Begriffen, oft von großer, <strong>in</strong>s Metaphorische übergehender Allgeme<strong>in</strong>heit, wie<br />
„Transzendenz“ , „Urgrund des Se<strong>in</strong>s“. „größere Wirklichkeit“, „Kraft“, „Liebe“.<br />
Im Weiteren zieht <strong>Kroeger</strong> bewährte biblische, theologische und neue wissenschaftliche, <strong>in</strong>zwischen allgeme<strong>in</strong> anerkannte<br />
Erkenntnisse heran: „Die göttliche Wirklichkeit ist nur symbolisch zugänglich: „Gott wohnt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Licht, da niemand<br />
zukommen kann“, (1.Tim 6,16). Niemand kann - mit welchen Mitteln auch immer - <strong>in</strong> dieses Geheimnis dr<strong>in</strong>gen. Es wird im<br />
nichtwissenden Verehren „verstanden’“. Deshalb kann „die letzte göttliche Grundwirklichkeit nur <strong>in</strong> Symbolen, Bildern und<br />
Analogien erkannt, beschrieben und verstanden werden.“<br />
‚Gott’ ist im non-theistischen Verständnis (so wie alttestamentlich Jahve) Name e<strong>in</strong>er uns umgebenden, umfangenden, (immer<br />
wieder auch richtenden und bedrohenden) überpersönlichen Wirklichkeit. Die Bilder, Symbole und Analogien, <strong>in</strong> denen von<br />
dieser überpersönlichen Wirklichkeit geredet wird, s<strong>in</strong>d geschichtlich wandelbar. Wir selber suchen, wählen und verantworten<br />
daher <strong>in</strong> unserer religiösen Entwicklungsgeschichte die zu wählenden und für uns aussagefähigen Formen, Symbole und Bilder.“<br />
Als Namen bzw. Bezeichnungen für „das Göttliche“ führt <strong>Kroeger</strong> an: „Grund, Wurzel und Geheimnis aller Wirklichkeit.“<br />
„Das Unbed<strong>in</strong>gte“, „die letzte, uns umfangende Wirklichkeit“, „die Erfahrung von Gnade.“ „Diese Erfahrungen, auch wenn sie<br />
ohne e<strong>in</strong>en persönlichen Gott gedacht werden, s<strong>in</strong>d jedoch exakt Erfahrungsweisen des Göttlichen und Bestimmungsstücke des<br />
Glaubens. Man kann sich ihnen durchaus öffnen und annähern, ohne an e<strong>in</strong>en persönlichen, existierenden und regierenden Gott<br />
zu glauben.“<br />
„Der Wechsel der Denk- und Vorstellungsformen ist zwar e<strong>in</strong> oft schmerzlicher und e<strong>in</strong> anstrengender Vorgang.“ Aber er kann<br />
auch e<strong>in</strong>e Befreiung bedeuten und Zweifel überw<strong>in</strong>den helfen. Der christliche Glaube ist nicht an bestimmte Weltbilder<br />
gebunden. Diese wechseln schon <strong>in</strong>nerhalb der Entstehungszeit der Bibel und <strong>in</strong>nerhalb der Zeit der Kirche. Die gestellte<br />
Aufgabe ist, angesichts des derzeit gängigen Wirklichkeitsverständnisses e<strong>in</strong> Reden über den Gott zu f<strong>in</strong>den, an den wir glauben.<br />
<strong>Kroeger</strong> versucht, e<strong>in</strong>e Theologie ohne Metaphysik zu denken, d.h. unter anderem auch ohne Vorstellung e<strong>in</strong>er supranaturalen<br />
"Gottperson" (für ihn ist dies e<strong>in</strong>e anthropomorphe Projektion), über deren Eigenschaften, Wesen und Absichten nur spekuliert<br />
werden kann. Gott bzw. das Göttliche bleibt für ihn e<strong>in</strong> Geheimnis - allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong> <strong>in</strong>haltloses, <strong>in</strong> völliger Beliebigkeit<br />
verschwimmendes Geheimnis. Der Mensch Jesus von Nazareth ist für ihn e<strong>in</strong> - wenn auch nicht der e<strong>in</strong>zige - legitimer Weg zu<br />
e<strong>in</strong>em überzeugenden Gottesverständnis. Mit der Bezeichnung „non-theistisch“ (an Gott glauben) wendet er sich gegen den<br />
Atheismus, der ke<strong>in</strong>erlei Offenheit mehr für das Unbed<strong>in</strong>gte und das Geheimnis <strong>in</strong> allen D<strong>in</strong>gen hat. Atheismus sei<br />
überwiegend e<strong>in</strong>e Konsequenz oder gar erzwungener Reflex auf den bisher christlich und kirchlich allzu selbstverständlichen<br />
Theismus und werde oft mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen verbunden. 4 Deshalb „sei mehr auf religiöse bzw.<br />
spirituelle Auffassungsvarianten zu achten, die weder theistisch noch atheistisch s<strong>in</strong>d, und dafür auch e<strong>in</strong> anderer Begriff als den<br />
2