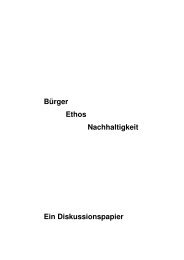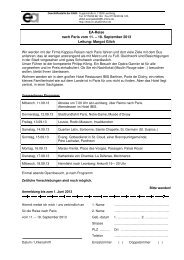Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Matthias Kroeger - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
die Überzeugung bzw. die Vorstellung durch, dass es so etwas wie e<strong>in</strong>en — schon gar als „Person“ – existierenden und die Welt<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Vorsehung regierenden Gott gar nicht gibt.“<br />
Es sei zwar seit geraumer Zeit festzustellen, dass alles <strong>in</strong> der Theologie entmythologisiert bzw. als entmythologisierungsfähig<br />
angesehen wird. So werde selbstverständlich der Teufel, das personale Widerspiel Gottes, der Entmythologisierung<br />
preisgegeben. In Sprache und Syntax von Theologie und Predigt wird aber ständig so getan, als sei e<strong>in</strong> handelnder, hörender und<br />
e<strong>in</strong>greifender Gott ständig präsent:<br />
Nach bisherigem Verständnis der Theodizee („Warum lässt Gott das zu?“; “Verursacht er auch Böses?“) „soll es e<strong>in</strong><br />
„persönlicher“, personartiger, wenn auch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Geheimnissen unbegreiflicher Gott se<strong>in</strong>, der die e<strong>in</strong>en im Unglück bewahrt,<br />
die andern im Autounfall, im Irak-, im Jugoslawienkrieg oder erst recht im Holocaust grausam umkommen lässt.<br />
<strong>Kroeger</strong> will Ernst machen mit dem bekannten Zitat Dietrich Bonhoeffers „E<strong>in</strong>en Gott, den es gibt, gibt es nicht.“ Damit will er<br />
aber ke<strong>in</strong>em Atheismus Vorschub leisten, der ke<strong>in</strong>erlei Offenheit mehr für das Unbed<strong>in</strong>gte und das Geheimnis <strong>in</strong> al-len D<strong>in</strong>gen<br />
hat und der überwiegend e<strong>in</strong>e Konsequenz oder gar erzwungener Reflex auf den bisher christlich und kirchlich allzu<br />
selbstverständlichen Theismus sei. Atheismus folge speziell aus naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Deshalb „sei mehr auf<br />
religiöse bzw. spirituelle Auffassungsvarianten zu achten, die weder theistisch noch atheistisch s<strong>in</strong>d, und dafür auch e<strong>in</strong> anderer<br />
Begriff als den des Atheismus zu wählen.“ Kröger schlägt „deshalb für die religiösen, aber nicht an e<strong>in</strong>en Gott glaubenden<br />
Selbstauffassungen den Begriff des „Non-Theismus“ vor.<br />
Im Weiteren zieht er bewährte biblische, theologische und neue wissenschaftliche, <strong>in</strong>zwischen allgeme<strong>in</strong> anerkannte<br />
Erkenntnisse heran: „Die göttliche Wirklichkeit ist nur symbolisch zugänglich.. Niemand kann - mit welchen Mitteln auch<br />
immer - <strong>in</strong> dieses Geheimnis dr<strong>in</strong>gen. Es wird im nichtwissenden Verehren „verstanden’“. Deshalb kann „die letzte göttliche<br />
Grundwirklichkeit nur <strong>in</strong> Symbolen, Bildern und Analogien erkannt, beschrieben und verstanden werden.“ Damit hat die<br />
Diskussion Anteil an der Dialektik, dass „Gott wohnt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Licht, da niemand zukommen kann“ (1.Tim. 6,16), diese<br />
Unanschaulichkeit aber droht, zur Leere, ja zu e<strong>in</strong>em Nichts zu werden. Jesus hat von Gott <strong>in</strong> Gleichnisgeschichten erzählt.<br />
Namen für „Gott“<br />
Das neue Gottesverständnis (Non-Theismus) zeigt sich <strong>in</strong> der Bevorzugung von allgeme<strong>in</strong>en Begriffen wie „das Göttliche“,<br />
„Grund, Wurzel und Geheimnis aller Wirklichkeit.“ „Das Unbed<strong>in</strong>gte“, „die letzte, uns umfangende Wirklichkeit“, „die<br />
Erfahrung von Gnade.“ als Namen für Gott.<br />
‚Gott’ ist im non-theistischen Verständnis (so wie alttestamentlich Jahve) Name e<strong>in</strong>er uns umgebenden, umfangenden, (immer<br />
wieder auch richtenden und bedrohenden) überpersönlichen Wirklichkeit. Die Bilder, Symbole und Analogien, <strong>in</strong> denen von<br />
dieser überpersönlichen Wirklichkeit geredet wird, s<strong>in</strong>d geschichtlich wandelbar. Wir selber suchen, wählen und verantworten<br />
daher <strong>in</strong> unserer religiösen Entwicklungsgeschichte die zu wählenden und für uns aussagefähigen Formen, Symbole und Bilder.“<br />
Als Namen bzw. Bezeichnungen für „das Göttliche“ führt <strong>Kroeger</strong> an: „Grund, Wurzel und Geheimnis aller Wirklichkeit.“<br />
„Das Unbed<strong>in</strong>gte“, „die letzte, uns umfangende Wirklichkeit“, „die Erfahrung von Gnade.“ „Diese Erfahrungen, auch wenn sie<br />
ohne e<strong>in</strong>en persönlichen Gott gedacht werden, s<strong>in</strong>d jedoch exakt Erfahrungsweisen des Göttlichen und Bestimmungsstücke des<br />
Glaubens. Man kann sich ihnen durchaus öffnen und annähern, ohne an e<strong>in</strong>en persönlichen, existierenden und regierenden Gott<br />
zu glauben.“<br />
„Der Wechsel der Denk- und Vorstellungsformen ist zwar e<strong>in</strong> oft schmerzlicher und e<strong>in</strong> anstrengender Vorgang.“ Aber er kann<br />
auch e<strong>in</strong>e Befreiung bedeuten und Zweifel überw<strong>in</strong>den helfen. Zunächst stehe jetzt nur e<strong>in</strong>e Revision des Gottesbildes, nicht<br />
e<strong>in</strong>e der mit diesem geme<strong>in</strong>te Wirklichkeit an. Die Verwendung personaler Gottesnamen ist weiterh<strong>in</strong> möglich und e<strong>in</strong>e<br />
komplementäre Geltung theistischen und non-theistischen (transtheistischen) Denkens ist s<strong>in</strong>nvoll und wünschenswert. Das<br />
bisher überwiegende theistische und das nontheistische Gottesverständnis können sich sogar gegenseitig ergänzen (sie sollten<br />
sich respektieren und tolerieren). 17<br />
Die von vielen als bedrohlich empfundene Zumutung e<strong>in</strong>es non-theistischen Gottesbildes wird auch dadurch abgemildert, dass<br />
<strong>Kroeger</strong> auch künftig die Verwendung personaler Gottesnamen für möglich hält und e<strong>in</strong>e komplementäre Geltung theistischen<br />
und non-theistischen (transtheistischen) Denkens für s<strong>in</strong>nvoll und wünschenswert ansieht. Das unterstützend zitiert er Paul<br />
26