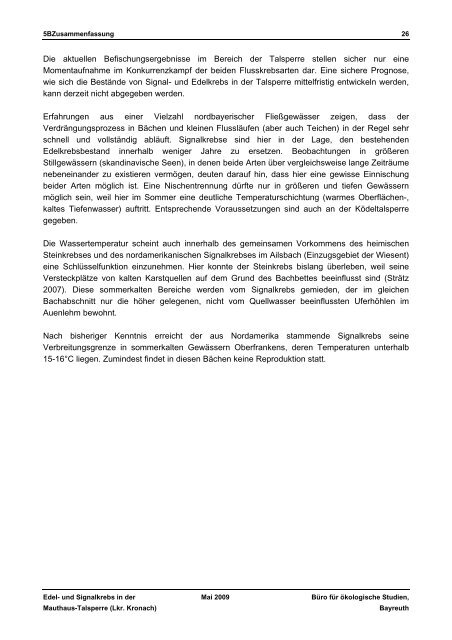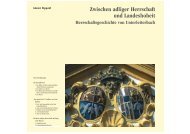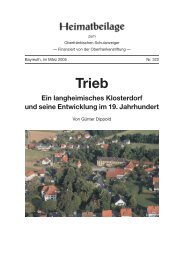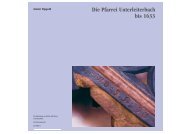Dipl. Geoökologe Christian Strätz - Bezirk Oberfranken
Dipl. Geoökologe Christian Strätz - Bezirk Oberfranken
Dipl. Geoökologe Christian Strätz - Bezirk Oberfranken
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5BZusammenfassung 26<br />
Die aktuellen Befischungsergebnisse im Bereich der Talsperre stellen sicher nur eine<br />
Momentaufnahme im Konkurrenzkampf der beiden Flusskrebsarten dar. Eine sichere Prognose,<br />
wie sich die Bestände von Signal- und Edelkrebs in der Talsperre mittelfristig entwickeln werden,<br />
kann derzeit nicht abgegeben werden.<br />
Erfahrungen aus einer Vielzahl nordbayerischer Fließgewässer zeigen, dass der<br />
Verdrängungsprozess in Bächen und kleinen Flussläufen (aber auch Teichen) in der Regel sehr<br />
schnell und vollständig abläuft. Signalkrebse sind hier in der Lage, den bestehenden<br />
Edelkrebsbestand innerhalb weniger Jahre zu ersetzen. Beobachtungen in größeren<br />
Stillgewässern (skandinavische Seen), in denen beide Arten über vergleichsweise lange Zeiträume<br />
nebeneinander zu existieren vermögen, deuten darauf hin, dass hier eine gewisse Einnischung<br />
beider Arten möglich ist. Eine Nischentrennung dürfte nur in größeren und tiefen Gewässern<br />
möglich sein, weil hier im Sommer eine deutliche Temperaturschichtung (warmes Oberflächen-,<br />
kaltes Tiefenwasser) auftritt. Entsprechende Voraussetzungen sind auch an der Ködeltalsperre<br />
gegeben.<br />
Die Wassertemperatur scheint auch innerhalb des gemeinsamen Vorkommens des heimischen<br />
Steinkrebses und des nordamerikanischen Signalkrebses im Ailsbach (Einzugsgebiet der Wiesent)<br />
eine Schlüsselfunktion einzunehmen. Hier konnte der Steinkrebs bislang überleben, weil seine<br />
Versteckplätze von kalten Karstquellen auf dem Grund des Bachbettes beeinflusst sind (<strong>Strätz</strong><br />
2007). Diese sommerkalten Bereiche werden vom Signalkrebs gemieden, der im gleichen<br />
Bachabschnitt nur die höher gelegenen, nicht vom Quellwasser beeinflussten Uferhöhlen im<br />
Auenlehm bewohnt.<br />
Nach bisheriger Kenntnis erreicht der aus Nordamerika stammende Signalkrebs seine<br />
Verbreitungsgrenze in sommerkalten Gewässern <strong>Oberfranken</strong>s, deren Temperaturen unterhalb<br />
15-16°C liegen. Zumindest findet in diesen Bächen keine Reproduktion statt.<br />
Edel- und Signalkrebs in der Mai 2009 Büro für ökologische Studien,<br />
Mauthaus-Talsperre (Lkr. Kronach) Bayreuth