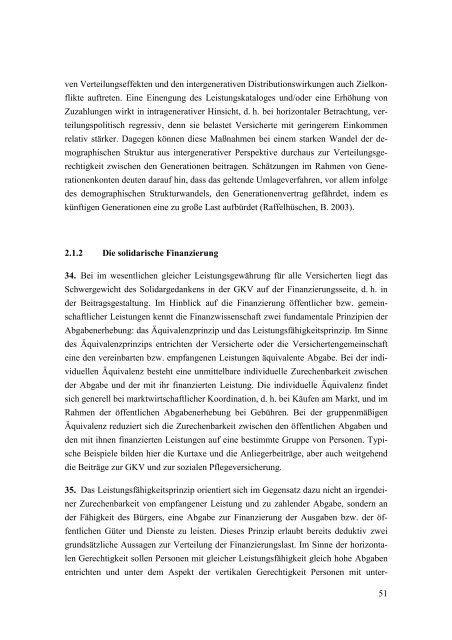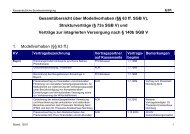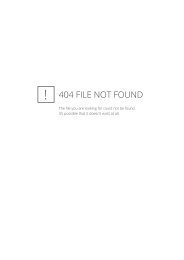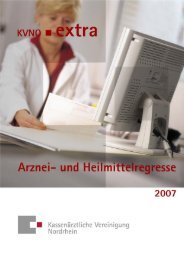- Seite 1 und 2: Band I: Finanzierung und Nutzerorie
- Seite 3 und 4: enten kaum mit Rationierungen, wie
- Seite 5 und 6: 11. Im Hinblick auf die Beitragsges
- Seite 7 und 8: 15. Qualitätsgesicherte Informatio
- Seite 9 und 10: heitsförderung im Setting Schule n
- Seite 11 und 12: − eine morbiditätsorientierte Ve
- Seite 13: technischer Entwicklungen sowie (zu
- Seite 16 und 17: Aspekten zu analysieren und gegenei
- Seite 20 und 21: schiedlicher Leistungsfähigkeit un
- Seite 22 und 23: Krankheitsrisikos, wenn seine Krank
- Seite 24 und 25: 43. In der jüngsten repräsentativ
- Seite 26 und 27: Tabelle 1: Zustimmung zu unterschie
- Seite 28 und 29: Abbildung 3: Zustimmung von Versich
- Seite 30 und 31: 47. Versucht man ein Zwischenfazit
- Seite 32 und 33: 2.2 Perspektiven der Einnahmen- und
- Seite 34 und 35: Abbildung 5: Einnahmen der gesetzli
- Seite 36 und 37: Abbildung 6: Wachstum der beitragsp
- Seite 38 und 39: 57. Eine steigende (sinkende) Lohnq
- Seite 40 und 41: 4. Die Bruttoeinkommen aus unselbst
- Seite 42 und 43: − − Arbeitslose und freiwillig
- Seite 44 und 45: Abbildung 10: Anteil der Rentner an
- Seite 46 und 47: Versicherungsrisiken, die per Saldo
- Seite 48 und 49: 69. Die Verschiebung der demographi
- Seite 50 und 51: Abbildung 13: Verhältnis von GKV-
- Seite 52 und 53: 2.2.2.2 Grundlegende Determinanten
- Seite 54 und 55: dern die ausgabensteigernden Produk
- Seite 56 und 57: 2.2.3 Beitragssatzstabilität im Ko
- Seite 58 und 59: Tarifverhandlungen steigende Arbeit
- Seite 60 und 61: − − − Für die Reaktionen von
- Seite 62 und 63: Abbildung 16: Das Wachstum der Abga
- Seite 64 und 65: Für das im Vergleich zu den Steuer
- Seite 66 und 67: Tabelle 4: Arbeitgeber- und Arbeitn
- Seite 68 und 69:
− − − − − − − Reorgan
- Seite 70 und 71:
des objektiven Bedarfs, der sie abe
- Seite 72 und 73:
Wettbewerb auf Anbieterseite derzei
- Seite 74 und 75:
100. Die Bundesregierung versuchte
- Seite 76 und 77:
des Krankheitsrisikos übertragen.
- Seite 78 und 79:
erhebliches Finanzierungsproblem au
- Seite 80 und 81:
2.3.4 Die Finanzierung mit Hilfe vo
- Seite 82 und 83:
115. Für eine Finanzierung der soz
- Seite 84 und 85:
Prämie bei Beitragsfreiheit von Ki
- Seite 86 und 87:
gäbe sich ein neues Feld für die
- Seite 88 und 89:
Generation erhalten, beruht - wie o
- Seite 90 und 91:
2.3.5.2 Zum Leistungskatalog der GK
- Seite 92 und 93:
− die ohne Vorliegen einer Krankh
- Seite 94 und 95:
− − nicht wirksame Verfahren de
- Seite 96 und 97:
der unmittelbaren Teilzahlung für
- Seite 98 und 99:
− den gesamten Aufwendungen: allg
- Seite 100 und 101:
fiskalischen Umfang eine eingehende
- Seite 102 und 103:
dritte Familie C auf, die eine Eink
- Seite 104 und 105:
Grenze reichen. Die Variante einer
- Seite 106 und 107:
damit auch zu keinen allokativen un
- Seite 108 und 109:
Die Verbreiterung der Beitragsbemes
- Seite 110 und 111:
sche Nachteile entstehen, da es sic
- Seite 112 und 113:
hoch wie eine Familie mit einem erw
- Seite 114 und 115:
Von der Selbstbeteiligung gehen abe
- Seite 116 und 117:
165. Die Diskussionen um das Pro un
- Seite 118 und 119:
auch jene Versicherten, die sich im
- Seite 120 und 121:
gen. Dabei stellen der Befund einer
- Seite 122 und 123:
auch um Ausgabenbegrenzung bildet i
- Seite 124 und 125:
Der Übergang zu einer Kapitaldecku
- Seite 126 und 127:
tender Budgetdefizite. Zunächst se
- Seite 128 und 129:
sen, liegen je nach Abgrenzung bei
- Seite 130 und 131:
− − nicht wirksame Verfahren de
- Seite 132 und 133:
202. Angesichts der im internationa
- Seite 134 und 135:
Interdependenzen zwischen den Refor
- Seite 136 und 137:
2.5 Literatur Akademie für Ethik i
- Seite 138 und 139:
Ministerium für Arbeit, Gesundheit
- Seite 140 und 141:
Wille, E. (1998): Zukünftige finan
- Seite 142 und 143:
Tabelle A2: Wachstum der beitragspf
- Seite 144 und 145:
Tabelle A4: Je Beitragszahler zu fi
- Seite 146 und 147:
Fortsetzung Tabelle A6 Jahr Mitglie
- Seite 148 und 149:
180
- Seite 150 und 151:
Die moderne Medizin induziert nach
- Seite 152 und 153:
216. In einem solchen historisch-ge
- Seite 154 und 155:
gen kann diese Zustimmung nachträg
- Seite 156 und 157:
3.1.3 Zur politischen und instituti
- Seite 158 und 159:
gelleistung in Absprache mit dem Pa
- Seite 160 und 161:
onseinrichtungen ausgedehnt und im
- Seite 162 und 163:
231. Patientenzufriedenheit kann mi
- Seite 164 und 165:
Diese subjektiven Konzepte des Pati
- Seite 166 und 167:
angewandten Medizin zwischen Objekt
- Seite 168 und 169:
ebene des Gesundheitswesens partizi
- Seite 170 und 171:
ar sind, und hinterlässt charakter
- Seite 172 und 173:
Weise kann die Angemessenheit der m
- Seite 174 und 175:
is, B. 2000). Ausländische Erfahru
- Seite 176 und 177:
Tabelle 6: Prioritätenbildung und
- Seite 178 und 179:
Die Zusammenstellung lässt erkenne
- Seite 181 und 182:
266. Weiterführende Vorstellungen
- Seite 183 und 184:
Als weiteres Element könnten gemä
- Seite 185 und 186:
schüssen der Selbstverwaltung (Bun
- Seite 187 und 188:
stem hat der Rat in Band I, Kap. 3
- Seite 189 und 190:
Der ‚informierte Patient‘ wird
- Seite 191 und 192:
− − − − Information über d
- Seite 193 und 194:
Anpassung an Verlustsituationen 285
- Seite 195 und 196:
− − − − Beratungshilfe aus
- Seite 197 und 198:
− ‚Assessment‘: In dieser Pha
- Seite 199 und 200:
296. An der Ausschreibung der Spitz
- Seite 201 und 202:
HANDLUNGSFELD Medieneinsatunanalyse
- Seite 203 und 204:
EINRICHTUNG Hannover: Informationss
- Seite 205 und 206:
3.3.3 Qualitätssicherung bei der B
- Seite 207 und 208:
pieempfehlungen oder (Fern-)Diagnos
- Seite 209 und 210:
Von den Bewerbern wurde schon im Ra
- Seite 211 und 212:
gibt den Mitarbeitern unmittelbare
- Seite 213 und 214:
3.3.4.1 Wachsende Bedeutung des Int
- Seite 215 und 216:
312. Das zunehmend kommerzielle Int
- Seite 217 und 218:
haltlich korrekt. Alle Websites erf
- Seite 219 und 220:
10. Transparenz über Datenverwendu
- Seite 221 und 222:
− − − − Auch ‚non-for-pro
- Seite 223 und 224:
3.3.5 Leistungsberichte als Instrum
- Seite 225 und 226:
Kenntnisse verständlich und enthal
- Seite 227 und 228:
formationsbedürfnis der Patienten
- Seite 229 und 230:
338. In mittelfristiger Zukunft sol
- Seite 231 und 232:
Unabhängige Einrichtungen zur Verb
- Seite 233 und 234:
Ansätze und Medien der Beratung im
- Seite 235 und 236:
Beobachtungen insbesondere von Vers
- Seite 237 und 238:
Websites oder Portale bestehen. Im
- Seite 239 und 240:
Grad der Erfüllung dieses wichtige
- Seite 241 und 242:
Baltes, M., Maas, I., Wilms, H.-U.
- Seite 243 und 244:
Eysenbach, G., Sa, R.E. and Diepgen
- Seite 245 und 246:
Joos, S.K., Hickam, D.H., Gordon, G
- Seite 247 und 248:
Reibnitz, C. v. und Litz, D. (1999)
- Seite 249 und 250:
Wagner, U. (2002): Stimulation der
- Seite 251 und 252:
4. Fehler in der Medizin - Ursachen
- Seite 253 und 254:
Folge von Über- und Fehlversorgung
- Seite 255 und 256:
nach ist von Fehlversorgung auszuge
- Seite 257 und 258:
Fortsetzung von Tabelle 11 Begriff
- Seite 259 und 260:
Abbildung 21: Überlappung englisch
- Seite 261 und 262:
Tabelle 12: Fehlertaxonomie der LIN
- Seite 263 und 264:
lediglich die ‚Spitze eines Eisbe
- Seite 265 und 266:
377. Über die Anzahl der zivilgeri
- Seite 267 und 268:
Tabelle 14: Häufigkeit von Fehlerv
- Seite 269 und 270:
ihrem Leben einen Behandlungsfehler
- Seite 271 und 272:
schätzten) Prävalenzraten für no
- Seite 273 und 274:
387. Nach Daten einer aktuellen US-
- Seite 275 und 276:
schließlich der Pflege- und Altenh
- Seite 277 und 278:
Tabelle 19: ‚Schweizer-Käse-Mode
- Seite 279 und 280:
den Patienten gegebenenfalls rechtz
- Seite 281 und 282:
Wartungsarbeiten beruhen. Sie sind
- Seite 283 und 284:
Tabelle 21: Unmittelbare Ursachen v
- Seite 285 und 286:
403. Auch eine vorläufige Auswertu
- Seite 287 und 288:
405. In der Verantwortung der einze
- Seite 289 und 290:
408. Fehler, die durch Übernahmeve
- Seite 291 und 292:
konnte so erheblich gesenkt werden.
- Seite 293 und 294:
heit erhöht werden können. In der
- Seite 295 und 296:
men. 115 Bereits 1997 wurde die Adv
- Seite 297 und 298:
Tabelle 26: Empfehlungen der Nation
- Seite 299 und 300:
− − − Eine Kultur des offenen
- Seite 301 und 302:
Tabelle 28: Empfehlungen des britis
- Seite 303 und 304:
oftmals ungenutzte Motivationsgrund
- Seite 305 und 306:
die Sicherheit von Patienten. Die V
- Seite 307 und 308:
434. Dennoch bleibt festzustellen,
- Seite 309 und 310:
sind der Wunsch nach Erklärung und
- Seite 311 und 312:
Abbildung 23: Mögliche Schritte au
- Seite 313 und 314:
Tabelle 30: Gründe, warum Betroffe
- Seite 315 und 316:
Im Folgenden werden - nach einleite
- Seite 317 und 318:
Die sich aus der Haftung des Arztes
- Seite 319 und 320:
453. Wird eine bestrittene Tatsache
- Seite 321 und 322:
In einigen Städten existieren zwar
- Seite 323 und 324:
Tabelle 31: Beratungsleistungen a)
- Seite 325 und 326:
entscheidet die Krankenkasse, nicht
- Seite 327 und 328:
kassen als Wettbewerbsinstrumente g
- Seite 329 und 330:
Sachsen), d.h. in diesen Stellen we
- Seite 331 und 332:
stelle als unbegründet abgelehnte
- Seite 333 und 334:
475. Gleichlautende Kritik wird auc
- Seite 335 und 336:
entenvertretern an den Verfahren vo
- Seite 337 und 338:
4.6.5 Arzthaftpflichtprozess 480. S
- Seite 339 und 340:
kologie und Geburtshilfe), eine Anh
- Seite 341 und 342:
Abbildung 26: Ebenen einer offenen
- Seite 343 und 344:
wertung der Verfahren findet jedoch
- Seite 345 und 346:
9. Koordination und Integration der
- Seite 347 und 348:
zieren, dass die Haftpflichtversich
- Seite 349 und 350:
4.8 Literatur AHRQ (2000a): Medical
- Seite 351 und 352:
Cheney, F.W. (1999): The American S
- Seite 353 und 354:
Hyams, A.L., Brandenburg, J.A., Lip
- Seite 355 und 356:
Reason, J. (2000): Human error: mod
- Seite 357 und 358:
Vincent, C., Taylor-Adams, S. and S