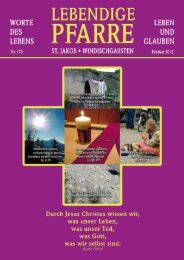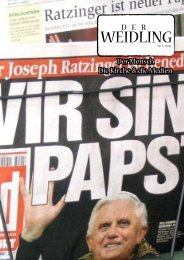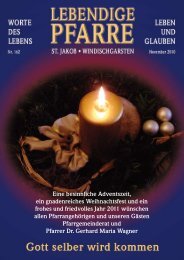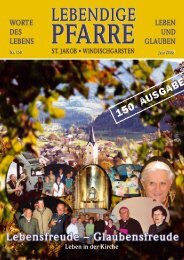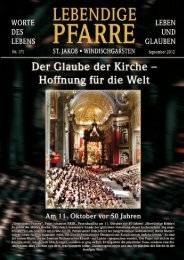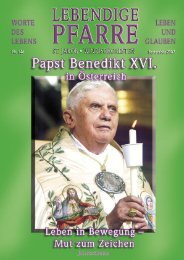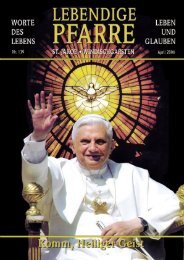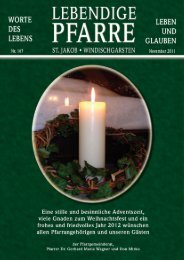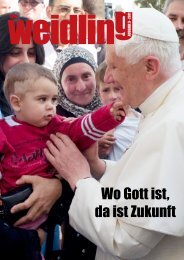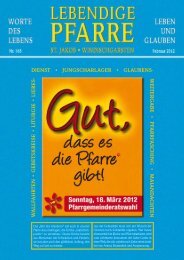Pfarrbrief 174 - Pfarre Windischgarsten - Diözese Linz
Pfarrbrief 174 - Pfarre Windischgarsten - Diözese Linz
Pfarrbrief 174 - Pfarre Windischgarsten - Diözese Linz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Europa und Weltkirche<br />
In den letzten Jahrzehnten hat die albanische<br />
Bevölkerung große Veränderungen<br />
erfahren. In der Zeit von Ex-Jugoslawien<br />
war die Geburtenrate im Kosovo sehr hoch,<br />
jedoch haben die wirtschaftliche Situation<br />
einerseits und die Polizeigewalt andererseits<br />
dazu geführt, dass eine große Zahl der Menschen<br />
aus dem Kosovo geflohen ist. Auch<br />
viele Gläubigen haben so gehandelt und sind<br />
in die Schweiz, Deutschland, Österreich,<br />
Kroatien, USA, Italien und in viele andere<br />
Orte in Europa und Welt ausgewandert.<br />
Deshalb hat sich die Zahl der Gläubigen<br />
im Kosovo merklich verringert und bewegt<br />
sich heute bei ca. 45.000. Die Katholiken<br />
leben in 25 Pfarrgemeinden und haben enge<br />
Beziehungen zur Kirche. Die überwiegende<br />
Mehrheit übt ihren Glauben aus und<br />
empfängt regelmäßig die Sakramente. Im<br />
Kosovo kennt man keinen Priestermangel,<br />
dazu gibt es viele Kandidaten, die sich auf<br />
das Priesteramt vorbereiten.<br />
Die Christianisierung der Albaner erfolgte<br />
direkt durch die Apostel. Der hl. Apostel<br />
Paulus schreibt in Röm 15,19: „So habe ich<br />
von Jerusalem aus in weitem Umkreis bis<br />
nach Illyrien überallhin das Evangelium<br />
Christi gebracht.“ Jene Gebiete, die heute von<br />
Albanern bewohnt werden, waren illyrische<br />
Gebiete, deren Nachfahren heute noch dort<br />
Gender-Ideologie in Australien<br />
Die Gender-Mainstreaming-Ideologie, wonach jeder Mensch<br />
geschlechtsneutral geboren und nur durch Erziehung und<br />
Umwelt zu Mann und Frau gemacht würde, wird seit 1995<br />
weltweit politisch umgesetzt: Australische Bürger haben seit<br />
September 2011 drei Möglichkeiten, im Personalausweis ihr<br />
Geschlecht einzutragen – und zwar: männlich, weiblich oder<br />
„unentschieden“. Die australische Regierung erklärte, mit<br />
dieser Bestimmung einer Diskriminierung entgegenwirken<br />
zu wollen.<br />
Katholiken im<br />
Kosovo<br />
leben. Nachdem das Volk zwischen zwei<br />
Kulturen lebte (der hellenistischen und der<br />
römischen Kultur), wird deutlich, dass sie<br />
eine große Last der Geschichte zu tragen<br />
hatte. So haben deshalb viele Kriege stattgefunden,<br />
und das Volk der Albaner hat der<br />
Kirche viele Heilige und Märtyrer geschenkt,<br />
wie z.B. den heiligen Flori und den heiligen<br />
Lauri, den heiligen Hieronymus, die hl. Niketa<br />
und die sel. Mutter Teresa, die 40 Märtyrer,<br />
für die der Seligsprechungsprozess läuft, und<br />
viele andere. Durch die Osmanen kam es zur<br />
gewaltsamen Islamisierung der Albaner. Die<br />
Albaner, die damals ihre christliche Identität<br />
geheim hielten, wissen um die Schäden,<br />
die die Osmanen ihnen zugefügt haben,<br />
sie sind auch der katholischen Kirche und<br />
ihren Priestern dankbar für die Bewahrung<br />
und Pflege der Kultur und der islamischen<br />
Sprache. Daneben hat der katholische Klerus<br />
auch zum politischen Leben beigetragen<br />
und war immer widerständig gegen die<br />
Unterdrücker der albanischen Gebiete. Nicht<br />
zufällig wurde Mons. Nikolee Kacorri stellvertretender<br />
Ministerpräsident der ersten<br />
albanischen Regierung in Vlora am 28. November<br />
1912. Es gibt keine Ereignisse in der<br />
Geschichte des Volkes, in denen nicht der<br />
albanische Klerus eine sehr wichtige Rolle<br />
für die nationale Frage gespielt hätte. Auch<br />
war der katholische Klerus Unterstützer<br />
des albanischen Volkes zum Schutz der<br />
Demokratie und gegen die kommunistische<br />
Diktatur. Der katholische Klerus war immer<br />
das Bewusstsein der Nation.<br />
Heute erlebt die katholische Kirche im<br />
Kosovo wie die gesamte menschliche Gesellschaft<br />
eine tiefe Identitätskrise. Die Gläubigen<br />
stehen in Einheit mit dem Heiligen<br />
Vater, und die Kirche versucht, ihre eigene<br />
Autorität zu wahren, indem sie Schritt für<br />
Schritt mit der Zeit geht und indem sie auf<br />
die Bedürfnisse der Menschen antwortet.<br />
Gleich beabsichtigt sie, eine Stimme des<br />
Gewissens für das albanische Erbe und<br />
Wegweisung der europäischen Zivilisation<br />
zu sein. Der Albaner ist im Kern ein sehr<br />
religiöser Mensch, und auch heute gibt es<br />
viele, die sich zum katholischen Glauben<br />
bekehren. Die serbisch-orthodoxe Kirche<br />
im Kosovo genoss in der Vergangenheit und<br />
noch heute alle staatlichen Privilegien und<br />
die Privilegien der Europäischen Gemeinschaft.<br />
Die Schuld dafür, dass sie sich isoliert<br />
hat, muss sie sich selber zuschreiben.<br />
Benedikt XVI. und die Republik Kongo<br />
Dass der Papst bis zum letzten Moment tätig war, zeigt, dass<br />
Benedikt noch am 22. Februar die neue <strong>Diözese</strong> Gamboma<br />
in der Republik Kongo geschaffen hat. Als ersten Bischof<br />
von Gamboma ernannte Papst Benedikt XVI. Urabin Ngassongo,<br />
vormals Sekretär der Bischofskonferenz von Kongo-<br />
Brazzaville. Die Patronin der neuen <strong>Diözese</strong> wird die heilige<br />
Katharina von Siena. In der <strong>Diözese</strong> Gamboma leben rund<br />
110.000 Katholiken in sieben Pfarrgemeinden.<br />
Evangelische Theologin schöpft aus dem Arsenal der Lutherlegenden<br />
Der Göttinger Historiker Hartmut Lehmann übt Kritik an der evangelischen Theologin Margot Käßmann. In ihrer Eigenschaft als<br />
Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für das Reformationsjubiläum 2017 zeichne Käßmann ein<br />
falsches Bild vom Reformator Martin Luther, schreibt Lehmann laut Radio Vatikan in einem Gastbeitrag für die Zeit-Beilage Christ<br />
& Welt. Diese Darstellung könne sich auch negativ auf das Verhältnis zur katholischen Kirche auswirken. Der Direktor am Max-<br />
Planck-Institut für Geschichte in Göttingen nennt als Beispiele das Aufgreifen des angeblichen Thesenanschlages und des Luther<br />
nur zugeschriebenen Zitates „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ Historikern falle auf, dass es sich bei beidem um Material „aus<br />
dem Arsenal der Lutherlegenden“ handle, so Lehmann. Wer 2012 die Darstellung des Thesenanschlags undifferenziert übernehme,<br />
„vergibt die Chance, das Gespräch mit der katholischen Kirche über eine weitere Annäherung zu intensivieren.“ Es gehe nicht<br />
nur darum, „dass die Reformationsbotschafterin Ergebnisse der Reformationsforschung ignoriert und sich stattdessen auf populäre<br />
Lutherlegenden beruft“, betont Lehmann. „Ebenso bedenklich ist, dass sie bisher mit dem Verweis auf polemisch-abgrenzende<br />
Projektionen Chancen vergibt, die im Interesse aller Christen liegen.“<br />
Eigentlich hat alles nach einer neuen Eiszeit<br />
zwischen Vatikan und Piusbrüdern<br />
ausgesehen, die sich bis heute weigern,<br />
ein Bekenntnis zum 2. Vatikanischen<br />
Konzil zu unterzeichnen. Nun versucht<br />
in einer persönlichen Initiative Msgr.<br />
Augustine Di Noia den Dialog zwischen<br />
Rom und der Priesterbruderschaft St. Pius<br />
X. wieder aufzugreifen. Msgr. Di Noia,<br />
US-amerikanischer Dominikaner, ist seit<br />
Juni 2012 Vizepräsident der Päpstlichen<br />
Kommission Ecclesia Dei, die die Aufgabe<br />
hat, die Mitglieder der von Msgr. Lefebvre<br />
gegründeten Bruderschaft wieder in die<br />
volle kirchliche Gemeinschaft mit Rom<br />
zurückzuführen. Die Kommission hängt<br />
von der Kongregation für die Glaubenslehre<br />
ab. Nun hat Msgr. Di Noia einen<br />
Brief verfasst, der an den Generaloberen<br />
der Lefebvristen, Msgr Bernard Fellay,<br />
und an alle Priester der Bruderschaft adressiert<br />
ist. Die Versandung des Dialogs,<br />
stellt der Vizepräsident der Kommission<br />
Ecclesia Dei fest, sei im Wesentlichen auf<br />
unterschiedliche Auffassungen mancher<br />
Dokumente des Zweiten Vatikanischen<br />
Konzils zurückzuführen. Während Rom<br />
das Konzil im Licht einer „Hermeneutik<br />
der Kontinuität“ mit der Tradition sehe,<br />
schätze die Bruderschaft St. Pius X. manche<br />
Konzilsdokumente als falsch ein, besonders<br />
die Dokumente über Ökumene<br />
und interreligiösen Dialog.<br />
Dialog mit der Priesterbruderschaft<br />
St. Pius X.:<br />
Initiative von Msgr.<br />
Di Noia<br />
Ein Brief an Msgr. Fellay und an alle<br />
Priester der Bruderschaft<br />
Angesichts der festgefahrenen Positionen<br />
im theologischen Dialog wird Msgr. Di Noia<br />
einen spirituellen Ansatz versuchen und zu<br />
einer Gewissensprüfung einladen, unter<br />
dem Motto: Demut, Fügsamkeit, Geduld,<br />
Nächstenliebe. Rom warte noch, erinnert der<br />
Brief, auf eine Antwort von Msgr. Fellay auf<br />
das am 14. Juni 2012 erlassene Dokument.<br />
Um aus der Sackgasse herauszukommen, in<br />
der sich der Dialog verlaufen habe, schlägt<br />
Msgr. Di Noia vor, die Bruderschaft solle<br />
sich auf das „positive Charisma“ ihrer Anfänge<br />
zurückbesinnen, als sie noch einen<br />
Versuch der Reform zur Ausbildung von<br />
Priestern und Missionaren darstellte. Im Brief<br />
wird auch nahegelegt, auf die Nutzung der<br />
Massenmedien zu verzichten – tatsächlich<br />
hat das Pressebüro des Heiligen Stuhls den<br />
Brief nicht veröffentlicht – und die im Dialog<br />
verwendeten Argumente auf konstruktive<br />
Weise zu nutzen und auf eine „tiefe“ Theologie<br />
zu gründen.<br />
Die katholische Kirche in Georgien<br />
Dabei bezieht sich Msgr. Di Noia auf die am<br />
24. Mai 1990 von Kardinal Joseph Ratzinger<br />
unterschriebene Unterrichtung „Donum<br />
Veritatis“ über die kirchliche Berufung des<br />
Theologen, in der über die Aufgabe der<br />
Theologen gesagt wird, sie bestehe darin, „in<br />
Gemeinschaft mit dem Lehramt ein immer<br />
tieferes Verständnis des Wortes Gottes, wie<br />
es in der inspirierten und von der lebendigen<br />
Tradition der Kirche getragenen Schrift<br />
enthalten ist, zu gewinnen.“<br />
Nach dem am 24. Oktober 2012 bekanntgemachten<br />
Ausschluss von Msgr. Richard<br />
Williamson scheint die Priesterbruderschaft<br />
St. Pius X. von inneren Trennungen getroffen<br />
worden zu sein, während Msgr. Fellay<br />
den Dialog mit Rom weiterführen möchte.<br />
Manche Beobachter schätzen die aktuelle<br />
Lage der Bruderschaft, deren Mitglieder nicht<br />
mehr exkommuniziert, jedoch auch noch<br />
nicht wieder in die katholische Kirche eingegliedert<br />
sind, sei langfristig nicht haltbar.<br />
Der Brief von Msgr. Di Noia scheint eine<br />
realistische Botschaft übermitteln zu wollen:<br />
Die Päpstliche Kommission Ecclesia Dei will<br />
verhindern, dass die von Papst Benedikt<br />
XVI. der Bruderschaft gereichte Hand eines<br />
Tages als verpasste Gelegenheit betrachtet<br />
werden müsse; andererseits können die<br />
Verhandlungen auch nicht in alle Ewigkeit<br />
hingezogen werden. Was wird Papst Franziskus<br />
jetzt tun?<br />
In Georgien bildet die römisch-katholische Kirche mit 0,8 Prozent der Bevölkerung eine verschwindende Minderheit, die jedoch<br />
in der Bevölkerung auf offene Herzen stößt. Nun hat Bischof Giuseppe Pasotto, Apostolischer Administrator für den Kirchenbezirk<br />
Kaukasien, bei der Ordensleitung der Kapuziner angefragt, ob die Kapuziner nach Georgien zurückkehren könnten, wo sie 1845<br />
– vor 168 Jahren von den Russen vertrieben worden waren. Diesem Ersuchen hat der Orden nun entsprochen, sodass bereits<br />
Sondierungsgespräche in Tiflis unternommen wurden.<br />
Zur Zeit sind 99 apostolische Nuntien in der<br />
Welt stationiert. Einige von ihnen sind für<br />
mehrere Länder zuständig. Laut Angaben der<br />
italienischen Tageszeitung „Avvenire“ sind<br />
knapp weniger als die Hälfte aller Nuntien<br />
Italiener – genau 48. Das ist ein geringerer<br />
Prozentsatz als in der Vergangenheit: 1961<br />
waren 48 von insgesamt 58 (also 83 Prozent)<br />
Nuntien Italiener; 1978 waren es 55<br />
von insgesamt 75 (also 73 Prozent). Es sind<br />
weniger Italiener, aber mehr Asiaten und<br />
Afrikaner unter den Vertretern des Heiligen<br />
Stuhls. Dieser Trend war unvermeidlich.<br />
Papst Benedikt XVI. zum Beispiel hat seit<br />
99 Nuntien vertreten<br />
den Papst weltweit<br />
Beginn seines Pontifikats 41 neue Nuntien<br />
ernannt, von denen nur 15 (also 37 Prozent)<br />
aus Italien stammen. Trotzdem sind<br />
auch heute noch die päpstlichen Vertreter<br />
in kirchlich und/oder politisch besonders<br />
wichtigen Ländern überwiegend Italiener, so<br />
z.B. in Frankreich, Spanien, Großbritannien,<br />
Polen, den USA, Brasilien und, natürlich,<br />
Italien selbst. Jene Nuntien, die nicht aus<br />
Italien stammen, sind überwiegend Europäer<br />
(insgesamt 26, darunter sechs Polen, fünf<br />
Spanier und ebenso viele Franzosen). Einige<br />
stammen aber auch aus Asien (insgesamt<br />
12), Nordamerika (sieben, alle aus den USA),<br />
Afrika (5) und Südamerika (2). Vakant sind<br />
zur Zeit die Nuntiaturen für Elfenbeinküste,<br />
El Salvador, Malta, Kenia und Uganda. Der<br />
apostolische Nuntius für Bulgarien wird<br />
in Kürze emeritiert werden, und auch die<br />
Nuntiatur für den Iran wird bald vakant<br />
sein, da der bisherige Nuntius, Erzbischof<br />
Jean-Paul Gobel, nun auf die Nuntiatur für<br />
Ägypten berufen wurde.<br />
18 Nr. <strong>174</strong> April 2013<br />
19