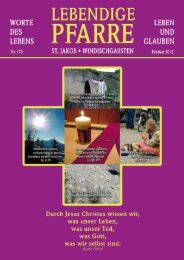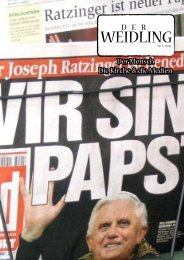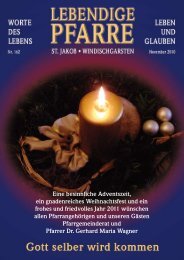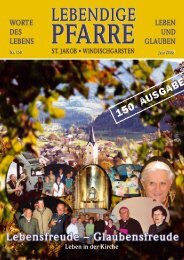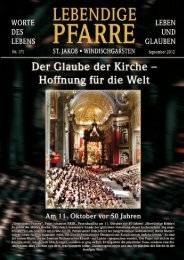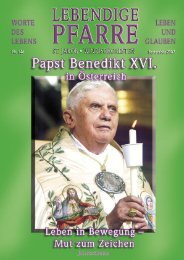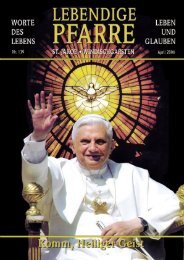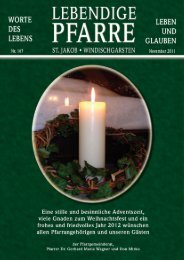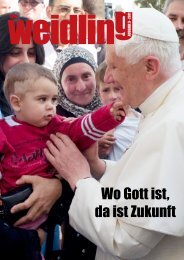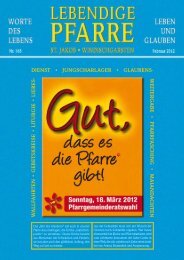Pfarrbrief 174 - Pfarre Windischgarsten - Diözese Linz
Pfarrbrief 174 - Pfarre Windischgarsten - Diözese Linz
Pfarrbrief 174 - Pfarre Windischgarsten - Diözese Linz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Als die prägende Figur des zweiten vatikanischen<br />
Konzils wird uns Johannes XXIII.<br />
vermittelt. Er wird sozusagen zum medialen<br />
Übervater der kirchlichen Veränderungen<br />
im 20. Jahrhundert stilisiert. Dabei wird oft<br />
vergessen, dass Johannes bereits acht Monate<br />
nach Beginn des Konzils verstarb. In den<br />
medialen Hintergrund gerückt ist hingegen<br />
Paul VI., der das Konzil weiterführte und<br />
auch zu einem Ende brachte. Doch nicht<br />
nur sein Bemühen für das Konzil macht ihn<br />
zu einer interessanten Persönlichkeit der<br />
Kirchengeschichte: Er bereiste als erster<br />
Papst die Welt, baute Brücken zu Orthodoxie,<br />
Judentum und zum kommunistischen<br />
Osten und galt rasch durch seinen Einsatz<br />
für Frieden, Entwicklung und Gerechtigkeit<br />
als der erste moderne Papst. Diesen<br />
nunmehr „vergessenen“ Papst versucht<br />
die 2012 erschienene Biografie wieder ins<br />
rechte Licht zu rücken und so, wie es Kardinal<br />
Lehmann sieht „für die gegenwärtigen<br />
Aufbruchssituationen und Dialogprozesse<br />
in der Kirche“ fruchtbar zu machen. Dass<br />
der Montini-Papst im Gegensatz zu anderen<br />
Papstfiguren des 20.Jahrhunderts auffallend<br />
selten zum Gegenstand der Forschung<br />
geworden ist, kann mitunter als weiterer<br />
Grund für die Monografie des Brixener<br />
Kirchengeschichtlers gesehen werden.<br />
Jörg Ernesti nähert sich Paul VI. vorerst<br />
auf eine eher akademische Art und Weise,<br />
wie das Einführungskapitel zeigt: Eine<br />
Quellensichtung und ein Abschnitt über<br />
wichtige Publikationen zum Thema, sowie<br />
Forschungsdesiderate und Leerstellen innerhalb<br />
der Papstgeschichte werden wahrgenommen.<br />
Einen bestimmt wichtigen<br />
Anhaltspunkt im Verstehen dessen, warum<br />
es um Paul VI. besonders still geworden<br />
ist, gibt Ernesti gleich zu Beginn: Er sei<br />
medial von seinem Vorgänger Johannes<br />
XXIII. und seinem Nachfolger Johannes<br />
Paul II. regelrecht erdrückt worden. Einen<br />
anderen Punkt sieht der Südtiroler in der<br />
Spannung des Pontifikats selbst: Der Papst<br />
habe hoffnungsvoll begonnen, sei aber im<br />
Verlauf der Jahre immer glückloser geworden.<br />
Genau das aber könnte ja ein besonderer<br />
Grund für die Auseinandersetzung sein,<br />
Ein Papst zum<br />
Erinnern<br />
Jörg Ernesti: Paul VI.<br />
Der vergessene Papst<br />
Herder 2012.<br />
müsste man Ernesti hier antworten. Die<br />
innerkirchliche Stille rund um Paul VI. ist<br />
vielleicht eher damit beschrieben, dass sich<br />
sowohl progressive als auch konservative<br />
Züge um den Papst bemühen, aber beide<br />
in ihren Erwartungen von ihm enttäuscht<br />
wurden.<br />
Relativ kurz fällt die Darstellung des Lebens<br />
von Gian Batista Montini bis zu seiner<br />
Papstwahl aus. Wer sich also erhofft, über<br />
seine Zeit als Erzbischof von Mailand oder<br />
als Kurienmitarbeiter an der Seite von Pius<br />
XII. Näheres zu erfahren, wird enttäuscht<br />
werden. Der Autor begründet aber seine<br />
Aussparungen sehr deutlich, indem er festhält,<br />
dass es vorrangig um Paul VI. und<br />
sein Wirken als Pontifex gehe – „um seine<br />
Persönlichkeit dagegen nur insofern, als sie<br />
für sein Handeln als Papst relevant sei.“<br />
Somit liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf<br />
den fünfzehn Jahren Pontifikat. Dieser Streifzug<br />
ist aber nicht nur ein Stück Papst-, sondern<br />
ein gutes Stück Weltgeschichte. Ernesti<br />
nimmt den Leser mit in die Spannungen der<br />
60er und 70er Jahre der Kirche, aber auch<br />
der Welt. Er entwirft ein Kaleidoskop von<br />
Geschichte, in die Paul VI. hineingestellt<br />
ist, um als Mensch vor allem aber als Papst<br />
Entscheidungen zu treffen: Beginnend mit<br />
der Aufbruchszeit während des Konzils,<br />
gefolgt von der nachkonziliaren Zeit bis<br />
1970 sowie der Neuausrichtung in der<br />
Ostpolitik, der Öffnung der Kirche für die<br />
moderne Kunst, der Auseinandersetzung<br />
mit den Traditionalisten, die in der Suspension<br />
von Marcel Lefebvre gipfelte und der<br />
Auseinandersetzung mit der italienischen<br />
Innenpolitik, die ihren Höhepunkt in der<br />
Kreuzweg am Karfreitag<br />
Ermordung des damaligen Ministerpräsidenten<br />
Aldo Moro hatte.<br />
Dabei stellt Ernesti einen Papst dar, der in<br />
den 60er Jahren auf Dialog mit der Welt<br />
und vor allem auch mit der Presse setzt,<br />
der besondere Schritte hinsichtlich seiner<br />
Reisen unternimmt und auch politische<br />
Akzente, wie die Aussöhnung mit den Kommunisten<br />
zumindest in Erwägung zieht.<br />
Im Laufe seines Pontifikates jedoch nimmt<br />
diese Auseinandersetzungsbereitschaft ab,<br />
und Paul beginnt laut Ernesti zu zögern und<br />
zu schweigen. Die Reduzierung von Paul<br />
VI. auf die Pillenenzyklika Humanae Vitae<br />
(1968) geht laut Ernesti daraufhin zurück,<br />
dass er nach dieser Enzyklika aufgrund ihres<br />
massiven Echos vor eindeutigen Äußerungen<br />
Abstand nahm. Dieser Annahme kann man<br />
aber auch sehr kritisch gegenüber stehen,<br />
wenn man bedenkt, mit welcher Entschlossenheit<br />
Paul in anderen Zusammenhängen<br />
wie der Einführung der Bischofssynode oder<br />
des Volksaltares vorging.<br />
Ein sehr eindrückliches Bild stellt Ernesti<br />
von Paul VI. als Theologen vor allem in den<br />
Enzykliken Ecclesiam suam (Antrittsenzyklika)<br />
und Evangelii nuntiandi (1975),<br />
in denen er die Begegnung der Welt mit<br />
der Kirche, vor allem aber mit Christus<br />
zum Angelpunkt einer Kirche im Heute<br />
macht.<br />
Schließlich bleibt es aber auch die Auseinandersetzung<br />
mit dem zweiten Vatikanischem<br />
Konzil, seinem Verlauf, seinem Abschluss<br />
und seiner Ergebnisse, die durch die Figur<br />
Paul VI. in den Mittelpunkt der Interessen<br />
gerückt werden: Wie Paul auf das Konzil<br />
wirkte, wie er es zu einem Ende bringen<br />
konnte und mit welcher Konsequenz er<br />
es umgesetzt hat, dazu bietet die Biografie<br />
ebenso spannende wie unerwartete Eindrücke,<br />
wenngleich dieses Thema einer<br />
eigenen Biografie bedürfen würde. Vor<br />
allem in den Jahren der Erinnerung an das<br />
Konzil und seine Protagonisten kann dieses<br />
Werk an Laien und Experten bestimmt<br />
empfohlen werden.<br />
David Pernkopf<br />
Heuer haben wir am Karfreitag wieder den Kreuzweg gebetet. Es waren Kreuzwegtexte, die von Maria Kroisleitner geschrieben<br />
wurden und sehr in die Tiefe gingen. Mit dem <strong>Pfarre</strong>r gelesen hat Heidi Sulzbacher. Großartig musikalisch umrahmt wurde die Feier<br />
in der Kalvarienbergkirche vom Doppelquartet unter der Leitung von DI Otmar Breitenbaumer. Es war kostbarste Passionsmusik,<br />
die es möglich machte, in unserer sehr stimmungsvollen Kalvarienbergkirche ganz still zu werden. Gerade auch für solche, die in<br />
der Fastenzeit zum 1. Mal in unsere Kalvarienbergkirche kamen, war es ein besonderes Erlebnis.<br />
Als der selige Pius IX. (Giovanni Maria Mastai<br />
Ferretti, 1846-1878) am 7. Februar 1878<br />
verstarb, ergaben sich für die anstehende<br />
Papstwahl bedeutsame Änderungen. Es war<br />
das erste Konklave des 19. Jahrhunderts, das<br />
aufgrund der politischen Gegebenheiten im<br />
Vatikan stattfinden musste. Das Konklave,<br />
aus dem Papst Pius VII. (Barnaba Gregorio<br />
Chiaramonti, 1800-1823) hervorging, hatte<br />
in Venedig stattgefunden. Leo XII. (Annibale<br />
della Genga, 1823-1829), Pius VIII.<br />
(Francesco Saverio Castiglioni, 1829-1830),<br />
Gregor XVI. (Bartolomeo Alberto Mauro<br />
Cappellari, 1831-1846) und Pius IX. wurden<br />
im Quirinalspalast gewählt.<br />
Die Arbeiten für die Herrichtung des Konklave,<br />
das zur Wahl Leos XIII. (Gioacchino Pecci,<br />
1878-1903) führen sollte, waren dem Architekten<br />
der Apostolischen Paläste, Vincenzo<br />
Martinucci, übertragen worden. Für die Unterbringung<br />
der Papstwähler mussten verschiedene<br />
Institutionen des Heiligen Stuhles, so die<br />
Päpstliche Nobelgarde, ihre Quartiere räumen<br />
und eine Reihe hochstehender Privatpersonen<br />
ihre Wohnungen verlassen. Architekt Martinucci<br />
hatte die im Apostolischen Palast des<br />
Vatikans verfügbaren Räume zu mehr oder<br />
weniger abgeschlossenen kleinen Wohnungen<br />
für je einen Kardinal, seinen Konklavisten<br />
und seinen Diener umzugestalten sowie die<br />
in Anspruch genommenen Kapellen, Höfe<br />
und Stockwerke durch Vermauerung von der<br />
Außenwelt vollständig abzuschließen.<br />
In neun Tagen und neun Nächten – tagsüber<br />
durften wegen der zu erledigenden Geschäfte<br />
Heute werden immer wieder Katholiken<br />
zu mehr Toleranz ermahnt und aufgerufen.<br />
Wer heute in der Gesellschaft als intolerant<br />
bewertet wird, der muss sich vieles gefallen<br />
lassen. Was man darunter versteht, das merkt<br />
man spätestens, wenn man betroffen ist<br />
und tolerant sein bedeutet, dass wir unsere<br />
Meinung nicht vertreten, dass wir uns<br />
ruhig halten und alles an uns geschehen<br />
lassen. Was das für den Glauben bedeutet,<br />
sieht man, wenn uns die Öffentlichkeit vor<br />
Augen führt, dass in Glaubensfragen alles<br />
gleichermaßen richtig sei, da es ohnedies<br />
keine absolute Wahrheit geben könne. Es<br />
mag einem wundern, dass jeder seine Meinung<br />
haben darf, aber nur, solange er diese<br />
Kleine Notizen zur<br />
Geschichte des<br />
Christentums (38)<br />
Das Konklave des<br />
Jahres 1878 – eine Papstwahl<br />
in einer neuen Zeit<br />
des Kardinalskollegiums keine Baumaterialien<br />
angefahren werden – verwirklichten 523<br />
Arbeiter die Pläne des Architekten. Jede der<br />
einzelnen Zellen bestand aus zwei bis vier<br />
Räumen, je nach der Größe der Zimmer oder<br />
mit Rücksicht auf die Möglichkeit, gesonderte<br />
Ausgänge auf die Flure zu haben. Durch<br />
private Verständigung unter den Kardinälen<br />
wurden einige Veränderungen in der Verteilung<br />
der Zellen herbeigeführt. Sanitäre<br />
Einrichtungen musste der Großteil der Purpurträger<br />
miteinander teilen.<br />
Am Abend des 18. Februar, um 19.30 Uhr,<br />
wurde das Konklave feierlich geschlossen,<br />
nachdem der Kardinalkämmerer sich persönlich<br />
davon überzeugt hatte, dass sich keine<br />
unbefugte Person mehr im Konklavebereich<br />
aufhielt. Von den vierundsechzig Kardinälen<br />
waren sechzig beim Einzug in das Konklave<br />
zugegen. Die Kardinäle aus Dublin und Rennes<br />
waren schwerkrank; der Patriarch von<br />
Lissabon kam am Abend des 19. Februar in<br />
der Ewigen Stadt an und wurde unverzüglich<br />
in das Konklave eingelassen, der Erzbischof<br />
von New York, Kardinal Mac Closkey, traf<br />
jedoch erst nach der erfolgten Wahl des neuen<br />
Papstes in Rom ein.<br />
MIT<br />
VERWUNDERUNG<br />
Relativismus ist<br />
Willkürherrschaft<br />
nur für sich behält. In dem Glauben, dass es<br />
ganz sicher keine endgültige Wahrheit gibt,<br />
spricht man vom Relativismus. Nun war es<br />
Papst Benedikt XVI., der in seinen Predigten<br />
ständig von der „Diktatur des Relativismus“<br />
gesprochen hat. Wie absurd diese Diktatur<br />
tatsächlich ist, wird deutlich, wenn man<br />
Außer den Kardinälen, ihren Konklavisten<br />
(jeder Purpurträger durfte für sich eine Begleitung<br />
bestimmen) und Dienern wurden<br />
in das Konklave mit eingeschlossen: Der<br />
Präfekt der Apostolischen Sakristei mit drei<br />
Hilfskräften, der Sekretär des Heiligen Kollegiums<br />
mit seinen Beamten und Dienern,<br />
mehrere Zeremoniare, zwei Ärzte, ein Chirurg<br />
und ein Apotheker, vier Barbiere, je ein<br />
Schreiner, Maurer, Schlosser, Schmied und<br />
Glaser, zwei Küchenchefs, vier Köche und<br />
sieben Unterköche, drei Aufseher und 21<br />
Bedienstete verschiedener Art. Während<br />
früher – noch bei der Wahl Pius’ IX. wurde<br />
es so gehandhabt – die Kardinäle und ihre<br />
Begleitung das Essen ins Konklave gebracht<br />
erhielten, hatte man diesmal eine gemeinschaftliche<br />
Küche eingerichtet. Die Kardinäle<br />
nahmen ihre Mahlzeiten in den Zellen ein,<br />
während die übrigen Konklaveteilnehmer an<br />
getrennten Tischen (für die Konklavisten, die<br />
Diener, die Handwerker usw.) gemeinsam<br />
speisten.<br />
Die Kosten für die baulichen Maßnahmen<br />
im Apostolischen Palast beliefen sich auf<br />
57.871,67 Lire (324.100 Euro); diejenigen der<br />
Herrichtung für die Sixtinische Kapelle, in der<br />
die Requiemmessen und die Abstimmungen<br />
stattfanden, 19.961,30 Lire (140.000 Euro).<br />
Waren früher die Papstwahlversammlungen<br />
von eigens ausgehobenen Truppen und<br />
Einheiten der päpstlichen Armee bewacht<br />
worden, konnten nun nach dem Ende des<br />
Kirchenstaates (1870) nur noch die päpstlichen<br />
Palastgarden zum Schutz des Konklaves<br />
herangezogen werden.<br />
Dreikönigsaktion<br />
Das Gesamtergebnis der Sternsingeraktion 2013 erbrachte in Österreich 15, 4 Millionen. Das bedeutet eine Steigerung um<br />
0,42% gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis in der <strong>Diözese</strong> <strong>Linz</strong> steigert sich um 2,28% auf 3,041.167,63. In der <strong>Pfarre</strong> St. Jakob<br />
in <strong>Windischgarsten</strong> konnten wir 23.876, 50 überweisen. Mit dem Zahlschein wurden 475,00 Euro überwiesen.<br />
Wir wollen allen nochmals dafür herzlich Vergelt‘ s Gott sagen!<br />
sieht, wie diese Diktatur behauptet, dass<br />
es keine Wahrheit gebe außer jene, die ihr<br />
gefällt, dass nichts bedeutsam wäre außer<br />
den Dingen, die das eigene Gewissen für<br />
bedeutsam hält, dass Autorität eine Illusion<br />
sei, die stets hinterfragt werden muss, bis<br />
man die richtige Antwort bekommt. Die<br />
richtige Antwort ist zweifellos allein jene,<br />
die von den Relativisten geltend gemacht<br />
und unterstützt wird, und wenn sie einmal<br />
erfolgt ist – und eine neue Autorität eingesetzt<br />
wurde – dann muss jede Hinterfragung<br />
der Autorität ein Ende haben. Denn diese<br />
Autorität – ihre Autorität – ist die wahrhaft<br />
gerechte, gute und barmherzige. Und wehe<br />
denen, die das nicht anerkennen.<br />
26 Nr. <strong>174</strong> April 2013<br />
27