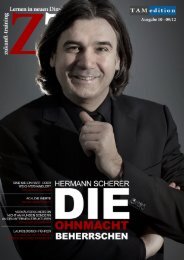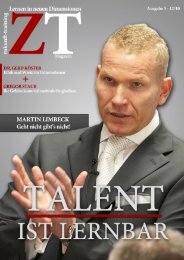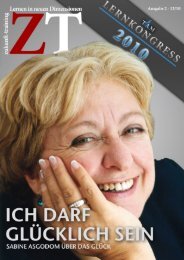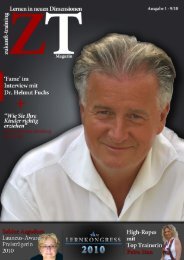6.ZT_Dezember_2012.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Buchtipp<br />
Welche Spuren werde ich hinterlassen? Wie verbinde ich mein Leben mit der<br />
Zukunft der Nachgeborenen? Welche Werte kann ich vermitteln? Ein Buch<br />
über zentrale Fragen der Babyboomer-Generation, der Menschen, die heute in<br />
der Mitte des Lebens stehen. Etwas hervorbringen, das über die eigene Existenz<br />
hinausreicht, einen Beitrag zu einer lebenswerten Welt leisten - das ist ein<br />
wachsender Wunsch im reifen Erwachsenenalter, aber auch eine Herausforderung<br />
in Zeiten des Jugendlichkeitskultes und rasanten Wertewandels.<br />
der Wissenschaft, beginnt mit der<br />
Strukturierung dessen, was ist. Forschen<br />
ist zunächst Ordnen, und die<br />
daraus entstehenden Taxonomien<br />
sind die Basis des Wissens. Wissenschaftsgeschichte<br />
ist seit Aristoteles<br />
vor allem die Geschichte der<br />
großen Ordnungssysteme. Solche<br />
Ordnungen liegen wie ein unsichtbares<br />
Netz über allen Wissensgebieten.<br />
In der Sprache ist die Grammatik<br />
ein solches Netz, und jeder<br />
Schüler schlägt sich mit diesem und<br />
vielen anderen wichtigen Systemen<br />
herum. Jahreszahlen und Epochen<br />
ordnen die Geschichte, und in den<br />
Naturwissenschaften bilden die<br />
großen Ordnungsschemata das Erkenntnisraster:<br />
In der Biologie zum<br />
Beispiel die Gliederung von Linné,<br />
in der Chemie das periodische<br />
System der Elemente, entdeckt von<br />
Meyer und Mendelejev.<br />
Wissenschaftsgeschichte erscheint<br />
so als die Geschichte eines Fortschreitens<br />
von Ordnung zu Ordnung.<br />
Dieses Fortschreiten kann<br />
in Sprüngen stattfinden, im chaotischen<br />
Umsturz von Revolutionen<br />
oder in behutsamen Evolutionen.<br />
Ordnungen werden entdeckt oder<br />
durchgesetzt. Und sie werden häufig<br />
wieder verworfen und aufgegeben.<br />
Der Wissenschaftshistoriker<br />
Thomas Kuhn beschrieb in seiner<br />
bahnbrechenden Arbeit über den<br />
Wandel im menschlichen Denken<br />
und Forschen, wie eine alte<br />
Ordnung, die disziplinäre Matrix,<br />
durch eine neue abgelöst wird: Unter<br />
dem Druck neuer Erkenntnisse<br />
verflüssigen sich alte Problemlösungsmodelle<br />
und ein Paradigmenwechsel<br />
wird eingeleitet. Und<br />
der Philosoph Michel Foucault beschreibt<br />
in seiner „archäologischen<br />
Wissenschaftsgeschichte“ mit dem<br />
Titel Die Ordnung der Dinge, dass<br />
Wissen weniger das Resultat von<br />
rationalen Denkprozessen ist, sondern<br />
von mehr oder weniger zufälligen<br />
Entdeckungen und von politischen<br />
Machtverhältnissen. Beides<br />
bestimmt die jeweiligen diskursiven<br />
Strukturen. Veränderungen<br />
in der „Ordnung der Dinge“ sind<br />
im Grunde Transformationen von<br />
Seinsformen.<br />
„Denken ist das Ordnen des Tuns“,<br />
schrieb der Entwicklungspsychologe<br />
Hans Aebli. Der menschliche<br />
Geist ist eng verknüpft mit der zentralen<br />
Fähigkeit zum Ordnen, und<br />
das heißt nichts anderes als Überlegen,<br />
Antizipieren, Planen, mit dem<br />
Ziel, seine Handlungen einigermaßen<br />
rational und geregelt durchzuführen.<br />
Das ordnende Strukturieren<br />
ist die eigentlich menschliche Metafähigkeit,<br />
die zentrale kognitive<br />
Leistung: Es kommt darauf an, immer<br />
und überall Muster und Regelmäßigkeiten<br />
erkennen und zu einer<br />
Ordnung zu finden, selbst dort, wo<br />
keine ist.<br />
Denn Ordnungen und Strukturen<br />
sind kein Selbstzweck. Sie geben<br />
Halt, Sicherheit und Orientierung.<br />
Die Ordnung ist der feste Boden,<br />
auf dem wir leben und operieren<br />
können. Sie ist der Rahmen unseres<br />
Denkens und Tuns, und sie ist deshalb<br />
„das halbe Leben“. Was aber<br />
ist die andere Hälfte? Bei genauerer<br />
Betrachtung: die Unordnung, die<br />
Emotion, das Chaos. Man könnte<br />
auch sagen: die empfundene (neudeutsch:<br />
„gefühlte“) Unordnung<br />
und Unberechenbarkeit der Natur<br />
(die jedoch ihre eigene innere Ordnung<br />
hat) zwang den Menschen<br />
zur Kultur, zu Neu-Ordnungen,<br />
die ihm das Leben erleichterten,<br />
wenn nicht überhaupt erst ermöglichten.<br />
Der Gegensatz von Natur<br />
und Kultur (und damit der von relativer<br />
Unordnung und relativer<br />
Ordnung) begleitet den Menschen<br />
seit seiner Menschwerdung, denn<br />
er selbst vereint und verkörpert in<br />
sich beides, mal als produktive Polarität,<br />
mal als schmerzhaften Widerspruch.<br />
Kulturgeschichte lässt sich begreifen<br />
als das Spiel mit den Formen<br />
und Ausbildungsgraden menschlicher<br />
Ordnungen, und die Ästhetik<br />
ist der ewige und sichtbarste Umschlagplatz<br />
zwischen den beiden<br />
Sphären von Ordnung und Chaos:<br />
Wie viel Ordnung ist edel, hilfreich<br />
und gut - und wie viel ist<br />
erdrückend, erstarrt, unfruchtbar?<br />
Wie viel Unordnung braucht der<br />
Mensch, um menschlich zu bleiben,<br />
und wann verschlingt ihn das<br />
Chaotische?<br />
Zukunft-Training 12/2011 17