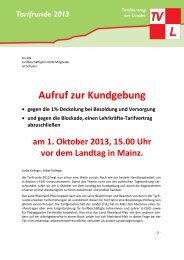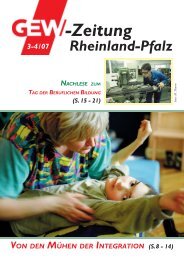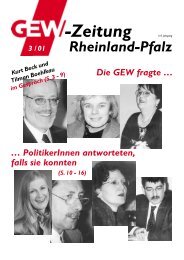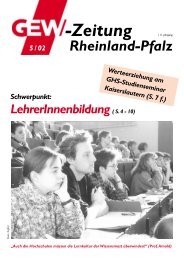PDF downloaden - GEW
PDF downloaden - GEW
PDF downloaden - GEW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
LehrerInnenbildung<br />
lage dafür sind die sich rasant verkürzenden<br />
Halbwertzeiten des Wissens,<br />
die das Modell einer vorbereitenden<br />
Aus-Bildung schon längst<br />
haben obsolet werden lassen. Zu offensichtlich<br />
ist die Fragwürdigkeit<br />
einer Vermittlung von Kenntnissen,<br />
die häufig bereits nach drei Jahren<br />
in wesentlichen Teilen veraltet oder<br />
gar obsolet sind. Und auch die prognostischen<br />
Bildungsbedarfsstudien<br />
der letzten Jahre haben uns eigentlich<br />
immer wieder bloß gezeigt, wie<br />
wenig wir im Grunde genommen<br />
darüber wissen, wie die Arbeitsplätze<br />
und Lebenssituationen beschaffen<br />
sein werden, für die wir die nachwachsende<br />
Generation vorzubereiten<br />
versuchen. Aus diesem Prognosedefizit<br />
der Bedarfsforschung wurde<br />
in der beruflichen Bildung die<br />
Konsequenz gezogen, sich immer<br />
stärker auf die Förderung von Selbstlern-<br />
sowie Sozial- und Methodenkompetenzen<br />
zu beziehen und nicht<br />
alle Anstrengungen auf das<br />
Hinterhereilen hinter den sich wandelnden<br />
Bedarfslagen der betrieblichen<br />
Praxis zu konzentrieren.<br />
Sicherlich kann man vermuten, dass<br />
z.B. in der Lehrerausbildung die<br />
Halbwertzeiten des Wissens sich<br />
weniger dramatisch verkürzen als in<br />
den technologienahen Bereichen beruflicher<br />
Praxis. Gleichwohl zeigt ein<br />
Blick in die jüngeren lern- und<br />
schultheoretischen Debatten, dass<br />
auch hier vieles nicht mehr gilt. So<br />
hat die neuere lerntheoretische Forschung<br />
die Zweifel an der Effektivität<br />
und Nachhaltigkeit der vorherrschenden<br />
Methodenpraxis in unseren<br />
Schulen deutlich genährt und<br />
das Verständnis für den Sachverhalt<br />
geschärft, dass Kompetenzbildung<br />
bei Lernern nur gelingt, wenn die<br />
systematische Förderung ihrer<br />
Selbsterschließungsstrategien zur<br />
zentralen Intention schulischen Unterrichts<br />
wird, welcher zudem reichhaltig<br />
arrangierte Lernumgebungen<br />
zu präsentieren habe, in denen Wissen<br />
durch die Subjekte selbsttätig<br />
angeeignet und Problemlösungshandeln<br />
systematisch geübt werden können.<br />
Damit verbunden ist eine<br />
grundlegender Rollenwandel der<br />
Lehrenden, welche sich von linearen<br />
Vorstellungen einer Vermittelbarkeit<br />
von Inhalten lösen und zu Ermöglichern<br />
vernetzter Lernkontexte<br />
wandeln müssen, in denen auch die<br />
Nutzung multimedialer Möglichkeiten<br />
eine wichtige Lernressource<br />
darstellt (vgl. Arnold/Schüßler<br />
2003). Die Bildungspraxis der Zukunft<br />
wird - nach allem, was wir<br />
derzeit absehen können - kaum noch<br />
etwas mit der frontalunterrichtlichen<br />
Wissensmast, dem überflüssigen<br />
Lehren und den linearen Lehr-<br />
Lernkurzschlüssen früherer und<br />
heutiger Zeiten gemeinsam haben 2 ,<br />
weshalb man mit Recht die Frage<br />
stellen darf, ob ein dominanter Bezug<br />
auf die heutige Praxis wirklich<br />
geeignet ist, auf diese gewandelte<br />
Praxis der Zukunft vorzubereiten.<br />
„Theorie ohne Praxis ist<br />
leer - Praxis ohne Theorie<br />
ist blind!“<br />
Die augenblickliche Praxisbezugs-<br />
Euphorie geht mehr oder weniger<br />
unverhohlen mit einem antitheoretischen<br />
Affekt einher. Ausdruck findet<br />
dieser u.a. in einer Kritik der<br />
„praxisfernen Ausbildung“ an den<br />
Universitäten und wissenschaftlichen<br />
Hochschulen. Zwar lässt sich<br />
nicht leugnen, dass manche Borniertheit<br />
der Praxis ihr Pendant in<br />
einer praxisabstinenten oder gar arroganten<br />
Wissenschaft findet, doch<br />
ist vor simplifizierenden Schwarz-<br />
Weiß-Zeichnungen zu warnen.<br />
Denn so, wie es die wissenschaftlich<br />
informierten Bemühungen mancher<br />
Kollegien in den Schulen gibt, in<br />
Kooperation mit Universitätspädagogen<br />
die Lernkultur ihrer Schulen<br />
zu innovieren und sich dabei auch<br />
mutig von außen betrachten zu lassen,<br />
so gibt es auch die Universitätsvertreter,<br />
die sich in ihrem Bemühen,<br />
den wissenschaftlichen Blick<br />
auf die Praxis bei ihren Studierenden<br />
zu entwickeln, von konkreten<br />
Problem- und Fragestellungen der<br />
Bildungswirklichkeit leiten lassen<br />
(vgl. u.a. Müller 1997) und dieses<br />
ebenfalls evaluieren und dokumentieren<br />
- beide frei nach dem Motto<br />
„Aus Fehlern lernen!“.<br />
Solche Schnittmengen, die größer<br />
sind, als das bisweilen klingt, gilt es<br />
Prof. Dr. Rolf Arnold, Lehrstuhl für Pädagogik (insbesondere<br />
Berufs- und Erwachsenenpädagogik) und Leitung des Zentrums<br />
für Fernstudium und Universitäre Weiterbildung an<br />
der Universität Kaiserslautern. Neuere Veröffentlichungen:<br />
Schulpädagogik kompakt. Berlin 2002 (mit H. Pätzold);<br />
Humanistische Pädagogik. Emotionale Bildung nach Erich<br />
Fromm. Frankfurt 2003.<br />
noch deutlicher in den Blick zu rücken.<br />
So könnte die vereinseitigende<br />
Rhetorik, wie die des „Nun vergesst<br />
mal schön...!“ überwunden<br />
werden und sich ein Verständnis entwickeln,<br />
dass den unterschiedlichen<br />
Handlungslogiken von Praxis und<br />
Wissenschaft Rechnung zu tragen<br />
vermag. Beide dienen nämlich -<br />
strukturell notwendig! - unterschiedlichen<br />
Zwecken, wie u.a. die wissenssoziologische<br />
und erziehungswissenschaftlichen<br />
Professionalitätsdebatten<br />
deutlich herausgearbeitet haben<br />
(vgl. Bommes u.a. 1996; Dewe<br />
1991; Combe/ Helsper 1996). Während<br />
es der Wissenschaft darum zu<br />
tun ist, komplexitätsangemessene<br />
Sichtweisen zu entwickeln und die<br />
Bewusstheit der Systemik und Konstruiertheit<br />
sozialer Kontexte zu stärken,<br />
weshalb „die kritische Analyse<br />
bis ins Detail“ des Gegebenen und<br />
das „Probedenken in anderen Köpfen“<br />
ihre wesentlichen Verfahren<br />
sind, folgen Praxis und praktische<br />
Ausbildung (z.B. in der LehrerInnenausbildung)<br />
notwendig einer anderen<br />
Handlungslogik: Ihr Ziel kann<br />
und darf es nicht sein, komplexitätserweiternd<br />
zu wirken. Es geht vielmehr<br />
um Vereindeutigung, Komplexitätsreduktion<br />
sowie um die unmittelbare<br />
Anwendung und Erprobung<br />
in Gestaltungskontexten.<br />
Die Professionalitätsdebatte hat<br />
deutlich gezeigt, dass die Professio-<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 6 /2003<br />
11