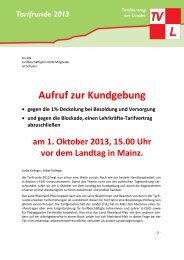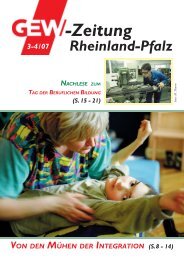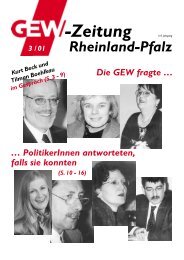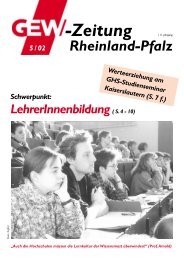PDF downloaden - GEW
PDF downloaden - GEW
PDF downloaden - GEW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Fällige“ Praxisrelevanz<br />
Möglichkeiten einer Fallorientierung in der Lehrerbildung<br />
- Von Hennig Pätzold -<br />
Pädagoginnen und Pädagogen, die tagtäglich in der Praxis des Lehrens und<br />
Erziehens stehen, haben es jedes Mal aufs Neue mit einzigartigen Situationen<br />
zu tun, die in dieser Form noch nie da gewesen sind. Gleichzeitig gleichen<br />
sich viele Situationen in gewissen Punkten, es gibt „typische“ Fälle, die<br />
man schon kennt oder zu kennen glaubt.<br />
Solche Situationen werden nicht<br />
nach ihrer Einzigartigkeit beurteilt<br />
und behandelt, sondern danach, was<br />
sie mit bekannten, zum Beispiel früher<br />
erlebten Situationen gemein haben.<br />
Hier greifen dann Routinen, es<br />
laufen sogenannte Skripts (Kaiser<br />
2001: 138ff) ab.<br />
Nun stellt sich natürlich die Frage,<br />
inwieweit man auf einzigartige Situationen<br />
mit standardisierten Antworten<br />
reagieren kann - wobei<br />
allerdings ein Skript auch nicht als<br />
ein völlig starr ablaufendes Ritual<br />
verstanden werden darf, vielmehr<br />
bestimmt es eine Art von „Korridor<br />
von Möglichkeiten“, innerhalb dessen<br />
eine Anpassung an die jeweilige<br />
Situation möglich ist. So mag man<br />
auf eine Verständnisfrage eines Schülers<br />
routiniert mit entsprechenden<br />
Antworten reagieren, dennoch kann<br />
die Antwort in der Ausführlichkeit,<br />
dem Ton und vielem anderen situationsspezifisch<br />
variieren. Noch wichtiger<br />
ist allerdings die Möglichkeit,<br />
aus dem Skript „aussteigen“ zu können,<br />
wenn es sich insgesamt als nicht<br />
angemessen erweist (weil beispielsweise<br />
die Frage auf etwas ganz anderes<br />
als inhaltliche Erklärungen abzielte).<br />
In gewisser Weise stehen die Routinen<br />
und der Umgang mit ihnen im<br />
Zentrum der Ausbildung von LehrerInnen<br />
und auf ihre Art markieren<br />
sie auch den (zum Teil rhetorisch<br />
überhöhten) Unterschied oder sogar<br />
Gegensatz zwischen einer wissenschaftlichen<br />
Ausbildung in der ersten<br />
Phase und einem praxisorientierten<br />
Referendariat (der oft aus einem<br />
vergangenheitsorientierten Praxisverständnis<br />
herrührt, vgl. den Artikel<br />
von Rolf Arnold in diesem Heft).<br />
In der ersten Phase wird immer<br />
wieder auf die Vielfalt der möglichen<br />
Einzelfälle hingewiesen. Jeglicher<br />
Eindruck der Routinisierung muss<br />
vermieden werden oder bedarf<br />
zumindest einer sorgfältigen Begründung<br />
(die selten so elegant gelingt<br />
wie bei Grell und Grell: „Unterricht<br />
ist ein komplexes Geschehen. Und<br />
deshalb brauchen wir Rezepte“,<br />
1996: 48). An Stelle der Bildung von<br />
Routinen wird abstrahiert. Es geht<br />
also weniger um die Fähigkeit, in einer<br />
Situation ein Rezept zur Hand<br />
zu haben, um unmittelbar reagieren<br />
zu können (auch wenn dies in der<br />
ersten Phase der Ausbildung von<br />
Lehrkräften auch eine Rolle spielt),<br />
LehrerInnenbildung<br />
sondern darum, Maßstäbe und Kategorien<br />
zu gewinnen, anhand derer<br />
eine Situation erfasst werden und<br />
angemessenen Handlungen gefunden<br />
oder Vorschläge hierzu beurteilt<br />
werden können. Die Gewichtung in<br />
der zweiten Phase ist eine andere.<br />
Hier wird Unterricht für die AnwärterInnen<br />
nach kurzer Zeit zur täglichen<br />
Aufgabe und die Vielfalt möglicher<br />
Situationen wird zum Problem,<br />
das sich scheinbar nur durch<br />
die Aneignung von Routinen beherrschen<br />
lässt, die unmittelbares Handeln<br />
ermöglichen. Zeit für die Reflexion<br />
oder die Beurteilung der Situation<br />
bleibt allenfalls dann, wenn<br />
eigentlich alles vorbei ist, und auch<br />
dann drängen sich bereits neue Erfordernisse<br />
dazwischen.<br />
Man sieht: Eigentlich passt beides<br />
gut zueinander - wenn in dieser (vereinfachten)<br />
Darstellung in der ersten<br />
Phase Kategorien und Maßstäbe<br />
entwickelt und angeeignet werden,<br />
so können sie in der zweiten Phase<br />
helfen, Routinen oder „Rezepte“ zu<br />
beurteilen und Erfahrungen mit deren<br />
Anwendung zu reflektieren. In<br />
der Praxis, sei sie durch das Referen-<br />
Staatlich anerkannte Ausbildung<br />
in<br />
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie<br />
für Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten<br />
nach dem Psychotherapeutengesetz<br />
Institut für<br />
Psychotherapie und Psychoanalyse<br />
Rhein-Eifel<br />
Bachovenstraße 4 · 53489 Sinzig<br />
Tel. 0 26 42 / 98 06 65 · Fax: 98 06 70 · Institut.Rhein.Eifel@t-online<br />
Auch im Internet: www.institut-rhein-eifel.de<br />
<strong>GEW</strong>-Zeitung Rheinland-Pfalz 6 /2003<br />
13