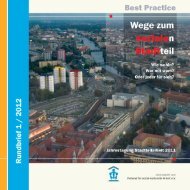Rundbrief 1/2009: Dokumentation Fachtagung Familiennetze
Rundbrief 1/2009: Dokumentation Fachtagung Familiennetze
Rundbrief 1/2009: Dokumentation Fachtagung Familiennetze
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Familiennetze</strong><br />
Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008<br />
veranstaltet vom Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.<br />
vom 07. - 08. November 2008<br />
im Bürgerhaus Am Schlaatz<br />
Schilfhof 28<br />
14478 Potsdam
2<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
4 - 13<br />
Anfangsplenum<br />
Anfangsplenum: Dr. Lore-Maria Peschel-Gutzeit<br />
Familie 2008 – zwischen Generalverdacht und Heiligenschein<br />
Herbert Scherer, Verband für sozial-kulturelle Arbeit:<br />
Das Familienthema als Herausforderung für die Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit<br />
14 - 31<br />
Einfach gut<br />
32 - 47<br />
Verhindern<br />
48 - 63<br />
Zwischentöne<br />
Workshop: Einfach gut - Niedrig schwellige Zugänge in der Arbeit mit Familien<br />
Barrierefreie Bildung in der Kindertagesstätte als Türöffner für lebenslanges Lernen<br />
Workshop: Verhindern, vermeiden, vorbeugen<br />
Verschiedene Wege im Kinderschutz<br />
Workshop: Zwischentöne<br />
Generationendialoge und Generationenverantwortung<br />
64 - 77<br />
SOS - Eltern in Not<br />
78 - 91<br />
Eltern in die ...<br />
91 - 101<br />
Diese Typen ...<br />
Workshop: SOS- Eltern in Not<br />
Hilfe und Selbsthilfe<br />
Workshop: Wenn Eltern in die Schule gehen<br />
Lernen, einmischen, verändern für die Zukunftschancen der Kinder<br />
Workshop: Schaut Euch diese Typen an<br />
Stadtteilzentren, Bürgerhäuser - Ansprüche, Profile, Förderprogramme<br />
102 - 111<br />
Nachttöpfe und ...<br />
112 - 129<br />
Heute ratlos ...<br />
130 - 145<br />
Pass-genau?<br />
Workshop: Nachttöpfe und Menschwerdung<br />
Zum Verhältnis von familiärer und öffentlicher Erziehung<br />
Workshop: Heute ratlos, morgen super?<br />
Das weite Feld der Erziehungsratgeber – Trends und Moden<br />
Workshop: Pass-genau?<br />
Familienbilder und Rollenklischees im interkulturellen Kontext<br />
146 - 149<br />
Abschlussplenum<br />
Abschlussplenum<br />
Wohin geht die Reise?<br />
150 - 151<br />
Teilnehmerliste
Familien-Netze - Vorwort zur <strong>Dokumentation</strong><br />
Mit der Tagung Familien-Netze hatten wir uns zweierlei vorgenommen: Zum einen wollten<br />
wir den Wissensstand zum Familienthema aktualisieren, zu dem es offenbar einen<br />
erheblichen gesellschaftlichen Klärungs- und Handlungsbedarf gibt, zum anderen ging<br />
es darum, mit dem Erfahrungsaustausch über eine Querschnittsaufgabe der Nachbarschaftshäuser<br />
Menschen aus deren unterschiedlichen Arbeitsfeldern gleichberechtigt<br />
zusammenzubringen und dadurch unser eigenes Netzwerk zu stärken. Wir hoffen,<br />
dass Ihnen die Lektüre der <strong>Dokumentation</strong> den Eindruck vermitteln kann, dass beides<br />
in einem erfreulichen Maße gelungen ist.<br />
Die <strong>Dokumentation</strong> orientiert sich in ihrem Stil am Charakter der Tagung: im Mittelpunkt<br />
steht der lebendige Austausch in den Arbeitsgruppen, den wir in weiten Teilen<br />
wortgetreu wiedergeben. Power Point Präsentationen und schriftliche Diskussionsvorlagen<br />
werden ausschließlich als Hintergrundmaterial benutzt. Wir versprechen uns<br />
davon, unseren Leserinnen und Lesern einen möglichst unverstellten Eindruck vom<br />
Geschehen und das Gefühl zu vermitteln, sie seien selbst dabei gewesen.<br />
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns bei der Durchführung der Tagung und bei<br />
der Aufbereitung der Materialien für die <strong>Dokumentation</strong> geholfen haben: Theo Fontana<br />
und Joachim Toll für die Mitwirkung bei der Vorbereitung, allen Moderatorinnen und<br />
Moderatoren für die Leitung der Workshops, Gitty Czirr und Margot Weblus für die Bearbeitung<br />
der Tonaufzeichnungen, den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bürgerhaus<br />
Am Schlaatz für die Logistik und natürlich allen Impulsgeberinnen und –gebern für ihre<br />
Bereitschaft, freimütig und kompetent über ihre Arbeit zu berichten.<br />
Der Verband für sozial-kulturelle Arbeit hat beschlossen, <strong>2009</strong> seine Jahrestagung erneut<br />
in Potsdam durchzuführen. Vorgesehen ist, dass Ost und West, Jung und Alt, Sozialkultur<br />
und Soziokultur, Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement, Eingeborene und<br />
Migranten etc. aufeinander treffen, um Erfahrungen und unterschiedliche Sichtweisen<br />
auszutauschen, aber auch auszuloten, was ‚zusammen gehört‘ ...<br />
Vorankündigung<br />
Jahrestagung Stadtteilarbeit <strong>2009</strong><br />
6. und 7. November <strong>2009</strong> / Potsdam<br />
„Was zusammen gehört“ –<br />
9 Begegnungen mit Workshopcharakter<br />
Wenn die <strong>Dokumentation</strong> bei Ihnen den Gedanken auslöst: „da wäre ich gern dabei<br />
gewesen“, sollten Sie die Chance in diesem Jahr nutzen. Wir hoffen, Sie am 6. und<br />
7. November <strong>2009</strong> in Potsdam begrüßen zu können.<br />
Mit freundlichem Gruß<br />
Herbert Scherer<br />
Geschäftsführer
Anfangsplenum<br />
Inputs:<br />
Dr. Lore-Maria Peschel-Gutzeit<br />
“Familie 2008 –<br />
zwischen Generalverdacht und Heiligenschein”<br />
Herbert Scherer, Verband für sozial-kulturelle Arbeit:<br />
“Das Familienthema als Herausforderung für die<br />
Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit“<br />
Herbert Scherer: Ich begrüße Frau Dr. Lore-Maria Peschel-<br />
Gutzeit. Sie ist praktizierende Rechtsanwältin und war<br />
Justizsenatorin in Berlin und Hamburg. Wir sind gespannt<br />
darauf, von ihr etwas über die „Familie 2008 – zwischen<br />
Generalverdacht und Heiligenschein” zu erfahren.<br />
Lore-Maria Peschel-Gutzeit: Ich bedanke mich herzlich<br />
für die Einladung. Das Thema ist etwas provokativ, man<br />
könnte auch reißerisch sagen: Die Familie 2008 unter<br />
Generalverdacht oder mit Heiligenschein. Ich habe das<br />
so verstanden, dass unter Generalverdacht vor allem<br />
Kindesvernachlässigung und Kindesmissbrauch ausgedrückt<br />
werden sollen, während mir bei Heiligenschein<br />
einfällt, die Familie, wie bei Ludwig Richter dargestellt, als<br />
Hort des Friedens, der Harmonie, sozusagen allein selig<br />
machend. Wir alle, die Sie hier Fachfrauen und Fachmänner<br />
sind, wissen, dass beides nicht stimmt, weder ist es<br />
gerechtfertigt, die Familie unter Generalverdacht zu nehmen,<br />
noch ist es richtig zu sagen, in der Familie ist alles<br />
okay, alles paletti.<br />
Wir wissen, dass die Familie eben auch kein Paradies ist.<br />
Die allermeisten Familien haben mehr oder weniger große<br />
Probleme und auch Konflikte, die sie aber ebenfalls zum<br />
allergrößten Teil selbst lösen, wenn auch mit Hilfe von<br />
außen, was auch in Ordnung ist. Der allergrößte Teil der<br />
Eltern versorgt die Kinder gut und fördert ihre eigenen Kinder<br />
nach Kräften. Dabei verzichten Eltern auf vieles, damit<br />
die Kinder vorankommen.<br />
In diesen ganzen Zusammenhängen wäre es einfach ungerechtfertigt,<br />
ja unverantwortlich, die Institution Familie unter<br />
Generalverdacht zu stellen, dafür gibt es keinen Grund.<br />
Aber es gibt auch Familien, das wissen Sie, die Sie alle<br />
Fachleute sind, leider nur zu gut, die die Anforderungen<br />
nicht schaffen, die auch ihre Kinder nicht bestmöglich fördern,<br />
usw. Was sagt unsere Rechtsordnung? Wie gestaltet<br />
sie das Familienleben? Wie weit gibt sie dem Staat Eingriffsmöglichkeiten?<br />
Wo verlangt die Rechtsordnung vom<br />
Staat, dass er eingreift?<br />
Dazu möchte ich etwas sagen und habe das Thema mit<br />
folgendem Untertitel konkretisiert:<br />
Das Spannungsverhältnis zwischen der verfassungsrechtlichen<br />
Stellung der Familie und dem gesellschaftlichen<br />
Wandel, dem sie unterworfen ist *<br />
A. Verfassungsrechtliche Stellung der Familie<br />
Unsere Bundesverfassung, das Bonner Grundgesetz vom<br />
23.5.1949, hat in Art. 6 Abs. 1 Ehe und Familie den besonderen<br />
Schutz des Staates zugesichert und damit dem<br />
Staat - vor allem dem Bundesgesetzgeber - die Aufgabe<br />
gestellt, Ehe und Familie vor Beeinträchtigungen zu bewahren<br />
und durch geeignete Maßnahmen zu fördern; es<br />
hat darüber hinaus das Verbot ausgesprochen, Ehe und<br />
Familie als elementare<br />
Lebensgemeinschaft in Bestand und Entfaltung zu stören.<br />
Diesen Schutz genießen alle in Deutschland lebenden<br />
Bürgerinnen und Bürger, die eine Ehe eingehen wollen<br />
oder geschlossen haben, aber auch alle Eltern und Elternteile,<br />
alle Kinder und Verwandte einer Familie.<br />
**in verkürzter Form auch veröffentlicht in der Zeitschrift „Vorgänge“ 2008, Heft 3
Lange war umstritten, ob durch Art. 6 Abs. 1 GG nur oder<br />
doch in erster Linie die bürgerliche, legale Ehe geschützt<br />
ist oder auch andere Verbindungen, die - jedenfalls dann,<br />
wenn Kinder geboren werden - als Familie im Sinne des<br />
Grundgesetzes anzusehen und entsprechend zu schützen<br />
sind. Jedoch hat das Bundesverfassungsgericht schon<br />
am 14.11.19731 entschieden, dass eine auf natürlicher<br />
und rechtlicher Bindung beruhende Familie unabhängig<br />
davon, ob eine Ehe ihren Kern bildet, eine lebenswichtige<br />
Funktion für die menschliche Gemeinschaft bildet, so<br />
dass auch ihr der Schutz aus Art. 6 Abs. 1 GG einschließlich<br />
aller sozialstaatlicher Förderung zukommt.<br />
Auch die Verfassung der ehemaligen Deutschen Demokratischen<br />
Republik2 stellte Ehe, Familie und Mutterschaft<br />
unter den besonderen Schutz des Staates. Sie gewährte<br />
jedem Bürger der DDR das Recht auf Achtung, Schutz und<br />
Förderung seiner Ehe und Familie. Kinderreiche Familien<br />
und alleinstehende Eltern hatten das Recht auf besondere<br />
Fürsorge und Unterstützung.<br />
Art. 6 GG schützt in seinem Abs. 2 das Elternrecht, in Abs.<br />
4 die Mutter und Abs. 5 enthält das Gebot, uneheliche Kinder<br />
den ehelichen gleichzustellen.<br />
B. Die gesellschaftliche Situation bei Inkrafttreten<br />
der Bundesverfassung<br />
Im Mai 1949, als das Bonner Grundgesetz in Kraft trat,<br />
hatte Deutschland den zweiten Weltkrieg gerade erst<br />
vier Jahre hinter sich gelassen. Deutschland lag in Trümmern,<br />
real, aber auch ideell. Ganze Generationen von<br />
Bürgerinnen und Bürgern standen vor dem Nichts, zu<br />
denken ist nur an Millionen von Flüchtlingen, von Vertriebenen,<br />
von Menschen, die durch Bombenangriffe<br />
alles verloren hatten, an Millionen Kriegsgefangene.<br />
Wegen der flächendeckenden Zerstörung von Städten<br />
und Gemeinden gab es kaum Arbeit, die öffentliche Verwaltung<br />
lag zum Teil noch bei den Besatzungsmächten,<br />
Deutschland erhielt erst allmählich seine Souveränität<br />
zurück.<br />
In dieser Situation gab es nur eine Institution, an die sich<br />
die Menschen halten, in der sie Schutz und Beistand finden<br />
und ihr Überleben sichern konnten: Die Familie. Diese<br />
war rechtlich geprägt durch das gesellschaftliche Verständnis<br />
des 19. Jahrhunderts. Das seit dem 1.1.1900<br />
geltende Bürgerliche Gesetzbuch hatte die einheitliche<br />
Zivilehe eingeführt und das Verhältnis von Eheleuten und<br />
Kindern in absolut patriarchalischer Weise geregelt: Der<br />
Ehemann entschied allein in allen Angelegenheiten, die<br />
das eheliche Kind betrafen, aber auch allein über Wohnsitz<br />
und Einkommen der Familie. Er verfügte allein über<br />
das Vermögen und Einkommen, auch Arbeitseinkommen<br />
der Ehefrau, er war der alleinige gesetzliche Vertreter der<br />
ehelichen Kinder. Die Mutter hatte zwar eine sogenannte<br />
Nebengewalt, der Inhaber der elterlichen Hauptgewalt war<br />
jedoch der Vater, und im Streitfalle entschied er, er hatte<br />
den sogenannten Stichentscheid. Scheiterte eine Ehe, so<br />
wurde sie aus Verschulden geschieden. Ehebruch war ein<br />
absoluter Scheidungsgrund, wer schuldig geschieden wurde,<br />
verlor alle Ansprüche und musste seinerseits, wenn er<br />
leistungsfähig war, Unterhalt an den anderen Ehegatten<br />
bezahlen. Uneheliche Kinder waren mit ihrem Vater, der<br />
Erzeuger genannt wurde, nicht verwandt, die uneheliche<br />
Mutter hatte eine eingeschränkte elterliche Gewalt über<br />
ihr eigenes Kind.<br />
Diese rechtlichen Regelungen hatten den ersten Weltkrieg<br />
überdauert, die Weimarer Republik, das Dritte Reich und<br />
den zweiten Weltkrieg. Viele Männer kehrten aus dem<br />
Krieg zurück und übernahmen wie selbstverständlich<br />
wieder Führung und Alleinentscheidung in der Familie,<br />
auch wenn ihre Ehefrauen während des Krieges und der<br />
Abwesenheit des Mannes alle häuslichen und beruflichen<br />
Aufgaben allein gelöst hatten. Die ehelichen Kinder blieben<br />
nach wie vor der alleinigen gesetzlichen Vertretung<br />
des Vaters ebenso unterworfen wie seiner Alleinentscheidungsbefugnis<br />
über Wohnung, Schulausbildung, Berufsausbildung,<br />
usw. Die Situation im Jahre 1949 war - mit<br />
einem Wort - sehr ähnlich derjenigen von Effi Briest, deren<br />
Schicksal Theodor Fontane in seinem 1890 begonnenen<br />
Roman so eindrucksvoll geschildert ist: Ein Seitensprung,<br />
der Jahre zurücklag, führte dazu, dass Effi Briest nicht nur<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008
Anfangsplenum<br />
Anfangsplenum<br />
allein schuldig geschieden wurde, sondern dass sie ohne<br />
einen Pfennig das Haus des Mannes verlassen musste und<br />
dass jegliche Verbindung zu ihrer Tochter beendet wurde.<br />
C. Die Entwicklung seit 1949<br />
Was die Gesellschaft in Deutschland im Jahre 1949 unter<br />
Ehe und Familie verstand, unterscheidet sich grundlegend<br />
von heutiger gesellschaftlicher Anschauung. Die gesellschaftlichen<br />
Veränderungen und der Wandel von moralischen<br />
und sozialethischen Anschauungen haben in den<br />
letzten 50 Jahren nicht nur die Lebenswelt von Ehe und<br />
Familie tiefgreifend verändert, sondern auch die Auffassung<br />
über die Beziehung der Geschlechter zueinander.<br />
I. Demographische Entwicklung<br />
Ein Blick in den demographischen Entwicklungsprozess<br />
macht dies deutlich.<br />
Die Zahl der Eheschließungen ist rückläufig (1980:<br />
496.603; 2001: 389.561), die Zahl der Ehescheidungen<br />
steigt (1980: 156.425; 2001: 197.468; 2004: 214.000).<br />
2001 wurden 734.475 Kinder geboren, davon 183.816<br />
nichtehelich (25%). Anfang des Jahres 2002 gab es in<br />
Deutschland rund 22,5 Mio. Familien, 12,7 Mio. davon<br />
hatten Kinder, während es alleinerziehende Eltern 2,15<br />
millionenfach gab. Jede 4. Familie mit Kindern hatte also<br />
nur einen Elternteile. Die Zahl der nichtehelichen Lebensgemeinschaften<br />
wurde im Jahre 1999 auf ca. 2,1 Mio.<br />
geschätzt3.<br />
II. Rechtliche Veränderungen<br />
Diesen, sich bereits 1949 bei Inkrafttreten des Bonner<br />
Grundgesetzes abzeichnenden tiefgreifenden gesellschaftlichen<br />
Veränderungen galt es, durch gesetzliche<br />
Regelungen zu entsprechen, sie nachzuvollziehen oder<br />
aber auch sie vorauseilend zu prägen.<br />
Das ist seit 1949 in vielfältigster Weise geschehen, dieser<br />
Prozess hält bis heute an.<br />
1. Entscheidend hierfür war außer dem tatsächlichen<br />
gesellschaftlichen Wandel das Inkrafttreten des Gleichberechtigungsgrundsatzes<br />
aus Art. 3 Abs. 2 GG. Alles<br />
Familienrecht, das dem Gleichberechtigungsgrundsatz<br />
widersprach, trat am 31.3.1953 außer Kraft. Der Deutsche<br />
Bundestag hatte es nicht vermocht, bis zu diesem<br />
Tag neues, verfassungskonformes Recht für Ehe und<br />
Familie zu schaffen, und so entstand im gesamten Familienrecht<br />
eine große Lücke, die erst vier Jahre später im Juli<br />
1957 durch das Gleichberechtigungsgesetz4 geschlossen<br />
wurde. Zwar führte das Gleichberechtigungsgesetz von<br />
1957 im ehelichen Güterrecht die sogenannte Zugewinngemeinschaft<br />
ein und schaffte zugleich die ausschließliche<br />
ehemännliche Verwaltung und Nutznießung des<br />
Frauenvermögens ab. Auch versuchte das Gleichberechtigungsgesetz,<br />
die ehelichen Eltern in ihrem Verhältnis zu<br />
den ehelichen Kindern gleichzustellen. Aber der Deutsche<br />
Bundestag konnte sich nicht entschließen, die Gleichberechtigung<br />
in der Stellung der Eltern zu ihren Kindern wirklich<br />
durchzusetzen. So enthielt das Gleichberechtigungsgesetz<br />
noch immer den sogenannten Stichentscheid des<br />
Vaters und dessen alleinige gesetzliche Vertretung für das<br />
eheliche Kind. Schon ein Jahr später erklärte das Bundesverfassungsgericht<br />
durch Urteil vom 29.7.19595 diese<br />
beiden Regelungen für nichtig. Wiederum entstand eine<br />
erhebliche Lücke im Gesetz, die erst mehr als 20 Jahre<br />
später, durch das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der<br />
elterlichen Sorge6 geschlossen wurde.<br />
2. Im Familienrecht fanden weitere tiefgreifende Reformen<br />
statt, die hier nur in ihren wesentlichen Teilen genannt und<br />
auch nur skizziert werden können.<br />
a) Das Nichtehelichengesetz<br />
So trat am 1.7.1970 das Gesetz über die rechtliche Stellung<br />
der nichtehelichen Kinder7 in Kraft. Erst seit dem<br />
1.7.1970 hießen Kinder, deren Eltern bei der Geburt nicht<br />
miteinander verheiratet waren, nicht mehr uneheliche<br />
Kinder, sondern nichteheliche Kinder. Von diesem Tag an<br />
waren sie mit ihrem Vater verwandt mit der Folge, dass<br />
sie legale Beziehungen auch zur Vaterfamilie hatten. Und<br />
das wiederum hatte zur Folge, dass sie erbberechtigt
waren. Allerdings war das Erbrecht der nichtehelichen<br />
Kinder anders ausgestaltet als das ehelicher Kinder. Die<br />
Mutter blieb die alleinige Inhaberin der elterlichen Gewalt,<br />
wie sie seinerzeit noch hieß, ihre Zuständigkeit blieb aber<br />
beschränkt: Soweit es um die gesetzliche Vertretung des<br />
Kindes ging, war die Mutter zwar Inhaberin der elterlichen<br />
Gewalt. Sie konnte jedoch das Kind bei der Geltendmachung<br />
von Unterhaltsansprüchen, bei der Klärung der<br />
Abstammungsfrage und bei Erbansprüchen nicht selbst<br />
vertreten, sie erhielt hierfür vom Vormundschaftsgericht<br />
einen Amtspfleger gestellt.<br />
b) Das Eherechtsreformgesetz<br />
Am 1.7.1977 trat das Erste Eherechtsreformgesetz8<br />
in Kraft, welches die sogenannte Schuldscheidung abschaffte<br />
und statt dessen die Zerrüttungsscheidung einführte,<br />
die bis heute gilt. Das neue Ehescheidungsrecht<br />
brachte auch erstmals den Versorgungsausgleich, also<br />
das Rentensplitting bei Scheidung der Ehe. Da es eine<br />
Schuldscheidung seit nunmehr 30 Jahren nicht mehr gibt,<br />
mussten die Scheidungsfolgen an anderen Kriterien als<br />
an der Scheidungsschuld festgemacht werden. Das galt<br />
vor allem für das Unterhaltsrecht, aber auch für die Verteilung<br />
der elterlichen Gewalt. So erhält seit dem 1.7.1977<br />
im Falle der Scheidung derjenige Ehegatte Unterhalt, der<br />
sich nicht selbst erhalten kann, vorausgesetzt, der andere<br />
Ehegatte ist leistungsfähig. Dies gilt vor allem für Zeiten<br />
der Betreuung eines gemeinsamen Kindes, darüber hinaus<br />
in Fällen von Alter, Krankheit und Arbeitslosigkeit.<br />
Da es eine Schuldscheidung nicht mehr gibt, kann seither<br />
Unterhalt wegen der alleinigen Schuld an der Zerrüttung<br />
der Ehe auch nicht mehr versagt werden. Um dennoch ein<br />
schuldhaftes Verhalten erfassen zu können, führte das<br />
Gesetz eine sogenannte Billigkeitsklausel ein, in welcher<br />
ein schuldhaftes, unehrenhaftes, schädigendes Verhalten<br />
des einen Ehegatten gegenüber dem anderen Ehegatten<br />
zusammengefasst ist. Diese Klausel ermöglicht es, Unterhalt<br />
zu kürzen oder gänzlich zu versagen.<br />
c) Das Sorgerechtsgesetz<br />
Seit dem 1.1.1980 ist das rechtliche Verhältnis von Eltern<br />
und ehelichen Kindern zueinander reformiert worden: Das<br />
Gesetz zur Reform der elterlichen Sorge9 hat die Beziehungen<br />
von Eltern zu ehelichen Kindern demokratisiert.<br />
Seither sind die Eltern verpflichtet, bei der Pflege und<br />
Erziehung der Kinder die wachsende Fähigkeit und das<br />
wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem,<br />
verantwortungsbewusstem Handeln zu berücksichtigen.<br />
Darüber hinaus sind sie verpflichtet, mit dem Kind,<br />
soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist,<br />
Fragen der elterlichen Sorge zu besprechen und mit dem<br />
Kind Einvernehmen anzustreben. Das Sorgerechtsreformgesetz<br />
hat auch endlich die absolute Gleichstellung der<br />
Eltern in der gesetzlichen Vertretung gebracht, die seit<br />
dem Jahre 1958 zwar von der Rechtsprechung so behandelt<br />
wurde, es fehlte jedoch an einer entsprechenden gesetzlichen<br />
Regelung.<br />
Das Sorgerechtsgesetz von 1980 brachte auch zum ersten<br />
Mal eine Vorschrift, nach welcher entwürdigende Erziehungsmaßnahmen<br />
unzulässig sind, sowie die Bestimmung,<br />
dass in Angelegenheiten der Ausbildung und des<br />
Berufs die Eltern insbesondere auf Eignung und Neigung<br />
des Kindes Rücksicht zu nehmen haben.<br />
Soweit es das sogenannte Umgangsrecht, also das Besuchsrecht<br />
zwischen Kind und abwesendem Elternteil<br />
angeht, blieb das Sorgerechtsgesetz von 1980 noch bei<br />
einer Unterteilung zwischen ehelichen und nichtehelichen<br />
Kindern: Während der abwesende eheliche Elternteil nach<br />
der Trennung die Befugnis zum persönlichen Umgang mit<br />
dem Kind behielt, hatte der nichteheliche Vater das Recht,<br />
sein Kind zu sehen, nur dann, wenn entweder die Mutter<br />
dem zustimmte oder aber das Vormundschaftsgericht ihm<br />
dieses Recht einräumte.<br />
d) Das Kindschaftsrechtsreformgesetz<br />
Seit dem 1.7.1998, dem Inkrafttreten des Kindschaftsrechtsreformgesetzes10,<br />
unterscheidet das Gesetz nicht<br />
mehr zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern.<br />
Beide Begriffe sind aus dem Gesetz verschwunden. Als<br />
Konsequenz folgt daraus, daß eheliche wie nichteheliche<br />
Kinder generell gleich behandelt werden. So haben sie<br />
identische Unterhaltsansprüche gegen den anderen El-<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008
Anfangsplenum<br />
Anfangsplenum<br />
ternteil, der sie nicht betreut. Erstmals können seit dem<br />
1.7.1998 auch Eltern eines nichtehelichen Kindes gemeinsam<br />
sorgeberechtigt sein, allerdings nur, wenn die Mutter<br />
zustimmt, während die Eltern eines ehelichen Kindes mit<br />
der Geburt des Kindes gemeinsam sorgeberechtigt werden<br />
und dies auch bleiben, wenn sie sich trennen. Zwar<br />
lässt das Gesetz die familiengerichtliche Übertragung der<br />
alleinigen elterlichen Sorge auf einen der beiden ehelichen<br />
Elternteile zu, jedoch nur, wenn das Kind zustimmt<br />
oder aber wenn besondere Gründe dies erfordern. Der<br />
Regelfall ist also seit 1.7.1998, dass alle in einer Ehe<br />
geborenen Kinder beiden Eltern gleichmäßig zugeordnet<br />
sind und dies auch bleiben, falls die Eltern sich trennen<br />
oder scheiden lassen. Für nichteheliche Eltern gilt dies so<br />
noch nicht. Es ist jedoch zu erwarten, dass sich auch hier<br />
im Laufe der Zeit eine absolute Angleichung der Rechtsstellung<br />
der Eltern herausbilden und sodann gesetzlich<br />
normiert werden wird.<br />
Seit dem 1.7.1998 sind auch alle Kinder gleichmäßig erbberechtigt,<br />
die nichtehelichen Kinder sind erbrechtlich<br />
jetzt gänzlich den ehelichen gleichgestellt.<br />
e) Das Gewaltächtungsgesetz<br />
Seit Inkrafttreten des Gewaltächtungsgesetzes am<br />
3.11.200011 hat das Kind ein ausdrückliches Recht auf<br />
gewaltfreie Erziehung.<br />
f) Das Unterhaltsrechtsänderungsgesetz<br />
Am 1.1.2008 ist das Unterhaltsrechtsänderungsgesetz12<br />
in Kraft getreten. Die Regeln für den sogenannten<br />
nachehelichen Unterhalt sind erheblich verändert,<br />
das gilt auch für den Betreuungsunterhalt des nichtehelichen<br />
Elternteils sowie für den Kindesunterhalt. Seither<br />
haben nur Kinder den absoluten Vorrang vor allen<br />
anderen Verwandten, soweit es um Unterhaltszahlungen<br />
geht. Dies gilt für minderjährige Kinder und solche Kinder,<br />
die zwar volljährig sind, aber noch zur Schule gehen<br />
(privilegierte Volljährige). Rangmäßig müssen alle<br />
Erwachsenen zurücktreten, insbesondere auch kinderbetreuende<br />
Elternteile finden sich gemeinsam im zweiten<br />
Unterhaltsrang wieder. Sie haben untereinander<br />
denselben Rang, also eine geschiedene Mutter ebenso<br />
wie eine Mutter in aktueller Ehe oder aber auch die nicht<br />
verheiratete Mutter.<br />
Entscheidendes Kriterium der neuen Regelung ist die gesteigerte<br />
Eigenverantwortung des geschiedenen, unterhaltsbedürftigen<br />
Ehegatten. Zwar bestand der Grundsatz<br />
der Eigenverantwortung schon seit dem 1.7.1977, er hat<br />
sich aber in der Rechtsprechung nicht wirklich durchgesetzt.<br />
Daran hat auch das erste Unterhaltsänderungsgesetz<br />
von 1986 Entscheidendes nicht verändert. Jetzt aber ist<br />
das Gesetz so formuliert, dass generell im Unterhaltswege<br />
nur noch ehebedingte Nachteile ausgeglichen werden, Ziel<br />
der Unterhaltsregelungen nach einer Scheidung ist nicht<br />
mehr, dem unterhaltsbedürftigen Ehegatten den Ehestandard<br />
zu sichern. Das Gesetz enthält seit dem 1.1.1980<br />
Vorschriften, die eine Befristung und Herabsetzung des<br />
nachehelichen Unterhalts ermöglichen und erleichtern,<br />
erste Gerichtsentscheidungen machen deutlich, dass die<br />
Gerichte von diesen Beschränkungsmöglichkeiten auch<br />
entschlossen Gebrauch machen werden.<br />
D. Zusammenfassung und Ausblick<br />
Diese stark verkürzte tour d´horizon der gesetzlichen Entwicklung<br />
seit 1949 zeigt, dass der besondere Schutz, den<br />
Ehe und Familie nach Art. 6 Abs. 1 GG genießen, zwar vom<br />
Bundesgesetzgeber und vom Bundesverfassungsgericht<br />
gewahrt und gewährleistet wird. Jedoch hat der Inhalt dieser<br />
Schutz- und Förderungsbestimmung einen deutlichen<br />
Wandel erfahren: Wenn einerseits die Zahl der Eheschließungen<br />
zurückgeht, die Zahl der Scheidungen steigt, aber<br />
auf der anderen Seite immer mehr Menschen unverheiratet<br />
zusammenleben und Kinder haben, müssen Staat und<br />
Gesellschaft diese neuen Lebensformen nicht nur akzeptieren,<br />
sie müssen ihr auch einen sozialen Mindestschutz<br />
gewähren. Auf diesem Wege schreiten Gesetzgebung und<br />
Rechtsprechung fort: So ist der Schutz der nichtehelichen<br />
Mutter im Unterhaltsrecht seit dem 1.1.1980 gegenüber<br />
der ehelichen Mutter deutlich verstärkt worden. Die Rechtsprechung,<br />
die bisher das nicht legalisierte Zusammenleben<br />
von heterosexuellen Paaren kaum geschützt hat, geht
dazu über, diese Haltung aufzugeben. Aus hiesiger Sicht<br />
ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann für nichteheliche,<br />
gefestigte Lebensgemeinschaften insgesamt ein gewisser<br />
Mindestschutz gesetzlich eingeführt wird. Denn derzeit<br />
besteht das etwas skurrile Faktum, dass heterosexuelle<br />
Partner heiraten können, homosexuelle Partner sich offiziell<br />
verpartnern können mit der Folge, dass sie eheähnliche<br />
Wirkungen für ihre Partnerschaft haben, während die<br />
nichteheliche Lebensgemeinschaft heterosexueller Partner<br />
bisher kaum geschützt ist. Dies ist jedenfalls dann,<br />
wenn Kinder aus einer solchen Verbindung hervorgehen,<br />
nicht tolerabel. Denn in diesen Fällen wird fast stets einer<br />
der beiden Partner sozial schwächer oder bedürftig sein,<br />
wenn und soweit er oder sie die gemeinsamen Kinder über<br />
Jahre versorgt hat.<br />
Betrachtet man das neue Unterhaltsrecht, so nehmen<br />
Gesetz und Rechtsprechung in Kauf, dass ein großer Teil<br />
geschiedener Eheleute, zumeist Frauen, sich weder aus<br />
eigener Kraft erhalten noch durch Unterhalt des anderen<br />
Ehegatten ihren Unterhalt sichern können. Das bedeutet<br />
im Endeffekt, dass diese geschiedenen Eheleute von der<br />
Allgemeinheit unterhalten werden müssen. Man könnte<br />
diese Wandlung im Verständnis von Ehefolgen so bezeichnen,<br />
dass Staat und Gesellschaft hier familiäre Aufgaben,<br />
nämlich Sicherung der nachehelichen Existenz,<br />
übernehmen.<br />
Das Bonner Grundgesetz wahrt die Grenzen zwischen familiärer<br />
Autonomie und staatlichem Eingriff nicht nur, es<br />
hat diese Grenzen durch Art. 6 sehr scharf gezogen. Stets<br />
sind die Eltern „zuvörderst“ zuständig für Erziehung und<br />
Ausbildung der Kinder, eine staatliche Erziehung hat das<br />
Bonner Grundgesetz auf jeden Fall verhindern wollen. Hierüber<br />
besteht auch Einigkeit. Dennoch gibt es eine Entwicklung,<br />
die im Jugendhilferecht die Kompetenzen der<br />
Jugendämter allmählich gestärkt haben und wohl weiter<br />
stärken werden. Durch das Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz13,<br />
in Kraft seit dem 1.10.2005, haben die Jugendämter<br />
wieder die eigene Aufgabe und Zuständigkeit erhalten,<br />
Risikolagen für Kinder selbständig einzuschätzen und<br />
im Falle, dass die Eltern die Gefährdung nicht beseitigen<br />
können oder wollen, haben die Jugendämter die Pflicht,<br />
die Familiengerichte von sich aus anzurufen. Dieser neue<br />
§ 8a SBG VIII fängt erst an, sich allmählich auszuwirken.<br />
Noch sind viele Jugendämter unsicher darin, wie sie die<br />
entsprechende Gefährdungslage sachverständig einzuschätzen<br />
haben und welche Folgerungen zu ziehen sind.<br />
Immerhin lässt sich konstatieren, dass durch eine solche<br />
Regelung die Grenzen zwischen familiärer Autonomie und<br />
staatlichem Eingriff zugunsten des staatlichen Eingriffs<br />
verschoben sind.<br />
Hierher gehören auch Überlegungen, die kindlichen Vorsorgeuntersuchungen<br />
zur Pflicht der Eltern zu machen.<br />
Bisher ist eine solche<br />
obligatorische<br />
Untersuchung aus<br />
verfassungsrechtlichen<br />
Gründen, Art.<br />
6 Abs. 2 GG, stets<br />
verneint worden.<br />
Ähnliche Überlegungen<br />
sind anzustellen,<br />
wenn es um<br />
die Einführung einer<br />
eventuellen Kindergartenpflicht, jedenfalls für das letzte<br />
Jahr vor der Einschulung, geht. Auch hier muss stets abgewogen<br />
werden zwischen der elterlichen Erziehungsautonomie<br />
einerseits und dem Bedürfnis und Interesse der<br />
Gesellschaft andererseits, Kinder bestmöglich zu fördern.<br />
Ist man mit seinen Überlegungen so weit gediehen, ist<br />
es nur noch ein kleiner Schritt zu der Initiative, die seit<br />
einigen Jahren von Abgeordneten des Deutschen Bundestages<br />
und gesellschaftlichen Gruppen verfolgt wird:<br />
Die Aufnahme von eigenen Kindergrundrechten in unsere<br />
deutsche Bundesverfassung. Durch solche eigenen<br />
Kindergrundrechte soll nicht nur der bessere Schutz von<br />
Kindern ermöglicht werden, darüber hinaus soll den Kindern<br />
ein eigenes Grundrecht auf bestmögliche Förderung<br />
und Bildung und ein Recht auf Teilhabe an allen Entscheidungen,<br />
die sie selbst betreffen, durch einen solchen<br />
Grundgesetzartikel eingeräumt werden.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008
10<br />
Anfangsplenum<br />
Anfangsplenum<br />
Die Diskussion steht erst am Anfang. Da für jede Grundgesetzänderung<br />
eine 2/3 Mehrheit im Bundestag erforderlich<br />
ist, wird es nach hiesiger Einschätzung auch noch<br />
längere Zeit dauern, bevor mit einer solchen Grundgesetzänderung<br />
gerechnet werden kann. Interessant ist aber die<br />
Entwicklung und die Bewegung, die eine solche Initiative<br />
zeigt: Macht sie doch deutlich, dass es viele Kritiker in unserem<br />
Lande gibt, die den Schutz, aber auch die Förderung<br />
von Kindern nicht für ausreichend verfassungsrechtlich<br />
geregelt halten und die darüber hinaus dafür plädieren,<br />
50 Jahre nach Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes<br />
die absolute Elternautonomie jedenfalls dann in Frage zu<br />
stellen, wenn es um Schutz, Förderung und Beteiligung<br />
von Kindern geht.<br />
Herbert Scherer:<br />
Gerade sind wir bei<br />
spannenden Fragen<br />
angekommen,<br />
die uns in den<br />
Nachbarschaf tseinrichtungen<br />
aus<br />
einer anderen Perspektive<br />
begegnen.<br />
<strong>Familiennetze</strong> haben<br />
wir zum Thema<br />
dieser Tagung gemacht, wir wenden uns dem Thema<br />
Familie zu. Jetzt könnten die Kritiker sagen: Nachbarschaftsheime<br />
sind ja immer konjunkturbewusst. Sobald<br />
eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, wie jetzt die<br />
Familie, schon sind sie auch auf diesen Zug aufgesprungen.<br />
Wie Hase und Igel, die sind schon immer da, wenn<br />
es ein neues Thema gibt.<br />
Ich denke, so ist das mit multifunktionalen Einrichtungen,<br />
wenn es neue Themen gibt, haben sie immer auch etwas<br />
damit zu tun.<br />
Aber die Familienfrage ist mehr als das, sie ist für Nachbarschaftsheime,<br />
für Sozialarbeiter, vielleicht so etwas wie<br />
eine Gretchenfrage, ein Lackmustest. Es geht nämlich eigentlich<br />
um die Frage, die Frau Peschel-Gutzeit am Schluss<br />
angesprochen hat: Welche Rolle haben diejenigen, die<br />
über Erziehung meinen besser Bescheid zu wissen? Welche<br />
Verpflichtungen haben sie auch ggf. einzugreifen in<br />
dieses komplizierte Verhältnis zwischen Rechten verschiedener<br />
Beteiligter? Es geht letztlich um das Verhältnis der<br />
professionellen Helfer, Erzieher und Bildner, Lehrer zum<br />
Beispiel, zu anderen Systemen, zu konkurrierenden Systemen.<br />
Will man mit ihnen die Verantwortung teilen? Oder<br />
geht es um Dominanz? Oder geht es darum, wer eigentlich<br />
verantwortlich ist, wenn etwas schief geht?<br />
Das zieht sich ja durch. Es ist nicht nur eine Frage gegenüber<br />
den Familien, sondern das ist eine Frage gegenüber<br />
dem bürgerschaftlichen Engagement, gegenüber der Ehrenamtlichkeit,<br />
werden diejenigen, die auf dem gleichen<br />
Feld auftauchen, das die professionelle Sozialarbeit für<br />
sich reklamiert, Konkurrenten oder Partner? Insofern ist<br />
der Umgang mit dem Thema Familie exemplarisch oder<br />
auch ein Indikator dafür, wie man mit diesen weiter gehenden<br />
Fragen umgeht.<br />
Da die meisten Beschäftigten in Nachbarschaftsheimen<br />
Sozialarbeiter sind, haben sie mit dem Familienthema<br />
noch ein besonderes Problem: Die professionelle Sozialarbeit<br />
hat es ja gerade beim Thema Familie vor allem<br />
mit den Familien zu tun, bei denen vieles schief geht. Sie<br />
haben deswegen einigen Anlass, die Dinge so zu sehen,<br />
dass sie sagen: Da müssen wir doch irgendwie eingreifen.<br />
Wir müssen doch eigentlich den unfähigen Eltern die Kinder<br />
entreißen, um ihnen etwas Gutes zu tun. Gerade, weil<br />
sie mit eher überforderten Familien zu tun haben, ist das<br />
nahe liegend.<br />
Folgerichtig gibt es – aus der Sicht von Sozialarbeitern<br />
– zum Beispiel häufig eine Unterstützung der Forderung<br />
nach verpflichtenden Eltern-Kursen, nach gerichtlicher<br />
Anordnung von Familienberatungen, nach Eingriff. Das<br />
Problem der Jugendämter heute, dass sie wieder mehr als<br />
etwas Bedrohliches von Familien wahrgenommen werden,<br />
die Schwierigkeiten haben, führt dazu, dass oft Hilfen, die<br />
angeboten werden, Hilfen, die vorgehalten werden, von<br />
denen, die sie besonders brauchen, nicht wahrgenommen<br />
werden, weil sie vor den Eingriffsrechten, die dort neu for-
muliert werden, Angst haben. Und dabei geht es nicht nur<br />
um die Bedrohung durch den Eingriff, sondern auch um<br />
die Haltung, um die Haltung der Besserwisser, die für die<br />
Menschen, die Probleme haben, nicht immer hilfreich ist.<br />
Das ist eine Tradition, die mir in meiner professionellen<br />
Laufbahn, solange ich Berührung mit Sozialarbeit habe,<br />
an vielen Stellen begegnet ist. Das erste Mal war es 1975<br />
in einem öffentlichen Kindergarten, als ich ein Praktikum<br />
machte. Ich habe registriert, wie die Erzieherinnen über<br />
die Eltern geredet haben, wie sie die Kinder vor diesen<br />
Eltern bewahren wollten, wie sie nicht mit Eltern kooperieren<br />
wollten, weil sie die Eltern für unfähig hielten. Ende der<br />
70-er Jahre, Anfang der 80-er Jahre, habe ich das in der<br />
Jugendfreizeitarbeit erlebt, wo wir, als die Leute, die dort<br />
gearbeitet haben, die Jugendlichen in ihrem Protestverhalten<br />
gegen die Familie gestärkt haben, bis wir zu einer<br />
etwas differenzierteren Haltung gefunden haben, als es<br />
um die Frage ging: Wer hilft ihnen? Wer hilft ihnen dann,<br />
wenn sie zum Beispiel in den Beruf gehen, wenn die Schule<br />
zu Ende ist? Welche Netze brauchen sie, wenn es um so<br />
etwas geht? Und wo klar war, dass aus den Familien mehr<br />
Unterstützung kam als von uns, die wir auch getrennt waren<br />
von den beruflichen Feldern, mit denen die Eltern und<br />
die Familie etwas zu tun hatten.<br />
Ich habe es dann in den 80-er Jahren erlebt bei der heftigen<br />
Diskussion über die neue Systematik des Jugendhilfegesetzes,<br />
wo die Sozialarbeiter als Profession gegen die<br />
Konstruktion der Hilfen zur Erziehung gewettert haben.<br />
Hilfen zur Erziehung war eine völlig neue Systematik im<br />
Recht, vorher ging es darum, dass die Jugendämter ein<br />
Eingriffsrecht hatten, jetzt sollte Jugendhilfe die Erziehungskompetenz<br />
der Eltern stärken. Deswegen heißt es<br />
auch Hilfen zur Erziehung. Heute lachen die Träger der<br />
Hilfen zur Erziehung darüber, wenn sie das hören, das haben<br />
sie längst vergessen.<br />
In den 90-er Jahren, als es eine neue Familienorientierung<br />
auch seitens der Regierung gab, zusammen mit der konservativen<br />
Wende, gab es in unseren Reihen eine andere<br />
Argumentation. Es ging eher darum zu sagen: Der Staat<br />
will sich seiner Verantwortung entledigen. Das hing damit<br />
zusammen, dass wir uns üblicherweise als Wahrnehmer<br />
staatlicher Aufgaben gesehen haben, also wir hatten den<br />
Unterschied zwischen<br />
Staat und<br />
Gesellschaft noch<br />
nicht so richtig<br />
verinnerlicht. Die<br />
Wendung hin zur<br />
Familie, zum Begriff<br />
Familie, in der öffentlichen<br />
Debatte<br />
stand damals unter<br />
Ideologieverdacht.<br />
Nach dem, was Frau Peschel-Gutzeit heute gesagt hat, ist<br />
das verständlich.<br />
Andererseits gab es in den 90-er Jahren den Beginn dessen,<br />
womit wir es heute zu tun haben und was erneut die<br />
Frage Familie auf die Tagesordnung setzt, nämlich des<br />
massiven Rückgangs der Geburtenrate, neben der Verunsicherung,<br />
die in Deutschland wahrscheinlich mit der<br />
Vereinigung zusammenhängt, und die heute dazu geführt<br />
hat, dass wir in der demografischen Situation noch sehr<br />
viel schärfer dastehen als vergleichbare andere Länder.<br />
Wir haben eine Problemlage, die Reaktionen erfordert, die<br />
in der Politik reflektiert wird. Da geht es nicht nur um die<br />
Sicherung der Rente, das ist sozusagen die Stammtisch-<br />
Variante. Es geht letztendlich um die Frage des Zusammenlebens<br />
zwischen den Generationen, zwischen den<br />
Menschen, in der Familie und anderswo.<br />
Was ist denn eigentlich für uns Familie? Ich denke, wir<br />
müssen darüber neu nachdenken. Das ist nicht unabhängig<br />
vom Zeitgeist, wahrscheinlich haben wir auch selber<br />
sehr widersprüchliche Assoziationen, wenn wir an Familie<br />
denken. Die Familie wird einerseits gesehen als Zwangsgemeinschaft,<br />
die ich mir nicht aussuchen kann. Das sind<br />
Zusammenhänge, in die ich hineingeboren wurde. Auf der<br />
anderen Seite ist Familie ein Netzwerk. Ein Netzwerk, das<br />
über Differenzen hinweg andauert, die Familie besteht,<br />
ohne dass ich mich beweisen muss, ohne dass ich meine<br />
Zugehörigkeit erwerben muss. Das sind Extreme, das<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 11
12<br />
Anfangsplenum<br />
Anfangsplenum<br />
Schwanken zwischen<br />
Extremen,<br />
vielleicht sind es<br />
aber auch nur zwei<br />
Seiten derselben<br />
Medaille und in<br />
unterschiedlichen<br />
Lebensphasen wird<br />
es unterschiedliche<br />
Dinge geben, die<br />
im Vordergrund stehen.<br />
Zum Beispiel Jugendliche, die sich lösen müssen,<br />
die sehen das sicher anders, als Kinder oder als ältere<br />
Menschen, die eher auf die unterstützenden Funktionen<br />
dieser Netzwerke angewiesen sind. Was steht im Vordergrund?<br />
Welche unserer Erfahrungen nehmen wir wie wahr<br />
und wie geben wir sie weiter?<br />
Ich denke, wir müssen damit leben und wir müssen es<br />
schaffen, beide Aspekte zu betrachten. Das Spannungsverhältnis<br />
macht es gerade aus, es geht immer um beides,<br />
es geht nicht um die Dominanz einer dieser Sichtweisen,<br />
sondern es geht um das Aushalten dieser Widersprüchlichkeit,<br />
darum, in dieser Widersprüchlichkeit die Potenziale<br />
zu entdecken und zu entfalten.<br />
Durch das, was Frau Peschel-Gutzeit uns über die neuen<br />
Definitionen erzählt hat, die das Verfassungsgericht zum<br />
Familienbegriff formuliert hat und die sich allmählich auch<br />
in der Gesellschaft durchsetzen, ist es einfacher geworden.<br />
Das entspannt. Es ist klar, auch in dem, was die Fachleute<br />
sagen, geht es nicht um die traditionelle konservative<br />
Kleinfamilie, sondern es geht um alles, was Zusammenleben<br />
zwischen den Generationen in engen Netzen umfasst,<br />
egal, wie es im Einzelnen aussieht. Das ist auch gut so,<br />
weil es den Blick öffnet für das, was Familie sein kann.<br />
Und dann steht im Vordergrund nicht die Zwangsveranstaltung,<br />
sondern der liebevolle Zusammenhalt. Das Wichtige<br />
daran ist, dass Menschen zusammen sind, ohne eine<br />
Leistungserwartung, einfach da sein und gewollt werden.<br />
Ich denke, dieser Aspekt ist verdammt wichtig in unserer<br />
Leistungsgesellschaft, Beziehungen, die eben nicht auf<br />
Leistung und Gegenleistung beruhen, auf dem Austausch<br />
von Waren und Dienstleistungen oder auf Bezahlung.<br />
Solche kleinen Gemeinschaften, wie es eine gute Familie<br />
sein kann, dazu gehört, sich trotzdem zu akzeptieren,<br />
sich manchmal auch aus dem Weg zu gehen und nichts<br />
desto weniger in irgendeiner Form zusammenzuhängen.<br />
Die Notwendigkeit von kleineren Einheiten ist unbestritten<br />
angesichts von Globalisierung, Monetarisierung aller<br />
Beziehungen, aber auch angesichts von Virtualisierung,<br />
mit der wir jetzt gerade in der ganzen Welt zu tun haben.<br />
Die kleinen Zusammenhänge, die kleinen Netze, die Art<br />
des Umgangs miteinander, Lösungen im Nahbereich finden,<br />
dort, wo man selbst etwas bewegen kann, und nicht<br />
auf höhere Wesen oder auf den Staat oder andere Retter<br />
setzen, das hat auch etwas mit Demokratie zu tun,<br />
mit Selbstverantwortung und Selbstbestimmung.<br />
Familien leben übrigens davon, dass sie heterogen<br />
sind, dass Menschen aus verschiedenen Generationen,<br />
Menschen verschiedener politischer Anschauungen,<br />
aus verschiedenen beruflichen Zusammenhängen und<br />
Zuordnungen, unterschiedlicher Bildungsniveaus, Lebensumstände<br />
und sozialer Lage und nicht zuletzt unterschiedlichen<br />
Geschlechts etwas miteinander zu tun<br />
haben. Dieses muss nicht ausschließlich die Familie<br />
sein, es muss so etwas wie Familie sein, Ersatzfamilien<br />
können das auch leisten. Es geht um eine bestimmte Art<br />
von Beziehung zueinander, geprägt von leben und leben<br />
lassen, von Toleranz und Respekt, und von einer Beziehung,<br />
die nicht von Leistung oder Geld geprägt ist. Gute<br />
Nachbarschaft hat vieles davon.<br />
Anders als die Familie, die einfach da ist, im Guten und<br />
im Schlechten, ist Nachbarschaft machbar. Das ist eine<br />
unserer Aufgaben, solidarisches Zusammenleben, Freude<br />
aneinander, Hilfe, wo es Not tut, Respektieren und<br />
in Ruhe lassen, wenn es das Beste ist, sorgfältig hinsehen<br />
– trotz allem, eine Kursbestimmung zwischen den<br />
Extremen Einfluss und Gleichgültigkeit. Wenn wir das<br />
Familienthema so aufgreifen, sind wir sicherlich einerseits<br />
sehr aktuell, weil es ein aktuelles Thema ist. Andererseits<br />
aber doch nicht Mainstream, weil Mainstream<br />
schwankt zwischen dem Generalverdacht und dem<br />
Nichtzutrauen und Überfordern, also diese Mischung, einerseits<br />
nichts zutrauen, andererseits alles zuschieben.
Gegen den Strom zu schwimmen, das ist insofern eine<br />
vorrangige Aufgabe und in jeder Hinsicht eine Aufgabe<br />
der Nachbarschaftsheime. Segler wissen übrigens, wie<br />
man das macht, sie kreuzen gegen den Wind, Forellen<br />
wissen das auch, sie schwimmen aufwärts, und Paddler<br />
wissen auch, wie man das mit den Trends oder dem<br />
Mainstream machen kann.<br />
Stellen Sie sich einen Fluss vor, an dessen Ufern gibt<br />
es Bunen, also kleine Molen, die in den Flusslauf hinein<br />
reichen. Wenn ein Paddler stromauf fahren will, gegen<br />
den Strom, dann nutzt er die Tatsache, dass es zwischen<br />
den Bunen eine Gegenströmung gibt. So ist es möglich,<br />
Trends wahrzunehmen und trotzdem gegen den Strom<br />
zu schwimmen. Man muss nur an den Ecken aufpassen,<br />
weil da die Strömungen aufeinander stoßen. Das<br />
ist eigentlich der Sinn einer Tagung wie der, zu wir uns<br />
hier heute zusammen gefunden haben, dass wir uns an<br />
diesen Stellen, wo die Strömungen aufeinander stoßen,<br />
sehr deutlich überlegen, wie wir unseren Kurs bestimmen,<br />
damit wir es schaffen, tatsächlich auch immer aufwärts<br />
zu schwimmen.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 13
14<br />
Workshop<br />
Einfach gut<br />
Niedrig schwellige Zugänge in der Arbeit mit Familien<br />
Inputs:<br />
Claudia Grass (Nachbarschaftsheim Schöneberg)<br />
„Das Elterncafé als ein niedrig schwelliges Angebot“<br />
Dorothee Peter (Nachbarschaftsheim Neukölln) /<br />
Keziban Aydin (Diakonisches Werk)<br />
„Stadtteilmütter in Berlin-Neukölln“<br />
Elke Ostwaldt (Outreach Treptow-Köpenick)<br />
„Mobile Jugendarbeit und ‚aufsuchende<br />
Familientherapie‘ - der SOPHIA-Ansatz“<br />
Moderation:<br />
Theo Fontana<br />
Theo Fontana: Als Einstieg vielleicht die Frage, warum<br />
dieses Thema „Niedrig schwellige Angebote an Familien“<br />
so ein Modethema ist. Ich denke schon, es ist eine Antwort<br />
auf Veränderungen. Bei meiner früheren Tätigkeit als<br />
Streetworker war es eher verpönt, mit Familien zusammen<br />
zu arbeiten. Da scheint sich etwas verändert zu haben.<br />
Zuerst eine kleine Vorstellungsrunde. Was verbindet Sie<br />
mit dem Thema?<br />
TN: Das Bürgerschaftshaus in Köln-Bocklemünd, aus<br />
dem ich komme, ist eine unterstützend-helfende Einrichtung.<br />
Wir sind darauf angewiesen, dass wir Kontakt bekommen.<br />
Es gibt beratende Einrichtungen, da kommen<br />
die Menschen hin, um sich beraten zu lassen. Da entsteht<br />
also auch eine bestimmte Gruppensituation, um<br />
diesen Kontakt aufzunehmen und zu entwickeln. Aber<br />
es gibt auch offene Angebote, wie sie von uns gemacht<br />
werden. Da müssen wir gucken, wie wir die Eltern erreichen.<br />
Ich komme aus einem Arbeitsbereich in einem Stadtteil,<br />
der sehr stark von Menschen mit diversen wirklich schwierigen<br />
Hintergründen bewohnt wird. Bei denen ist es überhaupt<br />
nicht gang und gäbe sich Hilfe zu holen oder sich<br />
irgendwo zu engagieren. Es liegt an uns zu gucken, Augen<br />
und Ohren zu öffnen um mitzubekommen, was die Menschen<br />
bewegt, woran es fehlt. Ein Kontakt ist letztendlich<br />
immer nur über die Niedrigschwelligkeit möglich, weniger<br />
über die Ratio. Mit einem Aushang wird die Mittelschicht<br />
angesprochen.<br />
TN: Ich arbeite in einem Nachbarschaftshaus in Hohenschönhausen,<br />
wo die Armut bei Kindern groß ist, ebenso<br />
die Abhängigkeit von Hartz-IV und anderen Geldleistungen.<br />
Wir müssen also zum einen überlegen, wie wir Kindern<br />
helfen wollen. Im Moment gibt es viel Einzelhilfe für<br />
Kinder, aber wir sind der Auffassung, man muss auch<br />
die Eltern stärken. Wir müssen also sehen, wie wir an<br />
diese Zielgruppe heran kommen, wo liegen ihre Bedürfnisse,<br />
über welche Angebote können wir Familien Unterstützung<br />
geben? Es sollte eine gemeinsame Zielsetzung<br />
von Familien und Nachbarschaftseinrichtung entwickelt<br />
werden.<br />
Theo Fontana: Wir hätten das ja genauso auch schon vor<br />
zehn Jahren machen können, aber damals schien das<br />
noch nicht so brennend. Was ist jetzt anders? Vor zehn<br />
Jahren war es noch relativ ungewöhnlich, wenn ein Streetworker<br />
in eine Familie reingeht. Das ist heute offensichtlich<br />
anders. Was ist da passiert? Bei unserem Selbstverständnis?<br />
Bei den sozialen Bedingungen?<br />
TN: Ich komme vom Gemeinwesenverein Haselhorst. Ich<br />
leite seit neun Jahren ein Eltern-Kind-Café und bin eigentlich<br />
von der Ehrenamtlichkeit da reingekommen. Ich<br />
dachte, in unserem Bezirk gibt es viele Sozialhilfeemp-
fänger und Arbeitslose mit ihren Familien und kleinen<br />
Kindern. Es gab keinen Treffpunkt, wo sie sich treffen<br />
konnten, ohne dass sie das Gefühl haben mussten: jetzt<br />
stürzt sich gleich einer auf dich und will dir eine Beratung<br />
aufquatschen. Das Café war also erst mal ein Treffpunkt,<br />
wo sie sich mit ihren Familien, mit ihren Kindern, wohlfühlen<br />
konnten. Später kamen auch die Männer, auch Omas<br />
und Opas. Sie konnten da einfach Kaffee trinken und<br />
wussten, na ja, wenn ich mal was habe, zu der kann ich<br />
gehen, die kenne ich, zu der habe ich Vertrauen, die sagt<br />
mir dann schon was. Und dann konnte man ganz direkt<br />
sagen: Ich habe da zwar keine Ahnung, aber meine Kollegin,<br />
die berät dich, komm, wir machen das mal. Diese<br />
Niedrigschwelligkeit gibt es bei uns seit neun Jahren, die<br />
bewährt sich gut.<br />
Theo Fontana: Habt ihr da eine Veränderung festgestellt<br />
zu der Zeit vor zehn Jahren?<br />
TN: Nein, es ist gleich bleibend voll bei uns. Es wechseln<br />
mal die Mütter, weil die Kinder irgendwann zu<br />
groß werden für meine beiden kleinen Räume. Die<br />
gleich bleibende Grundlage ist das Gefühl: ich kann da<br />
nachmittags hingehen. Das ist eine Vertrauenssache.<br />
Theo Fontana: Es hat sich offenbar gar nicht so viel verändert,<br />
wie ich behauptet habe.<br />
TN: Ich komme vom Pfefferwerk, einem Träger der Jugendhilfe<br />
und Nachbarschaftsarbeit in Berlin, vor allen Dingen<br />
Prenzlauer Berg. Ich würde sagen, Ihre Sichtweise hat<br />
was mit Ihrer Profession als Straßensozialarbeiter zu tun.<br />
In der Nachbarschaftsarbeit haben wir immer schon mit<br />
offenen Treffpunkten und Angeboten für Familien gearbeitet.<br />
Vor allem in der Sozialarbeit in der Jugendhilfe hat seit<br />
ein paar Jahren in fachlicher Hinsicht eine Entwicklung<br />
stattgefunden. Wenn ich mit schwierigen Jugendlichen<br />
arbeite, die schwere Probleme haben, dann muss ich mir<br />
unter Umständen auch die Situation in den Familien und<br />
im Umfeld angucken. Ich glaube, da hat sich professionell<br />
was verändert.<br />
TN: Ich arbeite in einer Selbsthilfe-Kontaktstelle. Ich habe<br />
früher als Familienhelferin gearbeitet. Die Veränderung ist<br />
aber nicht vor zehn Jahren passiert, sondern ich würde sagen,<br />
vor 15 oder 20 Jahren. Damals sind die sozialen Netzwerke<br />
in der Familie langsam kaputt gegangen. Ich glaube,<br />
es gab vor 15, 20 Jahren noch weniger Scheidungen,<br />
auch Cousinen und Cousins, Nichten und Neffen kannte<br />
man noch und traf die, also es gab noch Netzwerke, in<br />
denen man sich gegenseitig unterstützt hat. Dieses größere<br />
Netzwerk Familie ist so nicht mehr vorhanden. Ich<br />
leite inzwischen PEKiP-Kurse, also Eltern-Kind-Kurse. Die<br />
kommen gut bei Menschen an, die sie auch genießen, die<br />
sie aber nicht so brauchten wie Leute, die ernste Probleme<br />
haben. Für die sind diese Angebote offenbar nicht niedrig<br />
schwellig genug.<br />
TN: Ich komme aus einem Eltern-Kind-Zentrum. Mir begegnen<br />
ganz viele Familien mit Problemen, wo ich dann frage:<br />
haben Sie keine Mutter oder Vater mehr? Das haben sie,<br />
aber sie haben keinen Kontakt mehr zu den Eltern oder<br />
Großeltern. Das, was früher in der Großfamilie funktioniert<br />
hat, Erfahrungsaustausch, praktische Unterstützung, das<br />
funktioniert jetzt einfach nicht mehr.<br />
Wir versuchen jetzt Angebote zu machen, die da eingreifen.<br />
Um die annehmen zu können, müssen die Menschen<br />
erst mal Vertrauen zu uns aufbauen. Das braucht Zeit,<br />
braucht Geduld. Da haben wir so eine „Komm-und-geh-<br />
Struktur“ entwickelt. Kommen die Familien nicht, dann<br />
gehe ich und frage, warum sie nicht kommen. Das ist ein<br />
großes Problem, dass die Familien in kleine Einzelteile zersplittert<br />
sind.<br />
TN: Ich bin vom „Kotti e.V.“ am Kottbusser Tor. Bei uns<br />
ist es so, dass ich mittlerweile die dritte Generation im<br />
Haus habe, die ich schon seit ihrer Kindheit kenne. Es gibt<br />
eine verfestigte Perspektivlosigkeit. Das heißt, die Kinder<br />
haben in ihren Familien nicht gesehen, dass Eltern arbeiten<br />
gehen, sie kennen keine Eltern, die morgens aufgestanden<br />
sind, die einer Tätigkeit nachgegangen sind, die<br />
bestimmte Aufgaben übernommen haben. Natürlich liegt<br />
bei uns auch die Sprache im Argen, die Schulbildung, die<br />
einfach sehr schlecht gelaufen ist und weiterhin schlecht<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 15
16<br />
Workshop Einfach gut<br />
Einfach gut<br />
läuft. Die Verhältnisse untereinander, die dynamischen<br />
Prozesse, die in den Sozialgruppen ablaufen, das spielt<br />
alles mit eine Rolle. Kinder haben keine Vorbilder. Auch<br />
nicht zur Konfliktlösung.<br />
TN: Ich bin seit 20 Jahren Jugendarbeiterin und arbeite<br />
seit fünf Jahren in … Köpenick. Ich bemerke, dass die<br />
Familien, die Hartz-IV-Bezieher sind, sehr abgeschottet<br />
leben, mehr als die Menschen, die erwerbstätig sind. Das<br />
ist ein Kreislauf. Man denkt, man wäre auf staatliche Hilfe<br />
angewiesen, und guckt nur noch sehr, sehr wenig auf die<br />
Selbsthilfe, die es ja gibt, auf die Ressourcen innerhalb<br />
der Nachbarschaft. All das spielt für sie oft keine Rolle<br />
mehr. Viele Familien haben nicht mehr den Glauben daran<br />
haben, dass sie selbst ihre Schwierigkeiten regeln<br />
können.<br />
TN: Wir arbeiten sehr stark mit ausgegrenzten Leuten,<br />
sehr oft mit Migranten. Die meisten unserer Besucher leben<br />
von Hartz-IV und ähnlichen Leistungen. Gerade Familien<br />
mit ganz wenig Geld und Schulden sind stark damit<br />
beschäftigt, ihr Überleben zu sichern. Das blockiert alle<br />
Kräfte, die irgendwie positiv sein könnten.<br />
Unsere Erfahrung ist, dass unsere soziale Beratung einfach<br />
nur dazu dient, dass die Familien den Kopf frei kriegen,<br />
indem man die aufgehäuften Probleme eins nach<br />
dem anderen gemeinsam löst. Das ist ganz niedrigschwellig.<br />
Man kann sich mal wieder auf ein Ziel orientieren, eine<br />
Perspektive kriegen. Das geht erst, wenn ich wieder weiß,<br />
dass z.B. meine Wohnung sicher ist. Mit solchen Sorgen<br />
befassen sich Familien laufend. Das Ganze stürzt schon<br />
zusammen, wenn das Jobcenter nicht rechtzeitig das Geld<br />
überweist. Eine Perspektive für Kinder, das heißt auch,<br />
dass sie mitmachen können bei Klassenfahrten, Ausflügen<br />
usw. Dafür ist oft kein Geld da. Gerade große Familien<br />
scheitern daran.<br />
Ethnische Netzwerke sind sehr oft Großfamilien-Netzwerke,<br />
tragen häufig auch nicht mehr. Es gibt keinen mehr,<br />
der Arbeit hat und der sagt: da wäre noch was bei mir im<br />
Betrieb. Das riskiert niemand mehr. Denn wenn die Verwandtschaft<br />
nicht funktioniert, ist derjenige womöglich<br />
selber in Gefahr. Das ist ein ganz großes Problem.<br />
Den einzigen Alltag außer Haus haben Schulkinder. Aber<br />
sie haben nicht genügend Geld für die Tagesbetreuung in<br />
der Ganztagsschule, Geld für das Mittagessen, Kitabeiträge.<br />
Wenn das aus dem knappen Familien-Budget rausgeschnitten<br />
wird, ist das oft zu viel.<br />
Hinzu kommen dann noch solche Dinge, dass z.B. Jugendliche<br />
von Ämtern vor den Kopf gestoßen werden. Wir haben<br />
in unserer Beratung immer wieder Jugendliche, die<br />
die Oberschule in der 11. Klasse besuchen, und die vom<br />
Jobcenter eine Aufforderung kriegen, sie sollen sich bitte<br />
eine Arbeit suchen, weil sie die Klassen ja nicht schaffen<br />
würden. Die werden unter Druck gesetzt, Eingliederungsvereinbarungen<br />
zu unterschreiben, und die Schule zu verlassen.<br />
Wenn sie damit alleine bleiben - soll ich jetzt für die<br />
Mathearbeit lernen oder soll ich die 20 Bewerbungen bis<br />
zur nächsten Woche schreiben - ?, resignieren sie häufig.<br />
Daran sehen wir einfach, dass ihnen auch in Institutionen<br />
die Perspektive verwehrt wird, die sie sich gerade erarbeiten<br />
wollen. Andere versuchen es erst gar nicht. Die haben<br />
sich in dieser Resignation eingerichtet. Wenn sie sagen:<br />
ich brauche mich nicht zu bewerben, mich nimmt doch sowieso<br />
keiner, mit dieser Haltung, ist ihnen von vornherein<br />
der Blick verstellt.<br />
Aber diese Haltung ist inzwischen weit verbreitet bei uns.<br />
Das ist eine Situation, die sich in den letzten Jahren verschärft<br />
hat. Wir arbeiten immer schon sehr niedrig schwellig<br />
mit einem ganzheitlichen Ansatz, aber wir merken, dass<br />
der Druck zugenommen hat. Hartz-IV war da die ganz<br />
große Wende, das war noch mal ein richtiger Pflock, der<br />
da eingeschlagen wurde.<br />
Theo Fontana: Wir sind uns sicher einig, dass Niedrigschwelligkeit<br />
schon immer da war, aber heute irgendwie<br />
noch größere Herausforderungen an uns bestehen. Darum<br />
geht es im ersten Impulsreferat.<br />
Claudia Grass: Ich komme vom Nachbarschaftsheim<br />
Schöneberg. Ich bin da zuständig für den Bereich Familienbildung.<br />
Geographisch gesehen liegt das Nachbarschaftsheim<br />
an der Bezirksgrenze von Schöneberg zu Steglitz, in<br />
Friedenau. Das ist klassischerweise ein Wohngebiet, wo<br />
sehr viele sogenannte Mittelschicht-Familien leben, also
ildungsnahe Menschen, die es gewöhnt sind Kurse zu<br />
besuchen. Wir haben auch ein großes Angebot an allen<br />
möglichen Kursen im Eltern-Kind-Bereich, Elternabende<br />
usw. Der Stadtteil Friedenau ist zweigeteilt - diesseits der<br />
Autobahn und jenseits der Autobahn. Jenseits gibt es einen<br />
hohen Migrantenanteil und sehr viele Menschen, die<br />
von Hartz-IV leben. Natürlich entstand auch bei uns die<br />
Frage: wie können wir auch diese Menschen erreichen, die<br />
nicht zu uns kommen?<br />
Es gibt bei uns in der Familienbildung ein Projekt, das ist<br />
vor über zehn Jahren im Rathaus Friedenau entstanden.<br />
Dort gab es leere Räume und die damalige Jugendstadträtin<br />
hatte die Idee, dass es doch toll wäre, wenn die Familien,<br />
die hier ins Rathaus kommen, irgendwo die Kinder<br />
abgeben könnten.Das NBH Schöneberg hat dieTrägerschaft<br />
übernommen, das Bezirksamt hat uns die Räume<br />
zur Verfügung gestellt, wir haben für das Personal und die<br />
Ausstattung gesorgt. So ist das Projekt entstanden, das<br />
„Frieda“ heißt.<br />
„Frieda“ wurde aber nicht so frequentiert, dass da ständig<br />
der Bär tobte. Sondern es war so, dass da zwei ABM-Leute<br />
den ganzen Tag saßen, die nicht recht wussten, was sie<br />
mit ihrer Zeit machen sollten, denn vielleicht kommt mal<br />
ein Kind, aber vielleicht kommt auch mal überhaupt keins.<br />
Dann habe ich gesagt: nee, so geht das nicht, das ist ja<br />
eine Ressourcenverschwendung ohne Ende. Aber was<br />
immer gebraucht wurde, war ein Ort, wo sich Eltern treffen<br />
konnten. In Friedenau gibt es sehr viele schöne Spielplätze,<br />
aber was ist im Winter? Es war immer der Wunsch<br />
der Eltern, einen Ort zu haben, wo sie sich eben auch bei<br />
schlechtem Wetter treffen konnten. Und zwar ohne Anmeldung<br />
wie bei einem Kurs und ohne Verpflichtung, sondern<br />
wo sie spontan hingehen können. Dann haben wir also<br />
das „Frieda“ geöffnet. Und wenn Eltern etwas auf dem Amt<br />
zu regeln haben, können sie da nach wie vor ihre Kinder<br />
abgeben, wie auf einer Art betreutem Spielplatz.<br />
Irgendwann ist daraus die Idee entstanden, dass es einen<br />
Kaffee geben soll. Die Betreuerin kocht eben eine Kanne<br />
Kaffee und die Eltern können da auch einen kriegen.<br />
Dann haben wir aber überlegt, wir könnten ja einmal in der<br />
Woche ein Frühstück anbieten. Das wurde auch sehr gut<br />
angenommen. Eine Sozialarbeiterin vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst<br />
ging von sich aus auf uns zu und<br />
fragte, wann sie zu uns kommen könnte. Ich schlug ihr das<br />
Freitagscafé vor. Sie<br />
ist einfach da und<br />
Eltern wissen, dass<br />
sie zur Beratung da<br />
ist. So ist das ganze<br />
Projekt entstanden.<br />
Es ist also nicht<br />
am Reißbrett in<br />
meinem Kopf entstanden,<br />
sondern<br />
es hat sich Schritt<br />
für Schritt aus dem entwickelt, was an Bedürfnissen kam.<br />
Mittlerweile findet das Freitagscafé – wie der Name schon<br />
sagt – jeden Freitag statt. Auch in den Ferien versuche<br />
ich immer, das durchzuziehen, weil das Problem ist, wenn<br />
Eltern es einmal geschlossen vorfinden, dann kommen<br />
sie nicht mehr. Es ist also auch eine gewisse Herausforderung,<br />
weil das nicht mit Hauptamtlichen bestückt wird,<br />
sondern immer mit irgendwelchen MAE-Kräften, ÖBS und<br />
was gerade für Programme laufen. Jetzt haben wir gerade<br />
die Kommunal-Kombi.<br />
Das Prinzip dieses Freitagscafés beruht auf Niedrigschwelligkeit<br />
und auf zwei für mich ganz wichtigen Säulen. Die<br />
eine Säule ist, dass es keinerlei Verbindlichkeit erfordert.<br />
Die Leute können kommen, sie müssen sich nicht anmelden,<br />
sie können auch nach zehn Minuten wieder gehen, sie<br />
können drei Mal kommen oder nur einmalig, sie können<br />
jede Woche kommen. Wir hatten früher bei uns im Haus an<br />
die 20 sogenannte Eltern-Kind-Gruppen. Davon gibt es heute<br />
höchstens noch zwei. Wir haben festgestellt, dass dieses<br />
Bedürfnis, sich in einer festen Gruppe zu treffen, einfach<br />
so nicht mehr besteht. Oder wenn, dann wollen die Eltern<br />
richtig eine fachliche Anleitung, also dann wollen sie einen<br />
Kurs oder PEKiP oder Eltern-Kind-Turnen usw. Aber dieses<br />
regelmäßige Treffen in einer festen Gruppe war ein Auslaufmodell.<br />
Ich denke, dass wir mit diesem Freitagscafé etwas<br />
abdecken, das den Menschen, die sich nicht verpflichten<br />
wollen, die lieber spontan entscheiden wollen, entgegenkommt.<br />
Manche verabreden sich ja auch mit anderen Eltern,<br />
es kommen übrigens auch zunehmend Väter.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 17
18<br />
Workshop Einfach gut<br />
Einfach gut<br />
Dann hat sich das weiterentwickelt. Es gab diese Sozialarbeiterin<br />
vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, die<br />
einmal im Monat gekommen ist, das war ein fester Freitag.<br />
Dann überlegte ich, dass es doch gut wäre, wenn da eine<br />
Ansprechperson von der Erziehungsberatung wäre. Vor<br />
Jahren hatte ich schon mal Kontakt mit der Erziehungsberatung<br />
vom Bezirk aufgenommen und angefragt, ob sie<br />
sich vorstellen könnten, bei uns im Nachbarschaftsheim<br />
regelmäßig eine Beratung anzubieten. Damals haben<br />
die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, um<br />
Gottes Willen, wir werden ja sowieso schon überrannt, wir<br />
können das gar nicht alles, also da war nichts zu machen.<br />
Aber jetzt auf einmal ging es. Solche Kooperationen sind<br />
offenbar sehr personenabhängig. Es gab eine Mitarbeiterin<br />
dort, die das Modell toll fand und es machen wollte. Sie<br />
hat das dann mit ihrer Vorgesetzten gesprochen, dann war<br />
das in Ordnung. Einmal im Monat – jeden ersten Freitag<br />
– ist sie da. Sie ist einfach nur da. Sie drängt niemandem<br />
ein Gespräch auf, sie will auch niemand beraten, der nicht<br />
beraten werden will. Die Leute wissen, dass sie da ist, das<br />
wird ausgehängt. Was an diesem Konzept wichtig ist, das<br />
ist die Regelmäßigkeit. Dass die Eltern verlässlich wissen,<br />
dass es regelmäßig stattfindet.<br />
Dann haben wir es noch erweitert. Einmal im Monat gibt<br />
es ein sogenanntes Expertengespräch, also immer am<br />
letzten Freitag im<br />
Monat kommt irgendjemand,<br />
der<br />
ein gesundheitsoder<br />
erziehungsrelevantes<br />
Thema<br />
bespricht. Das<br />
kann Erste Hilfe am<br />
Kind sein, gesunde<br />
Ernährung, Bewegungsentwicklung<br />
oder „Kreatives Kinderzimmer“, da hatten wir eine Architektin,<br />
wir haben alles Mögliche im Angebot. Diese Experten<br />
sind bei dem Freitagscafé einfach da. Je nachdem, wie<br />
voll es dann ist, und ob es überhaupt geht, sagen sie ein<br />
paar Sätze, machen also einen kurzen Input. Dann stellen<br />
die Eltern Fragen und die Experten beantworten die. Das<br />
ist natürlich sehr, sehr wuselig. Da sind zum Teil 20 Elternteile<br />
mit ihren Kindern, real also 40 Personen, da geht<br />
schon was ab. So wie wir jetzt reden, das wäre dort völlig<br />
unmöglich. Aber trotzdem denke ich, es ist eine Möglichkeit,<br />
denn ins Elterncafé kommen tatsächlich auch Eltern,<br />
die sonst eben zu irgendwelchen anderen Gruppen oder<br />
Kursen überhaupt nicht kommen würden.<br />
Was ich als unheimlich positiv empfinde, das ist eben die<br />
Kooperation mit den verschiedenen Ämtern, einmal dem<br />
Gesundheitsamt über diese Sozialarbeiterin, mit dem<br />
Jugendamt, das ist die Diplompädagogin von der Erziehungsberatungsstelle.<br />
Das erweist sich als sehr effizient,<br />
weil z.B. auch die Sozialarbeiterin vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst<br />
ihre Hausbesuche ins Café bestellt. Für<br />
viele Eltern ist das immer noch so: Amt, was wollen die<br />
von mir? Die Sozialarbeiterin schreibt alle an, die ein Kind<br />
kriegen, alle Eltern werden angeschrieben und bekommen<br />
ein bestimmtes Informationsmaterial, und es liegt in dem<br />
Brief auch immer ein Flyer von dem Freitagscafé mit drin.<br />
Mitarbeiter der Ämter nutzen das Café also auch für sich<br />
als Möglichkeit, mit Eltern ins Gespräch zu kommen, Eltern<br />
miteinander ins Gespräch zu bringen.<br />
Es gibt dann ein Frühstücksbuffet, das kostet 2 Euro, was<br />
nun auch nicht die Welt ist. Wenn jemand keine 2 Euro<br />
hat, dann ist niemand weggeschickt worden und hat trotzdem<br />
was zu essen gekriegt. Das ist natürlich kein Super-5-<br />
Sterne-Gourmet-Frühstück mit Lachs, aber es gibt immer<br />
alles, es gibt Brötchen, Belag, was Frisches, Kaffee und<br />
Tee.<br />
Das ist das Konzept von dem Frieda-Freitagscafé. Wir haben<br />
dieses Konzept in abgewandelter Form noch an zwei<br />
anderen Standorten, einmal in dem Jugend- und Familienzentrum<br />
in der Jeverstraße. Da ist es immer montags und<br />
Mittwochnachmittag bei uns in der Holsteinischen Straße.<br />
Da ist es auch ein kleines Café, das täglich von 11 bis 20<br />
Uhr geöffnet ist, und Mittwochnachmittag findet da eben<br />
auch ein Elterncafé statt.<br />
Wir haben festgestellt, dass das Frieda-Freitagscafé mit<br />
Abstand am allerbesten läuft. Ich führe das darauf zurück,<br />
dass diese Räume – es sind zwei wirklich sehr, sehr große<br />
Räume – am angenehmsten sind, weil sich die Kinder da<br />
bewegen können. Diese Räume sind mit Teppichboden
ausgelegt, aber sie dürfen nicht mit Schuhen begangen<br />
werden. Da sind sehr viele Eltern mit ganz kleinen Kindern,<br />
die können sie da einfach rumkrabbeln lassen. Es ist<br />
sehr zentral gelegen, das spielt auch eine wichtige Rolle,<br />
also man kann es sehr gut erreichen.<br />
Wichtig ist auch, dass so ein Ort mit seinen besonderen<br />
Angeboten bekannt gemacht werden muss. Wir treffen immer<br />
wieder Leute, die sagen: ach, das wussten wir ja gar<br />
nicht, ach, das gibt es hier. Wir müssen also immer wieder<br />
kreativ werden, wie wir das an die Frau und an den Mann<br />
bringen können, was wir da machen.<br />
Theo Fontana: Es ist eigentlich nicht überraschend, dass<br />
gerade solche niedrig schwelligen Angebote step by step<br />
entstehen. Ich denke, das hängt irgendwie miteinander<br />
zusammen. Gibt es ähnliche Projekte und vielleicht Fragen<br />
oder Ergänzungen, um das von verschiedenen Seiten<br />
zu beleuchten?<br />
TN: Unser Café hat sich in der Zwischenzeit so entwickelt,<br />
dass ich straffällig gewordene Jugendliche nachmittags<br />
betreue, die da ein bisschen abwaschen und sauber machen<br />
müssen und/oder – je nachdem, wie sie bei den<br />
Kindern ankommen – mit den Kindern spielen. Wir haben<br />
drei Räume: unten das Café, ein paar Stufen höher<br />
zwei Räume, einen Seminarraum und einen Kuschelraum.<br />
Über ein Jahr habe ich eine Schülerpraktikantin, die jeden<br />
Dienstag kommt und mit den Kindern ein bisschen<br />
bastelt und malt. Je nachdem, wie viele Kinder gerade da<br />
sind und wozu die Kinder Lust haben, das entscheiden sie<br />
selbst, was sie machen wollen. Sie dürfen aber auch Höhlen<br />
bauen und toben.<br />
Unten ist ein regelrechtes Café draus geworden, zu Anfang<br />
gab es immer noch selbstgebackenen Kuchen von mir,<br />
aber jetzt ist dafür keine Zeit mehr, jetzt gibt es den Tiefgefrorenen.<br />
Sie kaufen bei mir Kaffee und Kuchen, aber zu<br />
Einkaufspreisen. Eigentlich hat sich das Café selbst entwickelt,<br />
wir machen um 15 Uhr auf, ab 16 Uhr dürfen die<br />
Kinder Süßigkeiten kaufen.<br />
Ich habe im Durchschnitt 40 Personen jeden Dienstag da.<br />
Die Eltern sind meistens Mütter, aber es kommen auch<br />
drei oder vier Väter. Die erkundigen sich schon von sich<br />
aus, wo kann ich zur homöopathischen Früherziehung, wo<br />
ist Eltern-Kind-Turnen oder fragen nach Eltern-Trainingskursen,<br />
die ich auch anbiete. Manchmal kommen Fragen,<br />
die man diskutieren kann, manchmal auch nicht. Wenn<br />
die Eltern wollen, lade ich auch jemand von irgendeiner<br />
Beratungsstelle ein. Wir hatten schon mal die Schuldner-<br />
Beratung da für allgemeine Fragen zur Schuldenfalle.<br />
Manche sagen skeptisch: hä, da gibt es ein Eltern-Kind-<br />
Café, das habe ich ja noch nie gesehen.<br />
Theo Fontana: Wie ist das mit den Müttern und Vätern?<br />
Kommen Väter?<br />
Claudia Grass: Es sind auf jeden Fall mehr Mütter, aber<br />
ich habe schon den Eindruck, dass – seit es die Elternzeit<br />
gibt – oft mehr Väter kommen. Das liegt aber natürlich<br />
auch an der Zeit, vormittags von 10 bis 12 Uhr, da können<br />
ja nur diejenigen, die in der Elternzeit sind. Nachmittags,<br />
wenn der Indoor-Spielplatz bis 18 Uhr geöffnet ist, kommen<br />
durchaus öfter mal Väter mit ihren Kindern. Aber in<br />
dem Freitagscafé sind höchstens 10 bis 20 % Väter.<br />
TN: Ich baue gerade für den Malteser-Hilfsdienst ein Familienzentrum<br />
als Nachbarschaftszentrum in Neukölln auf.<br />
Meine Frage: Wie haben Sie die Eltern erreicht?<br />
Claudia Grass: Die meisten Eltern fragen unsere MAE-Frau<br />
nicht, was sie macht, sondern sie ist da und sie weist die<br />
Eltern ein. Das heißt, die Eltern kommen rein, sie begrüßt<br />
sie und sagt, guten Tag, Sie wollen zu unserem Elterncafé.<br />
Wenn die Eltern noch nie da waren, erklärt sie die Regeln,<br />
nämlich, dass sie die Schuhe bitte ausziehen sollen, wo<br />
sie den Kinderwagen hinstellen können, dass sie den bitte<br />
abschließen, weil auch schon welche geklaut wurden. Solche<br />
Sachen erklärt sie. Dann hat sie ihr Frühstücksbuffet,<br />
also die Eltern wollen von der in dem Sinne gar nichts.<br />
Es ist ja so, dass jeden Freitag eine kompetente Person<br />
da ist, entweder die Sozialarbeiterin vom Kinder- und Jugendgesundheitsdienst<br />
oder die Diplompädagogin von der<br />
Erziehungsberatung.<br />
Ich habe auch fast regelmäßig Praktikantinnen von den<br />
Fachhochschulen. Denen lege ich es immer nahe, da<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 19
20<br />
Workshop Einfach gut<br />
Einfach gut<br />
freitags hinzugehen, weil sehr viel von dem, was ich mache,<br />
ist koordinierende und organisatorische Tätigkeit, Gremienarbeit<br />
usw. ist, während das Freitagscafé was richtig<br />
Anschauliches ist. Da sind die Praktikantinnen auch total<br />
scharf drauf, weil sie da endlich die Eltern mitkriegen und<br />
welche Fragen sie haben. Ich möchte dann einen kleinen<br />
Bericht von den Praktikantinnen, sie sollen ihren Besuch<br />
dokumentieren. Das ist für mich auch gut, weil ich da nicht<br />
jeden Freitag hingehen kann, das kriege ich zeitlich einfach<br />
nicht hin. Aber ich habe damit ein Feedback und Eindrücke<br />
darüber, welche Themen anstanden.<br />
Die Sozialarbeiterin vom Gesundheitsdienst und die Erziehungsberaterin<br />
sind konstante Personen, also es entsteht<br />
dann schon – was auch absolut notwendig ist – ein<br />
Vertrauensverhältnis. Die MAE-Kraft deckt quasi nur den<br />
äußeren Rahmen ab. Sie ist nicht als Ansprechperson für<br />
inhaltliche Fragen da.<br />
TN: Wie erreicht ihr die Eltern?<br />
Claudia Grass: Entweder über unser Programmheft, das<br />
hat eine Auflage von ca. 14.000 Stück. Dann natürlich<br />
über unsere Stadtteil-Medien, über die Sozialarbeiterin<br />
vom Kinder- und Jugend-Gesundheitsdienst, die neuen Eltern<br />
die Infobroschüre und unser Angebot fürs Freitagscafé<br />
schickt. Ganz viel kommt auch über Mundpropaganda,<br />
das ist ein ganz wichtiges Medium. Natürlich auch über<br />
Gremienarbeit, ich sitze in diversen Gremien, vor allem,<br />
wenn die lokal organisiert sind, verschiedene Fachgruppen,<br />
da gebe ich das Angebot auch weiter. Ich gebe auch<br />
Informationen ins Jugendamt, viele kennen das Frieda-<br />
Projekt noch nicht. Man denkt immer, die wissen alle davon,<br />
aber das ist nicht so.<br />
TN: Ich komme vom Familienzentrum „Tausendfüßler“ in Kaltenkirchen,<br />
das ist in Schleswig-Holstein. Wir sind seit sechs<br />
Jahren Familienzentrum mit Kindertagesstätte und seit zwei<br />
Jahren Mehrgenerationenhaus. Ich kann bestätigen, dass<br />
sich unsere Niedrigschwelligkeit auch nach und nach ergeben<br />
hat, sie ist mit der konkreten Nachfrage gewachsen.<br />
Mit der Eröffnung der Kita haben wir einen Bereich mit<br />
Elterncafé eingerichtet. Morgens, wenn die Eltern kamen<br />
und die Kinder gebracht haben, hatten sie die Möglichkeit,<br />
Kaffee und Tee zu trinken, so um 9 Uhr. Das hat sich dann<br />
ausgeweitet, dass wir ein Eltern-Frühstück angeboten haben,<br />
was sehr erfolgreich angenommen wurde. Zunächst<br />
ist das nie begleitet worden, aber wir haben das Prinzip<br />
der offenen Bürotüren, also jederzeit kann jemand zur<br />
Kita-Leitung kommen, wir lassen Störung gerne zu. Das<br />
bringt natürlich mit sich, dass wir unsere Arbeit nicht geschafft<br />
haben. Es fängt immer mit der Frage an: Ich habe<br />
da mal eine Frage, meine Nachbarin, meine Freundin, die<br />
hat das Problem … Wir haben die Menschen dann soweit<br />
begleitet, dass sie Antworten nicht mehr unbedingt von<br />
uns brauchten, sondern auch zu einer Fachberatung gehen<br />
konnten.<br />
Nach und nach haben wir - auch durch das Mehrgenerationenhaus<br />
- dieses Angebot erweitern können. Wir haben<br />
nachmittags das Café, wo Menschen aller Altersklassen<br />
kommen können, von 0 bis 99. Das Elternfrühstück haben<br />
wir ausgeweitet, es wird zwei Mal im Monat von einer<br />
Kinder- und Jugendärztin begleitet, die einfach da ist,<br />
aber später auch Fachvorträge anbieten kann oder kleine<br />
Seminare, wenn das gewünscht wird. Sie hat auch einen<br />
Kummerkasten, die Eltern können da Briefe einwerfen<br />
und sie steht dann auch für persönliche Einzelgespräche<br />
zur Verfügung.<br />
Nächster Schritt ist, dass die Erziehungs- und Lebensberatung,<br />
die es bei uns im Ort gibt, auch für einen Tag zu<br />
uns ins Haus kommt. Angehörige der Mittelschicht gehen<br />
dort hin, wenn sie Probleme haben. Aber die Familien,<br />
die es tatsächlich benötigen, die trauen sich nicht<br />
hin. Elternberatung, Erziehungsberatung, dann kommt<br />
womöglich als nächstes vom Jugendamt ein Fürsorger.<br />
Die sind dann bei uns im Haus und stellen sich auch<br />
beim Elternfrühstück vor, das ist also niedrig schwellig,<br />
da können Eltern ins nächste Büro reingehen, ohne dass<br />
es auffällt. So entwickeln wir step by step. Wir möchten<br />
gerne eine Familien-Hebamme ins Haus holen, wir<br />
haben mittlerweile auch eine Beratung für Senioren<br />
und für deren Angehörige. Wir holen das alles ins Haus,<br />
anstatt sie zu externen Beratungen zu schicken, wo sie<br />
eine erhebliche Angstschwelle überwinden müssten, da<br />
hinzugehen.
TN: Das sind ja genau die Eltern, die man erreichen muss.<br />
Denn im Umgang der Eltern mit ihren Kindern liegt ja sehr<br />
viel im Argen. Wie erreicht man, dass der Umgang mit den<br />
Kindern sinnvoller wird?<br />
Claudia Grass: Die Eltern, die zu uns kommen, kommen<br />
mit ihren eigenen Kindern. Eltern sehen natürlich auch,<br />
wie andere mit ihren Kindern umgehen. Dieses Hinsehen<br />
ist ein wichtiger Lernfaktor, den darf man nicht vernachlässigen.<br />
Lernen geschieht, ohne dass man Eltern Vorschriften<br />
über das macht, was man nicht darf.<br />
TN: Ich komme vom Nachbarschaftszentrum „Bürger für<br />
Bürger“ aus Berlin-Mitte. Unser Projekt hat einen ganz interessanten<br />
Standort, ich bin genau zwischen zwei Sozialräumen.<br />
Links von mir ist der Wedding mit einer ähnlichen<br />
Problematik wie in Kreuzberg oder Neukölln. Rechts von<br />
mir ist Alt-Mitte, was in den letzten Jahren durch Sanierungsmaßnahmen<br />
zunehmend ein voller Sozialraum geworden<br />
ist, wo viele junge Familien wohnen. Auch von der<br />
Einkommenslage her treffen da manchmal zwei Welten<br />
aufeinander.<br />
Bei dem niedrig schwelligen Angebot Mutter-Kind-Gruppe<br />
habe ich bisher dieses Jahr überwiegend studierte Mütter<br />
gehabt, die mit ihren Kindern bis ca. 2 Jahre kommen.<br />
Das hat sehr gut funktioniert, weil die gerne so einen Treff<br />
haben wollten, wo sie sich austauschen und gegenseitig<br />
helfen können. Dann haben wir noch einen anderen in<br />
Angriff genommen. Wir haben unter anderem ein Angebot<br />
für Nachhilfeunterricht für Schüler, davon haben inzwischen<br />
95 % einen Migrationshintergrund. Die Eltern,<br />
deren Kinder zu uns kommen, haben überwiegend ein<br />
großes Interesse daran, dass ihre Kinder alle Chancen<br />
haben. Die meisten kümmern sich sehr engagiert. Sie<br />
versuchen ihre Kinder nach Mitte in die Schule zu kriegen,<br />
weil sie eben nicht möchten, dass die Kinder mit 90<br />
oder 95 % Anteil Kindern nichtdeutscher Herkunft in eine<br />
Klasse gehen. Wir wollen jetzt ein Angebot entwickeln, wo<br />
Eltern und ihre Kinder am Nachmittag einmal pro Woche<br />
zum gemeinsamen Spielen kommen können. Gibt es dazu<br />
schon Erfahrungen in der Altersgruppe der Schulkinder?<br />
Denn wir haben bemerkt, dass Eltern trotz allem ihre Kinder<br />
vor dem Fernseher parken. Die Kinder lesen kaum<br />
zu Hause, die spielen kaum was miteinander, die singen<br />
nicht. Deshalb denken wir, dass da ein Bedarf ist.<br />
Claudia Grass: Wir haben ja auch einen sehr großen Kinder-<br />
und Jugendbereich. Ich weiß, dass es in einzelnen<br />
Schulen mit Ganztagsbetreuung solch ein Angebot gibt.<br />
Es gibt ja auch dieses Projekt FuN, Familie und Nachbarschaft,<br />
das geht in diese Richtung. Da geht es auch darum,<br />
dass Spieleinheiten angeboten werden, weil es auch<br />
stimmt, dass Eltern und Kinder wieder miteinander spielen<br />
lernen müssen.<br />
Meine Frage dabei ist immer: Ja, kommen die dann? Wie<br />
muss man das verpacken, wie muss das Schleifchen aussehen,<br />
damit sie auch wirklich kommen? Wenn man jetzt<br />
ausschreibt, dass Eltern mit ihren Kindern zum Spielen<br />
kommen können, da wüsste ich nicht, ob sich die Eltern<br />
davon angesprochen fühlen oder nicht. Wir Sozialpädagogen<br />
denken, das ist ein offensichtlicher Bedarf, aber diejenigen,<br />
die den Bedarf haben, die wissen manchmal gar<br />
nicht, dass sie diesen Bedarf haben.<br />
TN: Die meisten Leute, die zu uns kommen, planen ihre<br />
Zeit nicht besonders, d.h., sie kommen spontan. Das erfordert<br />
von uns Offenheit für diese Spontanität. Wenn wir mal<br />
an bestimmten Tagen sagen, dass wir heute über was informieren,<br />
dann kommen genau die Eltern, die es betrifft.<br />
Das Angebot muss aber mit ihnen gemeinsam entwickelt<br />
werden. Man hört sich um, wo Eltern Bedenken haben,<br />
was sie nicht wissen, worauf sie achten sollten. Ihre Belange<br />
müssen aufgegriffen werden. Das ist kein Programm,<br />
das ich ein halbes Jahr vorher schaffen könnte und einen<br />
Referenten schon lange vorher organisiere. Wenn ein Bedürfnis<br />
da ist, muss es relativ schnell umgesetzt werden,<br />
d.h. ich habe maximal ein bis zwei Wochen Vorlauf. Da<br />
machen wir bestenfalls einen Flyer, damit auch noch drei<br />
andere aus der nächsten Umgebung davon erfahren.<br />
Eine andere Sache ist die Teilnahme von Eltern an unseren<br />
Unternehmungen. Wenn Feste sind, wenn wir einen<br />
Ausflug machen, dürfen Eltern mitkommen, weil die Eltern<br />
bestimmte Erfahrungen genauso wenig wie die Kinder haben.<br />
Wir planen keinen Eltern-Kind-Ausflug, sondern die<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 21
22<br />
Workshop Einfach gut<br />
Einfach gut<br />
Mutter von einem Kind hat spontan Lust mitzukommen.<br />
Wenn ein Platz frei ist, kann sie kommen. Sie riskiert es<br />
also auch, dass sie dann nicht mitgenommen wird. Wenn<br />
wir für die Kita einen Bus gebucht haben, wenn die Schularbeitsgruppe<br />
in den Ferien ins Museum geht und in die<br />
Führung passen nur 20 Leute, dann können eben nicht<br />
15 Eltern mit, sondern nur die, die einen freien Platz bekommen.<br />
Das Niedrigschwellige bringt es mit sich, zunächst mit dieser<br />
Flexibilität umzugehen, um allmählich dahin zu kommen:<br />
wir müssten uns mal verabreden. Oder dass ich sagen<br />
kann: am Freitag habe ich genug Helfer da, es macht<br />
jetzt einer der Erzieher die Betreuung der Schularbeitshilfe,<br />
da habe ich Zeit, mit euch zu sitzen. So stellen sich<br />
Kontakte leicht her, aber nicht auf der Ebene von Verbindlichkeit<br />
mit festem Programm. Über die Flexibilität kommt<br />
mit der Zeit eine Kontinuität da rein.<br />
TN: Wir sind eine pädagogische Einrichtung am Kotti. Wir<br />
machen einmal im Monat Lesen und eine Spielstraße. Wir<br />
haben festgestellt, dass wir das nur in den Wintermonaten<br />
machen können, weil in den Sommermonaten keiner<br />
kommt. Während es in den Wintermonaten sehr gut angenommen<br />
wird. Wir arbeiten mit der Bücherei am Kottbusser<br />
Tor zusammen. Die stellen uns Bücher und die<br />
Materialien zur Verfügung. Nächste Woche haben wir Märchentage<br />
und wir machen einen Teil davon, für Kinder aus<br />
der Umgebung. Wir<br />
arbeiten auch mit<br />
den Schulen. Leute<br />
von uns machen in<br />
der Jens-Nydahl-<br />
Grundschule die<br />
Schulstation, in der<br />
Nürtingen-Grundschule<br />
haben wir<br />
das Schülerhaus,<br />
mit dem wir kooperieren.<br />
Die stellen die Spiele zur Verfügung, die man<br />
ausprobieren kann. Natürlich kommen mehr Schüler als<br />
Eltern, das ist klar, aber auf diese Weise erreichen wir<br />
auch Eltern.<br />
Im Frühjahr ist dann hierfür kaum ein Bedarf vorhanden,<br />
so dass wir diese Angebote einfach eingestellt haben. Aber<br />
diese Kooperationen mit der Bücherei und mit den Schulstationen<br />
funktionieren gut und sind auch erfolgreich.<br />
TN: Sie sagten, dass Sie Kindern die Teilnahme an einem<br />
Museumsbesuch oder an Ausflügen ermöglichen und stellen<br />
Eltern, die selber so was noch nie gesehen haben, frei,<br />
dass sie auch mitgehen. Ich finde es ganz wichtig, dass<br />
auch Eltern einen Bezug dazu bekommen. Und der Bedarf<br />
ist da.<br />
TN: In ein Museum zu gehen, das kostet aber Geld. Ich<br />
bin mit den Kindern immer im Dahlemer Museum gewesen,<br />
mindestens einmal im Monat. Das kann ich mir gar<br />
nicht mehr leisten, weil die Eintrittspreise so hoch sind. In<br />
Amerika ist es selbstverständlich, dass Familien einfach<br />
ins Museum reingehen, da wird kein Geld genommen. Und<br />
hier ist es üblich, dass immer bezahlt wird. In den Sommermonaten<br />
können die Familien ohne Geld gar nichts<br />
unternehmen.<br />
TN: Ich habe Sponsoren gefunden, die es in den letzten<br />
drei Jahren erreicht haben, dass der Museumsbesuch für<br />
Kinder unter 18 Jahren frei ist. Da Bildung in aller Munde<br />
ist, muss man einfach einen Vorstoß machen, um solche<br />
Dinge gemeinsam mit Sponsoren oder der Stadt zu bewerkstelligen.<br />
Und Donnerstags haben die meisten Städtischen<br />
Museen in Berlin von 18 bis 22 Uhr freien Eintritt.<br />
TN: Es hat sich bei unserem Nachbarschaftshaus bewährt,<br />
dass wir einen großen Garten haben. Da haben<br />
wir ein Schwimmbecken für die Kinder, da kommen auch<br />
spontan Leute mit ihren Kindern, wenn sie gerade vorbeigehen.<br />
Das ist aber wirklich ein Angebot für Familien, nicht<br />
für einzelne Kinder. Dadurch schließen wir manche Kinder<br />
aus, aber wir erreichen die Familien.<br />
Wichtig ist aber auch das Rausgehen aus dem Familienzentrum.<br />
Wir gehen einmal in der Woche in die Turnhalle<br />
und machen Familiensport, weil es keinen Familiensport<br />
für 1 ½-Jährige bis 4-Jährige gibt. Aber wir wollen eben<br />
gesunde Aktivitäten von Anfang an. Die Kinder fordern
das ein und die Eltern machen nach und nach auch mit.<br />
Weil auch da gilt, nur im Familienverbund gehen wir in die<br />
Turnhalle. Wir fahren mit den Familien weg. In der letzten<br />
Stadtteilkonferenz haben wir über den Bürgerhaushalt<br />
ein Projekt Familienhilfe geschaffen, da kriegen Familien<br />
eine Fahrradwerkstatt. Also wenn wir das Geld für eine Familienferienfahrt<br />
nicht zusammenkriegen, bieten wir die<br />
Fahrräder an, damit die Eltern das Grundstück verlassen<br />
und gucken können, was im Umfeld ist. So schaffen wir<br />
den Zugang für Mütter und Väter.<br />
Theo Fontana: Wir kommen jetzt zum nächsten Impulsreferat,<br />
zu dem Projekt Stadtteilmütter in Berlin-Neukölln.<br />
Dorothee Peter: Ich bin eine der Koordinatoren von dem<br />
Stadtteil e.V. Insgesamt sind wir sechs Koordinatorinnen.<br />
Die Stadtteilmütter starteten 2004 als kleines Projekt im<br />
Schillerkiez in Neukölln, mit unserer Projektleitung. Es<br />
wurden drei Kurse angeboten, zwei türkischsprachige Kurse,<br />
den dritten Kurs deutschsprachig. Das Projekt wurde<br />
evaluiert und parallel wurden Befragungen in den Kitas<br />
und Schulen duchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass<br />
50 % der Migrantenkinder unter 6 Jahren in Neukölln nicht<br />
in die Kita gehen, d.h. 50 % der Kinder unter 6 Jahren<br />
waren zu Hause.<br />
Parallel wurden zahlreiche Defizite festgestellt in Familien<br />
mit Migrationshintergrund, das heißt, Sprachdefizite, gerade<br />
in den türkisch- und arabischsprachigen Familien.<br />
Es begann als Pilotprojekt und im September 2006 ist<br />
das Projekt in die Modellphase gegangen. Das heißt, wir<br />
wurden angestellt, drei arabischsprachige und drei türkischsprachige<br />
Koordinatorinnen, wovon eine wieder ausgeschieden<br />
ist. Wir wurden dann in die Quartiersgebiete<br />
eingeteilt, ich bin für den Körnerpark zuständig und für<br />
das Rollbergviertel.<br />
Es gibt die Sprachschwierigkeiten der Kinder und eben<br />
die Überforderung der Eltern. Im Schillerkiez war der erste<br />
Kurs zur Ausbildung von Stadtteilmüttern so angelegt,<br />
dass gerade Mütter an diesem Kurs teilgenommen haben,<br />
die weniger als fünf Jahre in Deutschland leben, daher<br />
fast nur türkisch sprachen.<br />
Das Vorbild für unser Projekt kam aus Rotterdam. Wir haben<br />
es abgewandelt für die Arbeit mit Müttern. Die Kinder<br />
sind gar nicht mit dabei, sondern die Mütter sollen ohne<br />
die Kinder erreicht werden. Ich habe jetzt zwei Kurse gemacht,<br />
betreue insgesamt 19 Frauen. Insgesamt haben<br />
wir 140 Stadtteilmütter für die neun Quartiersgebiete ausgebildet.<br />
93 von ihnen sind in einer ÖBS-Maßnahme 30<br />
Stunden lang beschäftigt. 40 dieser 140 Mütter arbeiten<br />
auf Honorarbasis.<br />
Diese Stadtteilmütter wurden erst einmal zusammengesucht.<br />
Jede Koordinatorin war in ihrem eigenen Quartiersgebiet<br />
dafür zuständig, dass sie bestimmte Frauen akquiriert.<br />
Ich bin in die Kitas und Schulen gegangen, überall<br />
dorthin, wo sich Frauen treffen, Frauenfrühstück, auch in<br />
die Beratungsstellen, habe in Wartezimmern Platz genommen,<br />
geguckt, wo es Schulstationen gibt, um herauszufinden,<br />
wo die Mütter überhaupt sind. Es mussten Frauen<br />
sein, zu 80 % türkisch-arabischsprachig, weil das Projekt<br />
so angelegt war, bis 20 % durften es Frauen mit einem<br />
anderen Migrationshintergrund sein, d.h. auch polnische,<br />
russische, tamilische Frauen. Wir durften ausnahmsweise<br />
auch deutsche Mütter zu den Kursen einladen, aber nur,<br />
wenn sie noch mit einem Fuß in einer arabisch-türkischen<br />
Migrantenfamilie sind.<br />
Wir konzentrieren uns auf arabische und türkische Familien,<br />
deren Problematik war ja vor einigen Jahren in den<br />
Medien. Gewalt hat eine große Rolle gespielt, Sprachdefizite<br />
usw., die Kinder kommen in die Schule und können<br />
kein Deutsch. Das war mitunter ein Grund für die Senatsverwaltung,<br />
das Bezirksamt und für das Jobcenter Neukölln<br />
mit der Diakonie Oberspree-Neukölln, wo ich auch<br />
angestellt bin, wir sind die Träger, in Kooperation zu gehen<br />
und dieses Projekt als Pilotprojekt zu starten.<br />
Es ging zunächst darum, geeignete Mütter zu finden. Es<br />
müssen Mütter sein, weil „Stadtteilmütter“ nun mal der<br />
Oberbegriff ist. Es gab natürlich sehr viele Anfragen von<br />
Frauen, die auch Deutschkenntnisse und teilweise auch<br />
eine gute Schulbildung hatten, die auch hier aufgewachsen<br />
sind, aber unser Konzept war, dass es Mütter sein<br />
mussten, die zum größten Teil arbeitslos sein oder arbeitslos<br />
gemeldet sein mussten, weil sie sonst nicht in diese<br />
ÖSB-Maßnahme gepasst hätten. Alle anderen, wo der<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 23
24<br />
Workshop Einfach gut<br />
Einfach gut<br />
Ehemann arbeitet und sie auch in Teilzeitbeschäftigung<br />
ist, dürfen als Honorarkräfte arbeiten. Das heißt, nach der<br />
Ausbildung zu Stadtteilmüttern dürfen sie zu einer Mutter<br />
gehen, die ein Kind unter 6 Jahren hat. Das heißt, sie haben<br />
bestimmte Grenzen einzuhalten.<br />
Das Konzept ist so angelegt: Migrationshintergrund muss<br />
gegeben sein, die Familien, die aufgesucht werden, müssen<br />
mindestens ein Kind zwischen 0 und 6 Jahren haben.<br />
Die dritte Bedingung ist, sie muss in den Quartiersgebieten<br />
wohnen, wo die Stadtteilmutter tätig ist.<br />
Das wird sich nächstes Jahr vermutlich ändern, wir warten<br />
noch drauf. Ganz wichtig ist auch, die Stadtteilmütter sind<br />
sechs Monate lang von ihrer jeweiligen Koordinatorin qualifiziert<br />
worden, also ich habe, wie gesagt, zwei Durchläufe<br />
gemacht, 2006 und 2007. Das hat ein halbes Jahr gedauert,<br />
zwei Mal in der Woche, je vier Stunden, dienstags und<br />
donnerstags, im Nachbarschaftsheim Neukölln.<br />
Dort haben wir die Ausbildung gemacht, parallel dazu haben<br />
wir Referenten und Experten eingeladen, haben die<br />
vernetzt mit den Schulen und Kitas, aber natürlich auch<br />
mit dem Kinderschutzbund, mit der Suchtberatungsstelle<br />
und auch mit Wildwasser, weil auch Missbrauch an Mädchen<br />
ein Problem ist. Wir arbeiten eng zusammen mit der<br />
Integrationsbeauftragten, mit der Gleichstellungsbeauftragten,<br />
mit Behindertenbeauftragten, also wir sind mit<br />
diversen Institutionen und Vereinen vernetzt. Jede Koordinatorin<br />
für sich muss dafür sorgen, dass sie mit dem<br />
eigenen Quartiersmanagement vernetzt ist und mit allen<br />
Institutionen, die es dort gibt. Wo gibt es Hausaufgabenhilfe?<br />
Wo gibt es Beratungsstellen? Wo findet die Familie<br />
das, wofür sie Bedarf hat? Das kann natürlich auch ein<br />
Angebot für kostenlosen Musikunterricht sein.<br />
Wir wollen gerade an die Familien rankommen, die eben<br />
nicht aus der Mittelschicht sind. Vornehmlich ist es so,<br />
dass die Stadtteilmütter selber nicht aus der Mittelschicht<br />
kommen, zum größten Teil sind die Frauen Heirats-Migrantinnen.<br />
Natürlich haben wir auch welche, die hier geboren<br />
sind, Kopftuchträgerinnen, oder eben angereist sind aus<br />
anderen Ländern, aus den verschiedensten Situationen<br />
heraus. Das heißt, für die ÖBS-Maßnahme musste der erste<br />
Arbeitsmarkt verwehrt sein, sonst hätten sie gar nicht<br />
in das Programm gekonnt.<br />
Wir hatten anfangs150 Frauen. Einige Stadtteilmütter sind<br />
uns – Gott sei Dank – verloren gegangen, weil sie Arbeit in<br />
ihren alten Berufen gefunden haben. Das freut uns natürlich.<br />
Jede Stadtteilmutter, die bei uns bleibt, das freut uns<br />
natürlich auch, weil sie 30 Stunden lang als Stadtteilmutter<br />
arbeitet und versucht, die Familien zu erreichen, die<br />
nirgends hingehen, auch nicht zu einer Beratungsstelle.<br />
Wir gehen zu diesen Frauen.<br />
Die Stadtteilmütter arbeiten genauso wie ich auch gearbeitet<br />
habe, um die Frauen selber zu finden. Sie gehen überall<br />
hin, auch ins Nachbarschaftsheim, da war ich auch und<br />
habe dort Stadtteilmütter gefunden, die ich dann ausgebildet<br />
habe. Nachdem die Stadtteilmütter dann ausgebildet<br />
worden waren, haben die genau dasselbe gemacht wie<br />
zuvor ich. Sie gehen jetzt auch in die Kitas, in die Frauengruppen,<br />
die es überall gibt, sie gehen aber auch auf Spielplätze,<br />
zum Kinderarzt, zum Frauenarzt, sie gehen überall<br />
hin, auch ins Einkaufszentrum. Sie arbeiten auch eng mit<br />
unserer Bücherei zusammen, gehen öfter mal dahin, gucken,<br />
ob sie da Mütter treffen und sprechen sie an. Sie<br />
müssen natürlich abfragen, wo sie wohnt, um zu sehen, ob<br />
sie überhaupt infrage kommt. Dann müssen wir natürlich<br />
auch abfragen, ob sie ein Kind zwischen 0 und 6 Jahren<br />
hat. Wir nehmen auch an allen Festen im Kiez teil, so was<br />
wie 48-Stunden-Neukölln, machen unsere eigenen Kiezfeste<br />
natürlich. Bei allem was es gibt, sind wir präsent.<br />
Die Stadtteilmütter haben immer einen Stand mit ihren Flyern,<br />
im besten Fall haben wir auch türkische Spezialitäten,<br />
bieten auch Spiele für die Kinder an, damit die Mütter stehen<br />
bleiben, sprechen sie an. Die Stadtteilmütter haben<br />
ihren roten Schal an, ihre Tasche mit dem Stadtteilmütter-Logo<br />
drauf, sie gehen durch die Straßen und werben<br />
dafür, dass sie mit Informationen zur Verfügung stehen.<br />
In der Ausbildung gab es zehn Themen, zum Beispiel gesunde<br />
Ernährung, Kita-System in Berlin, Schul-System in<br />
Berlin, Suchtvorbeugung. Unser Hauptpunkt ist der Konsum<br />
von Zigaretten, was in diesen Familien ganz problematisch<br />
ist. Es wird überall geraucht, egal ob kleine oder<br />
größere Kinder im Raum sind. Unser Problem sind natürlich<br />
auch Jugendliche. Die Stadtteilmütter sind mit mir zur<br />
Suchtberatungsstelle gegangen, bei Bedarf vermitteln wir<br />
dann auch dahin.
Medien, das ist ein ganz großes Thema, insbesondere das<br />
Fernsehen und Videos. Natürlich auch die Rolle des Spiels,<br />
weil das in den Familien verloren geht, weil die Eltern nicht<br />
in der Lage sind, mit den Kindern zu spielen.<br />
Wir haben zehn Ordner, mit denen wir arbeiten. Damit<br />
habe ich auch im Unterricht gearbeitet. In diesen Ordnern<br />
sind die verschiedensten Flyer und Broschüren von ganz<br />
unterschiedlichen Institutionen drin, Krankenkasse, Unfallkasse<br />
etc. Diese Informationen bestellen wir aus dem<br />
ganzen Land und stellen sie als Mappe zusammen. Der<br />
11. Ordner ist ein Adressenordner bzw. der Kiez-Ordner,<br />
das heißt, jedes Gebiet hat einen eigenen kleinen Ordner<br />
mit den Adressen, was es in dem jeweiligen Kiez gibt.<br />
Ein Teil der Ausbildung zu Stadtteilmüttern bestand darin,<br />
die Beratungsstellen aufzusuchen. Natürlich haben wir<br />
auch mal zwischendurch Feste mit den Frauen gefeiert,<br />
um sie einfach zu stärken. Wir machen auch einmal im<br />
Monat Ausflüge. Wir haben uns erst mal Neukölln angeguckt,<br />
was es alles in der Umgebung gibt. Inzwischen<br />
gehen wir auch mal woanders hin. Aber das müssen wir<br />
finanzieren, weil die Frauen nicht die Mittel dafür haben.<br />
Wir hatten auch Frauen, die noch nie im Kino waren, wir<br />
waren auch bowlen. Das ist ein Hit, sage ich Ihnen. Auf<br />
jeden Fall ist es wunderbar zu sehen, dass die Frauen, die<br />
vor fünf oder acht Jahren angereist sind und wirklich nur<br />
in ihrem eigenen Raum waren, durch die Ausflüge so ein<br />
Selbstbewusstsein gewonnen haben. Es ist erstaunlich,<br />
das zu beobachten. Die Gruppen, die ich habe, gehen natürlich<br />
nicht verloren, die erste kenne ich seit 3 ½ Jahren,<br />
die andere seit 1 ½ Jahren.<br />
Das ist zu einer Gesamtgruppe geworden, weil sie nach<br />
der Ausbildung einmal in der Woche Teamsitzung haben,<br />
Gesamt-Team. Dann haben wir auch den Frauentreff, der<br />
im Nachbarschaftsheim stattfindet, jeweils am Mittwochvormittag,<br />
ohne Kinder. Auch die Teamsitzung findet ohne<br />
Kinder statt, das heißt, wenn die Kinder mal krank sind,<br />
dann können die Frauen vielleicht nicht kommen. Über<br />
das, was sie in den Familien erleben, können sie sich mit<br />
den Kolleginnen austauschen.<br />
Sie sind 30 Stunden pro Woche beschäftigt als Stadtteilmutter.<br />
Diese 30 Stunden sind fest gegliedert in einen<br />
Stundenplan. 10 Stunden in der Woche machen sie Familienbesuche.<br />
Sie sprechen mit einer Mutter z.B. über<br />
Unfallvorbereitung, wie das funktioniert. Wenn Bedarf ist,<br />
lässt sie Flyer oder<br />
Broschüren da.<br />
Wenn die Mutter<br />
kein Deutsch<br />
spricht, wird alles<br />
wieder mitgenommen<br />
und nur das,<br />
was wir muttersprachlich<br />
haben,<br />
wird dagelassen.<br />
Es ist so, dass wir<br />
nicht beraten, es ist keine Einzelfallhilfe, es ist einfach nur<br />
die Weitergabe von Informationen und ein Austausch.<br />
Die Stadtteilmutter ist einfach dazu da, dass sie sich als<br />
Mutter mit einer Mutter austauscht, die ihre Wohnung<br />
kaum verlässt. Das ist bei 70 bis 80 % der Fall. Die Stadtteilmutter<br />
geht in ihre eigene Umgebung und guckt, wen<br />
habe ich als Nachbarn, wer geht in den Straßen spazieren,<br />
wer sitzt am Spielplatz und spielt da, welche Kinder sind<br />
da zusammen? Und sie spricht die Mütter an. Das sind<br />
dann nicht die Mütter, die von sich aus interessiert und<br />
aufgeschlossen sind.<br />
Die Stadtteilmütter werden 6 Stunden in der Woche qualifiziert<br />
und zwar beim Beschäftigungsträger, wo sie angestellt<br />
sind. Das heißt, der Arbeitgeber ist ein anderer,<br />
der Träger ist ein anderer, Geldgeber sind wieder andere,<br />
es ist also ziemlich kompliziert in Neukölln gegliedert. Ich<br />
denke, in den anderen Bezirken ist das anders. Wir werden<br />
jetzt ja auch kopiert. Es gibt inzwischen 28 Stadtteilmütter<br />
in Kreuzberg. Und in Steglitz läuft gerade ein Kurs, es soll<br />
auch in anderen Bezirken noch geplant sein.<br />
Nach der Ausbildung bleiben die Stadtteilmütter zusammen<br />
und arbeiten auch gemeinsam 30 Stunden in der<br />
Woche. Sie sind in einem festen Rhythmus, gehen ihrer<br />
Beschäftigung nach, tauschen sich weiterhin aus und sollen<br />
auch mit den Institutionen in Kontakt bleiben. Seit ein<br />
paar Monaten sind wir auch dabei, einige Stadtteilmütter<br />
in den Schulstationen und in den Kitas zu verankern. Das<br />
heißt, die stehen auch jeweils eine Stunde lang mit einem<br />
Tisch und ihren Flyern vor den Kitas, in den Kitas, dahin-<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 25
26<br />
Workshop Einfach gut<br />
Einfach gut<br />
ter ein Plakat mit den Themen. Sie sprechen Mütter an,<br />
möchtest du mit mir sprechen über diese Themen? Spielt<br />
dein Kind nur alleine mit sich oder sieht es nur fern?<br />
Nachdem die Stadtteilmutter den Kontakt hat, trifft sie<br />
sich 10 Mal über jeweils 2 Stunden mit der Mutter. Wenn<br />
das nicht in der Wohnung stattfinden kann, dann haben<br />
wir auch Ausweichmöglichkeiten.<br />
Manchmal ist der<br />
Ehemann arbeitslos, liegt<br />
auf der Couch, die Schwiegermutter<br />
ist noch da, dann<br />
geht es nicht. Es gibt dann<br />
auch Kitas, natürlich auch<br />
das Nachbarschaftsheim,<br />
wo wir immer Räume zur<br />
Verfügung gestellt bekommen.<br />
Dafür sind wir sehr<br />
dankbar, weil wir sonst den<br />
Kontakt verlieren würden.<br />
In dem Moment, wo die<br />
Frau sagt: Nein, mein Mann<br />
möchte nicht, dass irgendjemand<br />
kommt, das ist einfach nichts für mich, können<br />
wir andere Räume in den Quartieren anbieten, wo wir uns<br />
in Ruhe unterhalten können. Natürlich auch in die Bibliothek,<br />
sie gehen aber auch gerne in Cafés.<br />
Die Stadtteilmütter sind sorgfältig ausgewählt worden.<br />
Jede Koordinatorin hatte für sich die Aufgabe, bestimmte<br />
Frauen auszuwählen. Sie musste natürlich reflektieren,<br />
ich musste auch selektieren, genauso wie meine Kolleginnen<br />
auch. Ich hatte eine Anzahl von 23 Frauen, nur 13<br />
Frauen haben das Zertifikat von mir erhalten – aus den<br />
verschiedensten Gründen, Schwangerschaft oder sie war<br />
nicht reflektiert, bestimmte Sätze sind im Unterricht gefallen,<br />
die im Einvernehmen mit der Demokratie nicht akzeptabel<br />
sind. Das geht natürlich gar nicht, solche Stadtteilmütter<br />
brauchen wir nicht, die im Auftrag des Bezirkes<br />
arbeiten und dann bestimmte Prinzipien vertreten, die wir<br />
als Diakonie, aber auch als demokratische Bürger, nicht<br />
vertreten können.<br />
Das sind die 10 Themen, über die wir 6 Monate gearbeitet<br />
haben, worüber auch die Stadtteilmütter sich weiter<br />
mit den Familien austauschen. Es gibt eine Qualifizierung<br />
PC, die läuft jetzt auch wieder.<br />
TN: Das Projekt hängt mit dem Nachbarschaftsheim Neukölln<br />
zusammen, die Ausbildung wird bei uns gemacht,<br />
dadurch sind die Stadtteilmütter selber mit dem Nachbarschaftsheim<br />
vertraut geworden, kennen die Einrichtung<br />
und haben eine Verbindung zu uns. Wir haben bei uns in<br />
der Einrichtung das Zuckerfest zusammen mit den Stadtteilmüttern<br />
gefeiert. Das war sehr schön. Dadurch bekommen<br />
wir auch Besuch von Müttern, die wir sonst nicht erreichen<br />
würden.<br />
Wir haben im Bereich Familienbildung auch Informationsveranstaltungen,<br />
zum Beispiel zu dem Thema Umstellung<br />
vom Stillen zu fester Nahrung. Da waren die Eltern aus<br />
den Eltern-Kind-Gruppen, die Stadtteilmütter als Multiplikatoren,<br />
aber auch Mütter, die die Stadtteilmütter mitgebracht<br />
haben. Mit ihrer Hilfe hatten wir da eine ganz gute<br />
Mischung zustande gekriegt.<br />
Weil wir festgestellt haben, dass wenige türkische und<br />
arabische Mütter sich an Eltern-Kind-Gruppen, PEKiP-<br />
Gruppen, etc. beteiligen, wollen wir jetzt noch zwei zweisprachige<br />
Gruppen anbieten, deutsch-arabisch und<br />
deutsch-türkisch, die jeweils von einer Stadtteilmutter und<br />
einer Kursleiterin betreut werden. Einerseits können wir<br />
es dann zweisprachig bieten, andererseits die Kontakte<br />
der Stadtteilmütter nutzen.<br />
Dorothee Parker: Ich kann noch ergänzen, dass wir in diesen<br />
2 ½ Jahren ca. 1.300 Familien erreicht haben. Unser<br />
Ziel waren 1.500 Familien.<br />
Theo Fontana: Sie haben ein niedrig schwelliges Angebot<br />
beschrieben, das trotzdem sehr strukturiert wirkt und sehr<br />
professionell aufgezogen ist. Das muss offenbar kein Widerspruch<br />
sein.<br />
TN: Ich habe das Projekt durch die Medien verfolgt. Mich<br />
interessiert, was passiert jetzt, wenn die ÖBS-Finanzierung<br />
endet? Wie geht es dann weiter? Der Bedarf wird ja<br />
nicht weniger, wenn die Familien ein paar Mal aufgesucht<br />
worden sind.
Dorothee Parker: Die Familien werden 10 Mal aufgesucht<br />
und die Mütter sind angehalten, zu dem offenen Frauentreff<br />
mittwochs zu kommen. Das heißt, einmal pro Woche<br />
sind wir drei Stunden im Nachbarschaftsheim. Wir haben<br />
ein Programm, man kann regelmäßig mit uns frühstücken,<br />
jede zweite Woche gibt es ein Treffen, bei dem über ein<br />
bestimmtes Thema diskutiert wird. Oder wir gehen in eine<br />
bestimmte Einrichtung. Und in der vierten Woche im Monat<br />
machen wir einen Ausflug. Das heißt, die Frauen werden<br />
ja auf verschiedene Weise interessiert. Wir feiern da<br />
auch Feste, es muss kein Ausflug sein. Wir hatten einen<br />
Tanzabend … wir dachten, das ganze Nachbarschaftsheim<br />
stürzt zusammen. Ich weiß nicht, wo die alle her kamen,<br />
es war brechend voll. Seit wir ein bestimmtes Thema haben,<br />
das viele interessiert, weiß ich nicht, von woher die<br />
alle anstürmen.<br />
Der Kontakt zu den Frauen bzw. zu diesen Müttern geht nicht<br />
verloren. Manche Stadtteilmütter verzweifeln schon, weil alle<br />
Frauen, die sie besucht haben, immer noch an ihnen hängen<br />
wie Kletten. Es ist dann meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass<br />
sich eine gewisse Barriere aufbaut. Denn es geht natürlich<br />
nicht, dass 20 Familien jeden Tag bei den Stadtteilmüttern<br />
anrufen. Unser Ziel ist, dass sie eben selber dorthin finden<br />
wo sie sich beraten lassen können und nicht nur immer an<br />
der Stadtteilmutter hängen. Das heißt, sie wissen, es gibt in<br />
ihrer Nähe verschiedene Stellen, wo sich Frauen treffen. Im<br />
QM gibt es auch Frauenfrühstück, im Nachbar-QM treffen sich<br />
Frauengruppen, dort können sie auch hingehen. Denn sie sollen<br />
ja alleine aus ihren Haushalten rausgehen.<br />
TN: Ist das Projekt befristet?<br />
Dorothee Parker: Bis Ende <strong>2009</strong> ist es finanziert, das<br />
ist keine Regelfinanzierung, aber das Modellprojekt läuft<br />
natürlich aus. Die Verlängerung für die Stadtteilmütter ist<br />
gelaufen, für uns Koordinatorinnen ist die Verlängerung<br />
leider noch nicht durch, aber ich gehe davon aus, dass<br />
wir auch verlängert werden, denn was sollten die Stadtteilmütter<br />
ohne uns machen?<br />
TN: Die werden selbstständig.<br />
Dorothee Parker: Ja, das wollen sie aber nicht. Und<br />
natürlich überwachen wir diese 24 Stunden Arbeit, die<br />
sie leisten. Es gibt Stundenzettel und ich überprüfe für<br />
meine Teamfrauen, wo waren sie, was haben sie gemacht,<br />
waren sie in der Qualifizierung, kommen sie in<br />
die Teamsitzung, waren sie in der Kita xy. Die 6 Stunden<br />
überwacht der Beschäftigungsträger. Aus meiner Sicht<br />
kann es nicht sein, dass sie ohne pädagogische Leitung<br />
arbeiten. Und sie müssen ja auch irgendwo ihre Sorgen<br />
loswerden.<br />
TN: Ich komme aus Freiburg im Schwarzwald. Ich mache<br />
seit 10 Jahren Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben einen<br />
neuen Stadtteiltreff in einem neu gebauten Stadtteil, der<br />
heißt Rieselfeld. Der ist für 12.000 Menschen ausgelegt<br />
und es gibt ihn seit 10 Jahren. Das ist sehr spannend,<br />
weil ich eben von Anfang an mit konzipieren und aufbauen<br />
konnte. Der Stadtteiltreff wird auf Erwachsenenebene<br />
nicht von vielen Migranten besucht, die sich im Stadtteiltreff<br />
engagieren, sondern es kommen eher die Kinder zu<br />
uns. Wir haben 100 Ehrenamtliche, das sind auch eher<br />
keine Migranten. Migranten sind eher angestellt, zum<br />
Beispiel im Gastronomiebereich. Wir haben Mittagstisch,<br />
auch mit Café und Anlaufstelle.<br />
Wir haben ein türkisches Fest veranstaltet, weil diese Zielgruppe<br />
nicht so zu uns ins Haus kommt. Dazu waren etwa<br />
17 türkische Frauen gekommen. Bei Ihrem Projekt würde<br />
mich interessieren, wo sind die Berührungspunkte zu Einheimischen<br />
oder zu Nicht-Migranten, sind sie gewünscht<br />
und im Programm verankert?<br />
Dorothee Parker: Die Stadtteilmütter sind im Nachbarschaftszentrum<br />
eingebunden. Sie sind dort vor Ort, etwa<br />
wenn sie die Ausbildung haben. Danach gibt es dort einen<br />
regelmäßigen Treff einmal in der Woche und gemeinsame<br />
Feste oder Veranstaltungen im Garten, also sie sind mit<br />
präsent in dem Stadtteilzentrum an sich, das ja offen ist<br />
für alle anderen auch.<br />
TN: Also findet ein Austausch statt, das wurde noch nicht<br />
so deutlich.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 27
28<br />
Workshop Einfach gut<br />
Einfach gut<br />
TN: Er findet auf einer informellen Ebene statt, ist aber<br />
nicht in irgendeiner Form organisiert. Man bringt Gruppen<br />
zusammen, indem man gemeinsam feiert. Wir haben auch<br />
einen Garten, der im Sommer immer geöffnet ist. Ansonsten<br />
haben wir das Kiez-Café, wo sich auch alle treffen. Da<br />
sind zum Teil auch Stadtteilmütter, aber auch viele andere.<br />
Der Austausch ist nicht organisiert und kommt in der<br />
Projektstruktur nicht vor, aber dadurch, dass es an einem<br />
Ort zusammenkommt, ist er möglich.<br />
TN: Aber das ist von Ihnen gewollt, dass es nicht auch<br />
noch ein Aufgabenbereich ist, den Austausch bzw. die Begegnung<br />
zwischen allen zu schaffen?<br />
Dorothee Parker: Unser Problem ist einfach, dass das<br />
Projekt, das von den verschiedenen Kooperationspartnern<br />
unterzeichnet wurde, zwar ein Integrationsprojekt ist.<br />
Das heißt, es ist so angelegt, dass zu 80 % türkisch- und<br />
arabischsprachige Familien erreicht werden müssen, der<br />
Rest ist offen. Rein deutsche Familien dürfen wir nicht aufsuchen,<br />
das ist im Konzept nicht vorgesehen.<br />
TN: Ich glaube, dass man die Parallelgesellschaft nur erreichen<br />
kann, wenn man Begegnungen initiiert. Das Problem<br />
habe ich ja auch, die türkischen Frauen kommen sonst<br />
nicht oder sie kommen nur an ihrem türkischen Fest, dann<br />
trauen sich aber die deutschen Frauen nicht. Über welches<br />
Thema schafft man es, sie zusammenzukriegen?<br />
TN: Ich habe eine Nachfrage. Es ging darum, dass Mütter,<br />
die angesprochen werden, irgendwann innerhalb von zwei<br />
Jahren an Angebote wie Kindergruppen, Nachbarschaftsheim<br />
usw. herangeführt werden. Das geht aber nur, wenn<br />
ich schon in den Gesprächen innerhalb der Familien Anreize<br />
schaffe, dass diese Begegnung auch wirklich von<br />
diesen Familien gewünscht wird. Also der integrative Teil<br />
sozusagen als Idee ebenfalls da ist.<br />
TN: Es ist die Aufgabe jeder einzelnen Koordinatorin für<br />
sich, wie sie mit ihrer eigenen Gruppe umgeht. Das heißt,<br />
wir gehen überall hin. Wir gehen auch mal an einem normalen<br />
Tag in ein Altersheim, wo nur deutsche Menschen<br />
sind. Es geht nicht darum, dass wir nur an bestimmten<br />
Festlichkeiten teilzunehmen, sondern natürlich feiern wir<br />
auch Weihnachten und Ostern und sonstiges. Natürlich<br />
gehen wir auch in bestimmte Räumlichkeiten, wo man als<br />
muslimische Frau niemals hingehen würde, zum Beispiel<br />
in das Jüdische Museum oder in eine Synagoge.<br />
Wir hatten ja vor dem inhaltlichen Beginn der Kurse eine<br />
gewisse Reflektionsphase, in der die Frauen in einer Probephase<br />
waren. Beim ersten Mal brauchte ich zu ihrer<br />
Auswahl acht Wochen, beim zweiten Mal ging das schon<br />
nach vier Wochen. Ich habe also auch gelernt, genauso<br />
wie meine Kolleginnen, wir hatten vorher keine Kurse geleitet.<br />
Wir mussten erst mal durch Fragen und inhaltliche<br />
Diskussionen prüfen, ob diese Frau überhaupt geeignet<br />
ist. Man sieht es ihnen ja nicht an.<br />
Elke Ostwaldt: Mein Thema ist ein anderes. Outreach ist<br />
das Jugendprojekt des Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit,<br />
und das Sofja-Projekt, sozialräumliche Familien- und<br />
Jugendarbeit, gehört dazu. Es war zunächst ein Bundesmodellprojekt<br />
der Diakonie, in dem die soziale Integration<br />
von Jugendlichen und deren Multiproblem-Familien verbessert<br />
werden sollte. Die Diakonie hatte sich überlegt,<br />
dass wir eine Kombination aus mobiler Jugendarbeit, das<br />
bin ich, und Familientherapie, das ist mein Kollege vom<br />
Diakonischen Werk, versuchen. Diese beiden ganz unterschiedlichen<br />
Arbeitsansätze wollten wir zusammenstricken,<br />
um auf der einen Seite für die Jugendlichen positive<br />
Effekte dabei herausholen, auf der anderen Seite eine<br />
spürbare Entlastung für die Familien zu schaffen. Das<br />
war die Grundidee. Dieses Bundesmodellprojekt ging von<br />
2003 bis 2006, dabei war ein Standort Treptow-Köpenick.<br />
Ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte.<br />
Als man mir diese Idee erklärt hatte, konnte ich es mir<br />
nicht so ganz vorstellen, weil es mir schwierig erschien.<br />
Man muss den Kontakt zu den Jugendlichen, die besondere<br />
Probleme haben, herstellen, das ist okay. Aber dass<br />
man dann als Streetworker in die Familien selbst reingeht<br />
und mit den Jugendlichen und den Familien über ihre Probleme<br />
spricht, in familiärem Rahmen, das konnte ich mir<br />
erst mal nicht so vorstellen.
Das Gute an dem Ganzen war, dass es ein Bundesmodellprojekt<br />
gewesen ist und wir ausprobieren konnten. Wir<br />
hatten also jetzt erst mal nicht so einen Wahnsinnsdruck,<br />
weil nicht gesagt wurde, wir müßten 10 Familien in drei<br />
Jahren aussuchen, sondern wir hatten einen Spielraum.<br />
Das war sehr, sehr wichtig, weil das Grundprinzip von Sofja<br />
ist, dass der Therapeut und die Sozialarbeiterin im Tandem-Team<br />
arbeiten. Das heißt, die Jugendlichen kommen<br />
zwar über mich, aber in die Familien gehen wir immer gemeinsam.<br />
Am Anfang ging es darum, dass sich das Team trifft und<br />
guckt, ob wir überhaupt miteinander arbeiten können.<br />
Dann haben wir uns ein gemeinsames Methodenrepertoire<br />
erarbeitet. Ich musste mich ein bisschen in die<br />
Methoden der aufsuchenden Familientherapie einarbeiten,<br />
insbesondere in die Methodik der Gesprächsführung.<br />
Der Kollege von der Therapie hat sich in die<br />
Sozialraumbegehung eingearbeitet. Wir beide arbeiten<br />
gemeinsam in Oberschöneweide, in einem ziemlich klar<br />
abgegrenzten Kiez, wo wir die Plätze inzwischen kennen,<br />
an denen sich die Jugendlichen aufhalten, wo er<br />
die Problematik von den Jugendlichen kennt. In der Regel<br />
ist es ungewöhnlich, dass Therapeuten zu den Plätzen<br />
der Jugendlichen gehen, damit vertraut sind, die<br />
Lebenswelt der Jugendlichen kennen.<br />
Wir haben uns eine gemeinsame Haltung erarbeitet. Für<br />
mich war es wichtig, dass ich die Parteilichkeit für die<br />
Jugendlichen nach wie vor behalten kann und eine Stimme<br />
für die Jugendlichen habe. Und mein Kollege eben<br />
die Allparteilichkeit hat, d.h. er ist sowohl für die Eltern,<br />
als auch für die Jugendlichen. Und mit dieser Haltung<br />
sind wir auch immer ins Gespräch reingegangen. Das<br />
ist sehr wichtig, weil unsere Erfahrungen zeigen, dass<br />
die Familiengespräche von den Eltern sehr gut genutzt<br />
werden. Aber es gibt immer wieder die Schwierigkeit,<br />
die Jugendlichen an diesen Prozess zu binden, weil da<br />
ja erst mal nicht so sehr viel Spannendes passiert, da<br />
redet man. Das ist für Jugendliche eine ganz schwierige<br />
Sache, sich zu treffen, dann auch noch mit den Eltern,<br />
dann noch in ihrer eigenen Wohnung und über das zu<br />
reden, worüber man sonst nie redet.<br />
Das war die Herausforderung, vor der wir gestanden haben.<br />
Wir haben dann gemeinsame Arbeitsprinzipien festgelegt.<br />
Das sind: Vertraulichkeit, was gesprochen wird,<br />
bleibt in dem Zimmer, in dem es besprochen wird und<br />
dringt nicht nach außen; die Niedrigschwelligkeit und Freiwilligkeit.<br />
Das gilt für die Familien, mit denen wir arbeiten,<br />
und für die Jugendlichen, wir arbeiten nicht im Zwangskontext,<br />
sondern das ist ein freiwilliges Angebot. Die Familie<br />
kann sagen, das ist gut, oder das gefällt uns nicht, wir haben<br />
da die und die Probleme oder wir möchten das nicht.<br />
Aber wenn sich eine Familie auf diesen Prozess einlässt,<br />
dann ist unsere Erfahrung, dass sowohl die Jugendlichen<br />
als auch die Eltern dabei bleiben, bis man eine Lösung für<br />
das Problem hat.<br />
Das ist teilweise sehr anstrengend – für alle Beteiligten,<br />
auch für die Eltern, für die Jugendlichen insbesondere, das<br />
auch auszuhalten. Aber wir haben erlebt, wenn es uns gelingt,<br />
sowohl die Eltern als auch die Jugendlichen an diesen<br />
Prozess zu binden, dann kommen wir zu sehr, sehr guten<br />
Lösungen, zu ganz praktischen Lösungen. Die Sozialarbeit<br />
macht den praktischen Teil, die Therapie, da musste ich<br />
auch noch eine Menge dazulernen, begleitet den therapeutischen<br />
Prozess<br />
und ist dadurch erst<br />
mal nicht so praxisorientiert<br />
angelegt<br />
wie zum Beispiel<br />
meine Arbeit als<br />
Sozialarbeiterin.<br />
Damit hatte ich am<br />
Anfang ein bisschen<br />
zu kämpfen,<br />
bis ich dann gemerkt<br />
habe, welche Effekte das hatte. Das braucht eben<br />
Zeit. Ein therapeutischer Prozess hat ganz andere Zeit als<br />
ein sozialarbeiterischer Prozess.<br />
Dann haben wir gesagt, wichtig ist der Ort. In der Regel<br />
ist es so, dass wir das in dem Zuhause machen.<br />
Aber wenn es gravierende Probleme zwischen den Jugendlichen<br />
und Eltern gibt oder wenn ein Jugendlicher<br />
sagt: ich möchte nicht, dass es in der Wohnung stattfindet,<br />
dann sagen wir, okay. Wir haben einen kleinen<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 29
30<br />
Workshop Einfach gut<br />
Einfach gut<br />
Beratungsraum oder wir nutzen einen ruhigen Raum im<br />
Jugendzentrum, um die Beratungen dort zu machen, damit<br />
die Jugendlichen einen neutralen Raum haben, und<br />
die Eltern auch.<br />
Für mich selber ist dieses Übertreten der Schwelle, also<br />
zu den Jugendlichen in die Wohnung zu gehen, ein sehr<br />
heikles Thema. Ich weiß sowieso schon so viel von denen,<br />
aber das dann auch noch zu sehen, in ihre Intimsphäre<br />
zu gehen, in die Privatsphäre, das war so ein Ding, wo ich<br />
gedacht habe, das ist kaum für mich vorstellbar.<br />
Wir haben 3 ½ Jahre in diesem Bundesmodellprojekt<br />
gearbeitet. Wir haben auch sehr viele Qualifizierungen<br />
gemacht, Supervision. Es haben sich für uns ein paar<br />
Grundsätze herausgestellt: Sofja arbeitet lebenswelt- und<br />
sozialraumorientiert, d.h. Ausgangspunkt unserer Arbeit ist<br />
die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Wir arbeiten<br />
lösungs- und ressourcenorientiert, d.h. wir gehen davon<br />
aus, dass in den Familien Ressourcen vorhanden sind. Die<br />
sind verborgen und die Eltern spüren sie vielleicht noch<br />
nicht so, aber man kann sie auf jeden Fall aktivieren. Wir<br />
arbeiten präventiv, d.h. meistens bevor das Kind ganz in<br />
den Brunnen gefallen ist. Und es bietet maßgeblich Hilfe<br />
zur Selbsthilfe.<br />
Das Ziel ist, dass die Familie so gestärkt aus diesem<br />
Prozess rausgeht, dass sie eine Idee davon gekriegt hat,<br />
wie der Weg sein<br />
könnte, Lösungen<br />
zu finden. Das ist<br />
das Ziel. Und dass<br />
man sich in der<br />
Nachbarschaft andere<br />
sucht, Väter,<br />
Mütter, Nachbarn,<br />
die mithelfen können<br />
gemeinsam zu<br />
überlegen, wie sie<br />
an diese Probleme herangehen. Denn Probleme mit Kindern,<br />
ob klein oder groß, ob Jugendliche, haben fast alle<br />
Eltern, egal, ob Mittelschicht-Eltern oder Unterschicht-Eltern.<br />
Es ist ja immer nur die Frage: wie komme ich zu einer<br />
Lösung und welche Wege gibt es?<br />
Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche von 11 bis 17 Jahren<br />
und deren Familien. In der Regel ist es so, dass der<br />
Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen über mich läuft,<br />
das heißt, es ist eine Hilfe, die auf Vertrauen aufbaut. Vertrauen<br />
ist unheimlich wichtig. Das heißt, es gibt den Kontakt,<br />
es ist eine tragfähige Beziehung zu den Jugendlichen<br />
aufgebaut worden. Und wenn ich sehe, die sind soweit und<br />
sagen: Wir haben im Moment so einen Stress zu Hause,<br />
könntest du nicht vermittelnd eingreifen, dann sage ich,<br />
okay, ich komme mit nach Hause und wir gucken mal. Das<br />
ist der Kontakt zu den Jugendlichen, und darüber entsteht<br />
der Kontakt zu den Eltern.<br />
In der Regel ist es so, dass die Eltern so einen Druck haben<br />
– aus den unterschiedlichsten Gründen -, dass sie<br />
ganz schnell eine Lösung finden müssen, und auch bereit<br />
sind, sich darauf einzulassen. Es gibt sehr viele Familien,<br />
die massiv unter Druck stehen. Entweder geht das Kind<br />
nicht mehr zur Schule, die kriegen einen Brief nach dem<br />
anderen von der Schule, sie wissen nicht mehr, wie schaffen<br />
wir es, dass unser Kind wieder zur Schule geht? Der<br />
geht einfach nicht, der schwänzt. Das andere ist natürlich<br />
die Alkohol- und Suchtproblematik, wobei wir die Erfahrung<br />
gemacht haben, bei Jugendlichen, die sehr drogenabhängig<br />
sind, da können wir nichts mehr lösen, da muss<br />
ein anderes Angebot ran. Sofja hat also auch ganz klar<br />
seine Grenzen.<br />
Es sind maßgeblich Probleme innerhalb der Familie, bei<br />
denen man sich hinsetzen muss, weil es so viel Stress<br />
gibt, der Junge oder das Mädchen sind von Zuhause abgehauen,<br />
es gibt keine guten Kontakte mehr untereinander,<br />
das sind so die Probleme, bei denen Eltern sich auf diesen<br />
Prozess einlassen, und wo Jugendliche dann sagen:<br />
vielleicht haben wir ja was davon, dass wir uns auf diesen<br />
Prozess einlassen, vielleicht gibt es eine Lösung für unsere<br />
familiären Probleme.<br />
Nachdem das Modellprojekt ausgelaufen war, wir unsere<br />
Erfahrungen gemacht und auch aufgeschrieben hatten,<br />
hatten wir hier in Treptow-Köpenick das große Glück, dass<br />
dieses Projekt regelfinanziert wird. Es gibt eine Stelle, die<br />
mein Kollege und ich uns teilen, und es arbeiten zwei relativ<br />
große Träger sehr eng miteinander zusammen, was ja<br />
eher ungewöhnlich ist. Die teilen sich jetzt die Gelder. Es
klappt einfach, weil unser Team gut funktioniert. Es gibt<br />
eine Kontinuität seit fünf Jahren, was auch schon Wirkung<br />
hat. Es gibt Sofja jetzt auch in Neukölln, unter teilweise<br />
großen Schwierigkeiten der Kollegen, weil sie dort diese<br />
Vorlaufzeit, die wir hatten, nicht haben.<br />
Wir arbeiten aber nicht nur mit Eltern und Jugendlichen.<br />
Gestern hatten wir eine Runde von Kids. Ein Mädchen hat<br />
mich angerufen, es gab ein Problem, sie wollte nicht, dass<br />
das jetzt mit ihrer Mutter besprochen wird, sondern mit<br />
ihrem Freundeskreis. Der Therapeut war dann damit konfrontiert,<br />
dass da plötzlich zehn Jugendliche saßen, keine<br />
Mutter, die natürlich eine ganz andere Absicht verfolgt.<br />
Eine wichtige Voraussetzung ist weiterhin, dass man sich<br />
auf gleicher Augenhöhe begegnet. Sozialarbeit sagt, okay,<br />
ich akzeptiere das, was die Therapie macht, die Therapie<br />
sagt, okay, das ist nicht nur ein bisschen praktisch vor sich<br />
hingewurstelt, sondern wir akzeptieren uns gegenseitig.<br />
Ganz wichtig ist eine gemeinsame Haltung und gemeinsame<br />
Arbeitsprinzipien, Respekt und Achtung vor den Jugendlichen<br />
und vor den Eltern. Das finde ich ganz wichtig.<br />
Egal, wie manchmal der Umgangston ist. In einigen Familien<br />
muss man ja manchmal wirklich sehr deutlich werden,<br />
auch in Bezug auf Kinderschutz, aber die Familie und die<br />
Jugendlichen sind erst mal so zu nehmen, wie sie sind, wir<br />
haben sie zu respektieren und zu achten. Aber dann sind<br />
auch klare Ansagen zu machen, wenn man Missstände<br />
sieht. Aber das Ziel muss gemeinsam mit ihnen entwickelt<br />
werden. Dass sie das spüren, dass man sie akzeptiert, das<br />
glaube ich schon.<br />
Für mich ist auch dieses Hilfe-zur-Selbsthilfe-Prinzip wichtig.<br />
Es ist ein großes Ziel für mich, Hilfe zur Selbsthilfe zu<br />
leisten und die Familie darin zu bestärken und zu unterstützen,<br />
dass sie sich auch selber helfen können. Dass<br />
sie nicht nur arm und schwach sind, sondern dass sie<br />
durchaus auch Stärken haben. Diese Stärken zu spüren<br />
und zu sehen, sie haben Kompetenz und Fähigkeiten, die<br />
sie nutzen können, dass sie merken, dass sie nicht das<br />
Jugendamt dazu brauchen, sondern es selbst schaffen,<br />
wieder die Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen,<br />
während die Jugendlichen es schaffen, die Verantwortung<br />
für ihr eigenes Leben zu übernehmen.<br />
TN: Ihr entscheidet selbst zusammen mit den Betroffenen,<br />
was ihr zusammen macht? Jugendliche können auf dich<br />
zugehen und sagen: ich habe ein Problem?<br />
Elke Ostwaldt: Auf jeden Fall wird geguckt, wie die Problemlage<br />
ist, ob es auch über mich zu klären ist oder ob<br />
die Eltern mit ins Boot geholt werden müssen. Dieser Prozess<br />
ist schnell und entformalisiert. Es gibt keinen Hilfsplan,<br />
sondern wir können direkt an die Probleme rangehen<br />
und starten. Das ist absolut flexibel.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 31
32<br />
Workshop<br />
Verhindern, vermeiden, vorbeugen<br />
Verschiedene Wege im Kinderschutz<br />
Inputs:<br />
Kirsten Harnisch-Eckert (Wellcome gGmbH Hamburg)<br />
„Das Wellcome-Projekt - praktische Hilfe<br />
für Familien nach der Geburt“<br />
Linda Ortleb (Jugendamt Steglitz-Zehlendorf)<br />
„Alltag und Ansprüche eines Regionalteams<br />
eines Jugendamtes“<br />
Beate Köhn (Fachstelle Berliner Notdienst Kinderschutz)<br />
„Auf Hilfe hinwirken - in Kontakt mit den Eltern“<br />
Moderation:<br />
Willy Essmann<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Ich komme aus Hamburg, aus<br />
der Geschäftsstelle von „Wellcome“, bin dort seit Anfang<br />
des Jahres zuständig für die bundesweiten neuen Teamgründungen<br />
von weiteren Standorten. Zusätzlich bin<br />
ich Familienbildnerin in einer Familienbildungsstätte in<br />
der Nähe von Hamburg und leite dort Eltern-Kind-Kurse.<br />
Ich möchte Ihnen meine Wellcome-Geschichte erzählen.<br />
Ich bin seit 15 Jahren in der Familienbildungsstätte Pinneberg<br />
als Kursleiterin tätig. Das Wellcome-Projekt läuft<br />
seit Ende 2003 in unserer Einrichtung. Als dieses Projekt<br />
entstand, dachte ich mir, das ist super, da engagiere ich<br />
mich, und habe als Ehrenamtliche in einigen Einsätzen<br />
gearbeitet. Nach 1 ½ Jahren wurde die Koordinationsstelle<br />
frei, dann habe ich 2 ½ Jahre dieses Wellcome-<br />
Projekt vor Ort koordiniert. Seit Anfang dieses Jahres<br />
bin ich in der Geschäftsstelle tätig in der Multiplikation.<br />
Was ist Wellcome? Wellcome bedeutet Hilfe von Anfang<br />
an, das Baby ist da, die Freude ist riesig - und nichts<br />
geht mehr. Das ist keine ungewöhnliche Situation. Wer<br />
keine Hilfe hat, bekommt sie von einer ehrenamtlichen<br />
Wellcome-Mitarbeiterin. Wie ein guter Engel wacht sie<br />
über den Schlaf des Babys, spielt mit dem Geschwisterkind,<br />
begleitet zum Arzttermin und hört ganz schlicht<br />
und ergreifend zu, ein ganz wichtiger Punkt, von dem<br />
unsere Ehrenamtlichen bei den Treffen berichten.<br />
Die Hilfe erfolgt total individuell, so wie die Familie die Hilfe<br />
benötigt. Es gibt da keine Grenzen, außer, dass unsere<br />
Ehrenamtlichen keine Haushaltshilfen sind. Wellcome<br />
ist für alle Familien da, die sich subjektiv hilfsbedürftig<br />
fühlen, die unter besonderen Belastungen leiden, die<br />
keine Hilfe von Familien, Freunden oder Pflegediensten<br />
haben. Das bedeutet, wer bei Wellcome anruft, der bekommt<br />
auch Hilfe. Man muss uns keinen Grund nennen,<br />
warum das so ist. Wir helfen nicht ausschließlich<br />
bei Mehrlingsgeburten oder bei Mehrfachbedarf der Familien,<br />
sondern die subjektive Hilfsbedürftigkeit ist entscheidend.<br />
Das kann sowohl die gut situierte Mutter sein,<br />
die sich komplett überlastet fühlt, wie auch eine Hartz<br />
IV-Empfängerin oder eine Familie mit vielen Kindern.<br />
Die Hilfe kostet 4 Euro pro Stunde, eine individuelle<br />
Ermäßigung ist möglich, denn am Geld darf die Hilfe<br />
nicht scheitern. Das ist ein Leitsatz von Wellcome,<br />
weil alle Familien bei Bedarf Wellcome nutzen sollen.<br />
Wellcome macht viel, aber nicht alles. Wellcome ist kein<br />
Notruf, das bedeutet, dass man die Koordinatorin nicht<br />
anrufen kann, weil man morgen zum Arzt muss und jemanden<br />
braucht, der auf das Kind aufpasst, sondern es<br />
geht dabei um eine verlässliche Terminabsprache.<br />
Wir haben natürlich in der Koordination nicht immer sofort<br />
eine Ehrenamtliche zur Verfügung, insofern muss das alles<br />
erst organisiert werden. Wir sind auch keine Agentur für<br />
Haushaltshilfen, was bedeutet, dass die Ehrenamtlichen<br />
keine Fenster putzen und nicht das Bad putzen, sondern<br />
es wird den Müttern dazu verholfen, dass sie Zeit haben,<br />
um das selber tun zu können.
Ganz wichtig: Unsere Ehrenamtlichen und auch die Koordinatorin,<br />
die ein Team von ungefähr 15-20 Ehrenamtliche<br />
betreut, sind kein Ersatz für die Fachkräfte,<br />
also kein Ersatz für Hebammen, Ärzte, Therapeuten.<br />
Die Ehrenamtlichen gehen in Familien, geben aber<br />
keine Tipps zur Stillproblematik oder zu Erziehungsproblemen<br />
etc. Wenn da etwas auftaucht, wenden sie<br />
sich an die Koordinatorin, diese wiederum geht in ihr<br />
Netzwerk und vermittelt je nach Problem Fachkräfte.<br />
Wellcome ist moderne Nachbarschaftshilfe. Es funktioniert<br />
so: Eine Familie meldet sich bei einem Wellcome-Standort<br />
bei einer Koordinatorin. Die Koordinatorin und die Familie<br />
führen ein telefonisches Gespräch. In dem Gespräch<br />
wird Wellcome sehr genau erklärt. Auf der anderen Seite<br />
wird von der Familie die Erwartung an Wellcome geklärt,<br />
an welchen Tagen bzw. wann eine Ehrenamtliche kommen<br />
soll. Wenn es das passende Angebot für die Familie ist,<br />
wird eine ehrenamtliche Mitarbeiterin vermittelt. Diese<br />
geht dann für eine bestimmte Zeit, zwei bis drei Monate,<br />
zwei Mal in der Woche für jeweils zwei bis drei Stunden in<br />
die Familie und leistet diese praktische Hilfe.<br />
Die Koordinatorin führt dann ein Abschlussgespräch, wo<br />
noch mal geklärt wird, ob diese Hilfe jetzt ausreichend war<br />
oder ob noch weiterführende Hilfe benötigt wird. Dann erfolgt<br />
die Abrechnung. Wenn Wellcome nicht die passende<br />
Hilfe gewesen ist, wird eben über Alternativen informiert<br />
und weitervermittelt. Wellcome ist ein Netzwerkprojekt,<br />
das immer einer Trägereinrichtung aus dem Bereich Jugendhilfe<br />
angegliedert ist und deren Hilfenetzwerk vor Ort<br />
mit nutzt.<br />
Wellcome ist Teamarbeit. Einerseits gehören die ehrenamtlichen<br />
Mitarbeiterinnen dazu, die die praktische Hilfe<br />
in den Familien leisten. Für uns sind sie das Herzstück,<br />
weil ohne die Ehrenamtlichen Wellcome nicht existieren<br />
könnte. Die Koordinatoren, die in einer Einrichtung als<br />
Fachkraft sitzen, vermitteln die Einsätze zwischen den Familien<br />
und Ehrenamtlichen, während die Leitung, meistens<br />
die Leitung der Einrichtung, Wellcome in die bestehende<br />
Struktur der Einrichtung einbindet. Wer darüber hinaus<br />
die Netzwerkpflege vor Ort macht, die Koordinatorin oder<br />
die Einrichtungsleitung, das ist von Standort zu Standort<br />
unterschiedlich.<br />
Wir bieten für unsere Ehrenamtlichen eine zeitlich überschaubare<br />
Aufgabe, was heute – aus unserer Erfahrung<br />
– ganz wichtig ist, dass Freiwillige sich nicht längerfristig<br />
binden müssen. Von Einsatz zu Einsatz können die Ehrenamtlichen<br />
entscheiden, ob es der Mittwoch, der Montag<br />
oder ein anderer Tag ist, ob es Vormittag oder Nachmittag<br />
ist. Es gibt sehr viele Ehrenamtliche, die mehrfach ehrenamtlich<br />
tätig sind und ihren Einsatz um ihre anderen Verpflichtungen<br />
herum planen. Das ist also eine sehr flexible<br />
Geschichte.<br />
Unsere Ehrenamtlichen werden regelmäßig zum Erfahrungsaustausch<br />
eingeladen. Bei diesen Treffen sprechen<br />
die Ehrenamtlichen über ihre Einsätze, erzählen ihre Erlebnisse,<br />
werden natürlich auch über das informiert, was<br />
bei Wellcome passiert.<br />
Während der Einsätze ist die Koordinatorin die fachliche<br />
Begleitung und diejenige, die im Laufe der ehrenamtlichen<br />
Tätigkeit die Fortbildungen organisiert. Für die Ehrenamtlichen<br />
besteht Versicherungsschutz und es gibt die Fahrkostenerstattung,<br />
ansonsten gibt es bei Wellcome keine<br />
Aufwandsentschädigung, also man kann kein Geld dabei<br />
verdienen.<br />
Wellcome erwartet natürlich Begeisterung für die Idee. Die<br />
Motivation ganz vieler Ehrenamtlicher, sich bei Wellcome<br />
zu engagieren, ist die eigene leidvolle Erfahrung, in der Zeit<br />
mit den Kindern keine Hilfe gehabt zu haben, sich überfordert<br />
gefühlt zu haben. Wellcome erwartet Erfahrung mit<br />
Babys und Kleinkindern, wobei man keine eigenen Kinder<br />
haben muss. Wir haben durchaus auch Ehrenamtliche,<br />
die keine eigenen Kinder, aber z.B. die Nachbarkinder<br />
großgezogen haben oder Neffen und Nichten. Wichtig ist,<br />
dass sie schon mal in Berührung mit Kindern gewesen<br />
sind. Wir erwarten Einfühlungsvermögen, Zuverlässigkeit<br />
und Verschwiegenheit. Ebenso wollen wir das auch von<br />
den Familien.<br />
In einem ausführlichen Vorstellungsgespräch zwischen<br />
der Koordinatorin und der Ehrenamtlichen wird von<br />
beiden Seiten festgestellt, ob sie miteinander arbeiten<br />
möchten. Das ist ein persönliches Gespräch, zu dem<br />
die Ehrenamtlichen in die Einrichtungen kommen und<br />
man sich gegenseitig kennen lernt. Da wird sehr genau<br />
abgeklopft, welches die Motivation ist, warum die Eh-<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 33
34<br />
Workshop Verhindern, vermeiden, vorbeugen<br />
Verhindern, vermeiden ...<br />
renamtliche sich bei Wellcome einsetzen möchte, was<br />
dahinter steckt, welche Vorstellung sie von ihrer Arbeit<br />
hat.<br />
Ohne Profis geht es bei Wellcome nicht. Die Koordinatorin<br />
ist eine bezahlte Fachkraft von 5 Wochen-Stunden. Sie<br />
berät die Familien, vermittelt die Hilfe, begleitet die Ehrenamtlichen,<br />
kennt und pflegt das Netzwerk. Bei Wellcome<br />
ist immer die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Punkt<br />
und ebenso für alle Projekte die Finanzierung. Die Leitung<br />
sorgt für optimale Rahmenbedingungen, ein Telefon, ein<br />
Anrufbeantworter, ein Büro.<br />
Was wir noch brauchen, das ist natürlich das Netzwerk vor<br />
Ort. Entsteht an einem Ort ein neuer Wellcome-Standort,<br />
ist eine große Aufgabe der Koordinatorin, das Netzwerk<br />
vor Ort kennen zu lernen und Wellcome dort bekannt zu<br />
machen, um Familien bei Hilfebedarf in dieses Netzwerk<br />
weiter vermitteln zu können.<br />
Natürlich sind unsere Wellcome-Koordinatorinnen auch<br />
in verschiedenen Arbeitskreisen vertreten. Als Partner haben<br />
wir Entbindungskliniken, Hebammen, Gynäkologen,<br />
Kinderärzte, Beratungsstellen und Einrichtungen. Das ist<br />
Netzwerkarbeit. Die Ehrenamtlichen gewinnen wir über<br />
Vereine, Freiwilligenorganisationen, Initiativen, Kirchengemeinden,<br />
lokale Presse.<br />
Für das Wellcome-Team gehören auch die Multiplikatoren<br />
dazu, Förderer, Spender, Sponsoren, die Schirmherrschaften,<br />
bundesweit und auf lokaler Ebene. Es gibt den<br />
Begriff der Paten bei uns, die stehen häufig mit ihrem Namen<br />
dafür, Wellcome zu unterstützen.<br />
Wir haben ein standardisiertes Verfahren, wie ein Standort<br />
neu eröffnet wird. Wir werden in Einrichtungen eingeladen,<br />
die sich entschließen, so einen Wellcome-Standort<br />
zu gründen, und gucken uns die vor Ort an. Es gibt ein<br />
Gründungsgespräch, wo wir mit den Einrichtungen sehr<br />
genau abklopfen, welches Netzwerk vorhanden ist, welche<br />
Voraussetzungen vorhanden sind, was ist das für eine Koordinatorin,<br />
die die Arbeit übernehmen soll. Dann gibt es<br />
eine eintägige Koordinatorin-Schulung, wo die Koordinatorin<br />
in unser Material eingewiesen wird. Zur Vorbereitung<br />
der Eröffnungsveranstaltung sind wir wieder vor Ort. Als<br />
Abschluss der Gründungsphase gibt es die Eröffnungsveranstaltung,<br />
die dadurch, dass wir in den Bundesländern<br />
die jeweiligen Sozialminister als Schirmherren haben,<br />
meistens sehr prominent gestaltet sind. Menschen aus<br />
dem Netzwerk begrüßen Wellcome in der Stadt, außerdem<br />
ist die Eröffnung selber eine wunderbare Netzwerkveranstaltung.<br />
Wellcome hat sich von Nord nach Süd ausgebreitet, ist<br />
in Hamburg und Schleswig-Holstein gestartet. Es gibt in<br />
Schleswig-Holstein 20 Standorte, in Hamburg sind es zurzeit<br />
12, da sind wir dabei, weitere Standorte zu gründen,<br />
in Berlin gibt es inzwischen 6 arbeitende Wellcome-Standorte,<br />
weitere 6 sind in der Planung, wo konkret Interesse<br />
von Einrichtungen besteht.<br />
TN: Ich habe die Einordnung des Projektes noch nicht<br />
verstanden. Es gibt die Familienhilfe, die trifft nur auf Familien<br />
zu, wo ein sozialer Bedarf festgestellt wird. Es gibt<br />
Haushaltshilfen, die kosten Geld. So wie ich das verstanden<br />
habe, ist Wellcome irgendwo dazwischen? Wie flexibel<br />
ist das mit den 4 Euro? Welche Familien greifen auf das<br />
Angebot zu?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Es greifen grundsätzlich alle Familien<br />
auf dieses Angebot zu. Es ist genau so angelegt,<br />
dass auch alle Familien, egal, welcher Herkunft, Wellcome<br />
nutzen können.<br />
TN: In meinem Bereich könnte sich niemand die 4 Euro<br />
pro Stunde leisten.<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Es gibt mehrere Standorte, Wilhelmshaven<br />
zum Beispiel, wo es auch so ist.<br />
TN: Wie weit ist dieser Preis verhandelbar?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Der ist komplett verhandelbar.<br />
Wir geben ja das Konzept an einen Standort. Nach der<br />
Gründungsphase regelt der Standort alleine die Reduzierung<br />
dieser 4 Euro, er muss auch die ganze Finanzierung<br />
alleine regeln. Dafür sind Schulen, die auch unsere<br />
Standorte zum Thema ehrenamtlicher Hilfe sind, ein guter<br />
Partner, gezielte Akquise von Spendern und Sponsoren zu<br />
betreiben. Unsere Erfahrung ist, dass das im Moment sehr
gut möglich ist, über Spender und Sponsoren zum Beispiel<br />
die Reduzierung dieser 4 Euro wieder wettzumachen für<br />
die Einrichtung. Die konkrete Entscheidung, wie viel die<br />
einzelne Familie bezahlt, liegt letztendlich bei der Koordinatorin<br />
oder bei der Leitung.<br />
TN: Wie haben Sie sich die praktische Unterscheidung zwischen<br />
Haushaltshilfe und Familienhilfe gedacht?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Wellcome ist ein primär direktives<br />
Angebot und möchte da sein, wo überhaupt professionell<br />
gehandelt werden muss.<br />
TN: Interessant ist, dass Sie bei den Partnern das Jugendamt<br />
nicht erwähnen. Ich war bei einer Wellcome-Eröffnung<br />
in Berlin, die Eröffnungsrede wurde von einer Mitarbeiterin<br />
des Jugendamts gehalten. Ist dieses Hilfeangebot nicht<br />
auch ein Versuch, niedrig schwellig in Familien reinzukommen?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Natürlich sind die Jugendämter<br />
Partner, sind genauso Netzwerkpartner wie eine Hebamme.<br />
Es gibt auch im Zuge des Kinderschutzes die Möglichkeit,<br />
Wellcome zu nutzen. Wir versuchen, unsere Ehrenamtlichen<br />
in diesem Bereich zu schulen, sehen uns<br />
aber natürlich nicht als Ausspäher der Familie. was den<br />
Kinderschutz angeht. Wenn Missstände auffallen, dann<br />
müssen wir natürlich handeln. Die Ehrenamtlichen haben<br />
ja genauso wie wir alle in diesem Bereich Verantwortung.<br />
Sollte es einer Ehrenamtlichen auffallen, dass in einer<br />
Familie die Kinder keine Betten haben, kein Teppich in<br />
der Wohnung ist, sondern nur Estrich, dann wird sich die<br />
Ehrenamtliche an die Koordinatorin wenden. Die Koordinatorin<br />
würde eventuell einen Besuch machen, was normalerweise<br />
jedoch nicht üblich ist, und versuchen, über<br />
den Kontakt, den sie vielleicht zum Jugendamt hat, ins<br />
Gespräch zu kommen, nachfragen, ob es da schon Erfahrungen<br />
gibt, ob es was ist, wo wir handeln müssen oder<br />
nicht. Das würde aber auch ganz konkret mit der Familie<br />
abgesprochen, also es läuft nicht hinter ihrem Rücken.<br />
Wenn die Ehrenamtliche zum Beispiel in diese Familie<br />
geht, die Kinder sind total fröhlich, alles macht einen<br />
positiven Eindruck, dann gibt es trotzdem Gesprächsbedarf<br />
darüber, warum die Kinder auf dem Estrich spielen<br />
oder warum keine Betten da sind. Darüber wird sie ins<br />
Gespräch kommen und dann die Familie dazu bewegen,<br />
professionelle Hilfe anzunehmen.<br />
TN: Es ist durch die Fülle der Standorte ein ganz spannendes<br />
Angebot, niedrig schwellig - wenn es denn tatsächlich<br />
bei allen ankommt. Auch die Ehrenamtlichen werden<br />
ja Multiplikatoren sein. Trotzdem werde ich hellhörig beim<br />
Thema Kinderschutz. Es wird natürlich einen geringen Teil<br />
von Familien geben, wo es vielleicht einen Jugendhilfe-Bedarf<br />
gibt, wo bestimmte Risikofaktoren vorhanden sind,<br />
woraufhin eigentlich eine professionelle Gefährdungseinschätzung<br />
erfolgen müsste. Alkoholproblematik, Schulden,<br />
häusliche Gewalt, damit wären aus meiner Sicht Ehrenamtliche<br />
überfordert, das richtig einzuschätzen. Das<br />
ist natürlich eine Frage von Schulung. Welche Ausbildung<br />
hat die Koordinatorin, wie ist die Frage der Einbettung?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Wellcome fängt viel niedrig<br />
schwelliger an. Wir haben wirklich wenige Familien,<br />
die über das Jugendamt kommen. Wenn wir solche Geschichten<br />
hören oder sehen, dann gehen natürlich auch<br />
bei uns alle Alarmglocken an, das ist gar keine Frage. Da<br />
ist die Kooperation mit dem Jugendamt günstig, da diese<br />
schnelle Verknüpfung zu haben, aber die Familie mitzunehmen.<br />
Es gibt ja ganz viele Familien, die augenscheinlich<br />
erst mal gar nicht hilfebedürftig sind, wo es für uns<br />
als ganz normaler Einsatz anfängt. Die Mutter meldet sich,<br />
sie hat das dritte Kind bekommen, die sind im Alter dicht<br />
beieinander. Die Ehrenamtliche stellt vielleicht sogar beim<br />
zweiten oder dritten Besuch fest: Irgendwas ist da komisch.<br />
Vielleicht steht zu jeder Tages- und Nachtzeit eine<br />
Weinflasche auf dem Tisch. Oder die Mutter sitzt immer<br />
lethargisch auf dem Sofa, während das Baby neben ihr<br />
schreit. Dann ist ganz klar, dass sie sich an die Koordinatorin<br />
wendet. Vielleicht besteht die Möglichkeit schon bei<br />
diesem Schritt, dass sie die Familie offen beteiligt, damit<br />
die Chance besteht, eine Familienhilfe in dieser Familie<br />
zu integrieren. Die Familienhilfe arbeitet mit Mutter und<br />
Vater, während die Ehrenamtliche trotzdem da bleiben soll<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 35
36<br />
Workshop Verhindern, vermeiden, vorbeugen<br />
Verhindern, vermeiden ...<br />
und die Kinder rausnehmen, so dass die Familienhelferin<br />
die Gelegenheit hat, wirklich mit den Eltern zu arbeiten.<br />
Unsere Ehrenamtliche ist also ergänzend tätig.<br />
Inzwischen ist es an einigen Standorten so, dass das Jugendamt<br />
bei Wellcome anruft und fragt, ob eine Ehrenamtliche<br />
in der und der Zeit die Kinder aus der Familie<br />
nehmen kann, damit das Jugendamt arbeiten kann. Es<br />
entstehen in vielen Bereichen auch weitergehende Projekte.<br />
Zum Beispiel im Kreis Pinneberg gibt es jetzt das<br />
Projekt „Hand in Hand“, wo auf Erziehungskonferenzen<br />
die Wellcome-Koordinatorin sitzt, die Hand-in-Hand-Koordinatorin,<br />
das Jugendamt und alle, die dazugehören, und<br />
wo gemeinsam überlegt wird: Wen brauchen wir jetzt da?<br />
Die Koordinatorinnen haben unterschiedliche fachliche<br />
Ausbildungen, Kinderkrankenschwester, Sozialpädagogen,<br />
es sind durchaus auch Erzieherinnen dabei. Wichtig<br />
ist, dass sie schon länger in der Einrichtung tätig sind, vor<br />
Ort vernetzt sind und dadurch diese ganze Arbeit tun können.<br />
TN: Werden die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen geschult,<br />
um Gefährdungsmomente zu erkennen? Was sind das für<br />
Einrichtungen, die sich für dieses Wellcome-Projekt interessieren?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Wir schulen unsere Ehrenamtlichen<br />
vor den Einsätzen grundsätzlich nicht, weil wir davon<br />
ausgehen, dass ihre Hilfe Nachbarschaftshilfe ist. Wir<br />
helfen so wie die Nachbarin, die Freundin, die Großeltern.<br />
Wir gehen erst mal von dem normalen Menschenverstand<br />
aus. Natürlich begleitet die Koordinatorin den kompletten<br />
Einsatz in der Familie. Es gibt regelmäßige Telefonate zwischen<br />
der Ehrenamtlichen und der Koordinatorin und zwischen<br />
der Familie und der Koordinatorin. Und am Ende<br />
steht ein Abschlussgespräch. So wird versucht, eine Vertrauensbasis<br />
aufzubauen.<br />
Natürlich gibt es Fortbildungen für die Ehrenamtlichen,<br />
die wir an näherem Bedarf orientieren. Aber wir möchten<br />
nicht, dass die Ehrenamtlichen mit dieser Nachbarschaftshilfe<br />
in jede Familie mit großen Ohren gehen,<br />
sich verpflichtet fühlen, alle Schränke durchzugucken,<br />
ob da jemand auffällig ist. Die Einschätzung, ob eine Gefährdungslage<br />
vorliegt, ist nicht Aufgabe der Ehrenamtlichen.<br />
Sondern wenn ihnen etwas komisch vorkommt,<br />
rufen sie die Koordinatorin an und die klärt alles Weitere.<br />
Da sind die Ehrenamtlichen absolut verlässlich. Wir<br />
wollen, dass es niedrig schwellig bleibt, wir wollen, dass<br />
alle kommen, wir wollen nicht, dass jemand denkt, oh,<br />
die haben mich ausgefragt, das möchte ich aber nicht,<br />
das ist zu persönlich.<br />
Die Institutionen sind zum großen Teil Familienbildungsstätten,<br />
egal, ob evangelisch oder katholisch, wir sind<br />
nicht konfessionell gebunden, es sind Schwangerenberatungsstellen,<br />
zunehmend Mehrgenerationenhäuser. In<br />
Berlin machen das das Nachbarschaftsheim Schöneberg,<br />
Stützrad e.V., Geburt und Familie e.V., Es interessieren<br />
sich jetzt auch Lebenswelt, Jugendwohnen im Kiez und<br />
das Nachbarschaftszentrum in der Ufa-Fabrik. Das sind<br />
die aktuellen Träger, bzw. Standorte in Berlin.<br />
Wir suchen zur Zeit jeweils Landeskoordinatorinnen, um<br />
diese neuen Teams zu betreuen. Dann gibt es die Bundesgeschäftsstelle<br />
in der Bundeskoordination, die meine<br />
Kollegin und ich machen, wo wir im Moment sehr viel mit<br />
Multiplikation beschäftigt sind. Wir werden auch für die<br />
Landeskoordinatorinnen verantwortlich sein, in der Beratung,<br />
in der Veranstaltung von Weiter- und Fortbildungen.<br />
So soll es irgendwann sein, wenn wir in allen Bundesländern<br />
vertreten sind, auch die öffentlichen Mittel für die<br />
Landeskoordination da sind.<br />
TN: In Berlin werden solche Projekte ergänzend von der<br />
Jugend- und Familienstiftung finanziert, so dass die einzelnen<br />
Projekte etwas besser ausgestattet sind.<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Sonst ist es so, dass die Trägereinrichtung<br />
für diesen Etat, den Wellcome braucht, verantwortlich<br />
ist, das sind 7.000 Euro im Jahr. In Berlin gibt es<br />
eine Stiftungsförderung, es gibt auch für die Landeskoordination<br />
eine Finanzierung über die BKK in Berlin. Es gibt<br />
unterschiedliche Finanzierungsmodelle. In Bayreuth zum<br />
Beispiel haben wir einen Standort, der in den nächsten<br />
drei Jahren von den Rotariern finanziert wird, also die Finanzierungswelt<br />
ist sehr bunt.
TN: Die Koordinatorin arbeitet fünf Stunden in der Woche,<br />
aber ich lese hier, dass es 15 Ehrenamtliche sind, also<br />
auch 15 zu betreuende Familien. Ist das nicht ein bisschen<br />
wenig an Zeit?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Was soll ich dazu sagen? Natürlich<br />
kann man wunderbar daraus eine 20-Stunden-Stelle<br />
machen, das ist gar keine Frage. Aber ich denke, für den<br />
Aufbau ist es mit fünf Stunden in der Woche okay. Es gibt<br />
aber durchaus Standorte, die jetzt schon länger laufen<br />
und wo der Stundenbedarf höher ist, weil die betreuten<br />
Familien einfach mehr werden, wo dann einrichtungsintern<br />
aufgestockt wird. Das geben wir nicht vor, sondern 5<br />
Stunden sind ein Richtwert, den wir erfahrungsgemäß haben.<br />
Wenn die Standorte sagen, dass sie gerne 10 Stunden<br />
hätten, ja, dann eben 10 Stunden.<br />
TN: Wie viele Familien bundesweit nutzen Wellcome?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Letztes Jahr waren es bundesweit<br />
ungefähr 1.200 Familien, die betreut wurden. Letztes<br />
Jahr hatten wir aber auch noch keine 87 Standorte, sondern<br />
ungefähr 50, mit gut 600 Ehrenamtlichen.<br />
Willy Eßmann: Gibt es mehr interessierte Familien als<br />
Ehrenamtliche? Funktioniert das mit den Ehrenamtlichen<br />
problemlos? Gibt es Familien nichtdeutscher Herkunft?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Dieser Ausgleich zwischen den<br />
Ehrenamtlichen und den Familien ist die nervenaufreibendste<br />
Arbeit einer Koordinatorin. Das ist einfach so,<br />
weil der Bedarf schwankt. Manchmal hat man plötzlich<br />
ganz viele Anfragen von Familien und es fehlen die Ehrenamtlichen.<br />
Deswegen ist es auch kein Notfallkonzept. Es<br />
kann sein, dass wir am nächsten Tag eine Ehrenamtliche<br />
in eine Familie schicken können, aber es gibt keinen Anspruch<br />
darauf.<br />
Ehrenamtliche für diese Form des Engagements zu gewinnen,<br />
ist relativ gut möglich, aber das ist auch von Standort<br />
zu Standort sehr unterschiedlich. Die meisten Ehrenamtlichen<br />
sind Frauen, die sich oftmals deshalb engagieren,<br />
weil sie in ihrer eigenen Mutterschaft keine Hilfe erfahren<br />
haben. In Berlin gibt es seit einem viertel Jahr den ersten<br />
echten männlichen Wellcome-Ehrenamtlichen. Die zeitliche<br />
Flexibilität macht es attraktiv. Unsere Erfahrung ist,<br />
dass sich viele sehr gerne engagieren.<br />
Sehr viele Familien sind mit diesen zwei Stunden einmal<br />
in der Woche total glücklich. Die sind so dankbar für diese<br />
zwei Stunden, die jemand da ist. Zu wissen, jeden Dienstagnachmittag<br />
kommt Frau Schulze, das ist eine große Entlastung.<br />
Es geht nicht immer um ganz viel Entlastung, sondern<br />
es geht häufig nur darum, dass überhaupt jemand<br />
kommt. Schon wenn die Familien wissen, sie haben bei<br />
Wellcome angerufen, sie werden zurückgerufen, sie sind<br />
wahrgenommen worden, es kommt jemand, vielleicht nicht<br />
morgen, aber vielleicht nächste Woche oder übernächste<br />
Woche, das ist erfahrungsgemäß schon eine Entlastung.<br />
TN: Besteht nicht die Gefahr, dass Sie sich unabkömmlich<br />
machen? Das ist ja immer wieder im Gespräch. Oder machen<br />
Sie so etwas wie Vernetzungsarbeit, also dass die<br />
Familien, wenn Sie sie irgendwann verlassen, gut eingebunden<br />
sind, vielleicht in ein Netzwerk von anderen Müttern,<br />
Vätern?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Das ist zum Teil Arbeit einer Koordinatorin.<br />
Unsere Hilfe begrenzt sich auf das erste Lebensjahr<br />
eines Kindes, es sind immer Trägereinrichtungen<br />
im Hintergrund, natürlich ist das eine Frage für die Koordinatorin,<br />
ob die Eltern schon irgendwo eingebunden sind.<br />
Dadurch, dass es häufig Einrichtungen sind, wo Eltern-<br />
Kind-Kurse angeboten werden, versuchen wir, bei Neuzuzug<br />
oder bei dem Eindruck, dass die Familie isoliert ist, sie<br />
in den Einrichtungen zu integrieren. Wo ist noch ein Platz<br />
im PEKiP, den suchen wir, um der Familie ersten Schritt zu<br />
erleichtern.<br />
Familien mit Migrationshintergrund: In Hamburg haben<br />
wir im letzten Jahr ein rein türkisches Wellcome-Team<br />
gegründet, mit einer türkischen Koordinatorin. Da gab es<br />
jetzt leider einen Wechsel, deswegen habe ich da noch<br />
keine Erfahrungswerte, wie es mit der neuen Koordinatorin<br />
läuft. Im Moment leisten wir überall weiter Aufklärungsarbeit<br />
und versuchen, Familien mit Migrationshintergrund<br />
mehr einzubeziehen. Es ist nicht einfach. Ob der Bedarf<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 37
38<br />
Workshop Verhindern, vermeiden, vorbeugen<br />
Verhindern, vermeiden ...<br />
nicht da ist, das weiß ich nicht, aber zumindest ist es anders.<br />
Ich habe zum Beispiel mal ganz süße schwarz-afrikanische<br />
Zwillinge im Einsatz gehabt, wo es mit der Ehrenamtlichen<br />
und der Familie - auch aufgrund der kulturellen<br />
Unterschiede – zu Spannungen gekommen ist. Da wurde<br />
dann im Wohnzimmer auf dem Fußboden gekocht. Der Ehrenamtlichen<br />
machte es Spaß, aber manchmal musste sie<br />
einfach durchatmen. Aber wenn es nicht passt, kann jede<br />
Ehrenamtliche und jede Familie jederzeit sagen, dass es<br />
nicht geht.<br />
TN: Gibt es für die Ehrenamtlichen Altersgrenzen nach<br />
oben oder unten?<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Die Ehrenamtlichen sind zwischen<br />
18 und 75.<br />
TN: Sie müssen genau überlegen, welche Ehrenamtlichen<br />
in welche Familien gehen, weil das passen muss...<br />
Kirsten Harnisch-Eckert: Es gibt Ehrenamtliche, die ganz<br />
klar Präferenzen setzen. Ganz typische Ehrenamtliche<br />
sind zum Beispiel ehemalige Grundschullehrerinnen.<br />
Ich habe mal eine in mein Team aufgenommen, die mir<br />
gesagt hat, ich möchte das unbedingt machen, ich finde<br />
das ganz toll. Sie war Grundschullehrerin in einem sozialen<br />
Brennpunkt in Hamburg gewesen und sie sagte, sie<br />
möchte jetzt mal die Kirsche auf der Sahnetorte sein. Es<br />
soll einfach mal schön sein. Da ist eben das ausführliche<br />
Gespräch wichtig, wo sind die Grenzen, wo sind die Möglichkeiten,<br />
was geht, nicht nur von der zeitlichen Seite her,<br />
sondern auch von der eigenen Belastbarkeit, der eigenen<br />
Geschichte.<br />
Willy Essmann: Von der Kirsche auf der Sahnetorte zu<br />
dem Alltag eines Regionalteams eines Berliner Jugendamtes.<br />
Linda Ortleb: Ich gehe davon aus, dass die Strukturen<br />
von Jugendämtern bekannt sind. Ich würde gerne erst<br />
mal sagen, was ich hier nicht mache: Ich werde nicht über<br />
Kinderschutzeinsätze berichten. Hinsichtlich des Kinderschutzes<br />
habe ich meinen Kollegen Oliver mitgebracht,<br />
der seit einiger Zeit Kinderschutzbeauftragter im Jugendamt<br />
Steglitz-Zehlendorf ist.<br />
Bei der Überschrift „Verhindern, vermeiden, vorbeugen“<br />
dachte ich, Jugendämter können eigentlich nur verhindern<br />
oder vermeiden, wenn sie Informationen erhalten. Informationen<br />
erhalten wir natürlich über die Kinderschutzorganisationen,<br />
wir sind im engen Kontakt und haben regelmäßige<br />
Einsätze, die wir ganz gewissenhaft erledigen. Das<br />
ist der eine Teil. Der andere Faktor, wie wir Informationen<br />
bekommen, geht über ein gutes Netzwerk. Das ist das,<br />
worum es in meiner Arbeit geht. Ich bin freigestellt von<br />
der Fallarbeit, d.h., ich habe die Zeit mich zu vernetzen.<br />
Ich bin in verschiedenen Gremien tätig, meine Mitarbeiter<br />
bzw. KollegInnen sitzen an ihren Schreibtischen und<br />
haben den Tisch voller Fälle. Meine Aufgabe ist es, das zu<br />
koordinieren. Wir haben ein Vernetzungsgremium, in dem<br />
wir interdisziplinär zusammen arbeiten, Gott sei Dank, seit<br />
zwei Jahren sind wir da mit einem freien Träger zusammen,<br />
mit der Erziehungs- und Familienberatungsstelle. Wir<br />
bekommen regelmäßig Besuch von unserem Kinder- und<br />
Jugendpsychiatrischen Dienst, wir haben Beteiligte aus<br />
unseren Freizeiteinrichtungen und wir bekommen natürlich<br />
– je nach Bedarf – zusätzliche Fachleute, die zu einem<br />
spezifischen Fall einen Beitrag leisten können.<br />
Darüber hinaus arbeiten wir noch in diversen anderen Gremien<br />
zusammen, darunter insbesondere die AG 78, die<br />
Zusammenarbeit von freier und öffentlicher Jugendhilfe<br />
im Bezirk. Wir haben da einen regen Austausch, wir arbeiten<br />
in unterschiedlichen Unterarbeitsgruppen. Wir sind<br />
aktuell dabei zu gucken, wie wir uns sinnvoll mit den Therapeuten<br />
und den psychosozialen Diensten in unserem<br />
Bezirk vernetzen können. Wir sitzen da zusammen mit<br />
dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst und dem<br />
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, mit verschiedenen<br />
Therapeuten oder auch mit Trägern, die therapeutische<br />
Angebote in ihrem Spektrum haben. Wir haben uns natürlich<br />
mit den Schulen vernetzt, wir haben einen Fachtag<br />
– im Zusammenhang mit den Schulstationen unseres<br />
Bezirkes – organisiert, es gab auch eine Beteiligung von<br />
Lehrern, Pädagogen und Schulleitern. Wir stellen uns jetzt<br />
auch regelmäßig an Schulen in den verschiedenen Gre-
mien vor, Gesamtkonferenzen, Elternkonferenzen, und<br />
stellen die Arbeit des Jugendamtes vor, machen die Strukturen<br />
durchsichtiger, weil vieles von dem, was Jugendamt<br />
ist, draußen nicht bekannt ist.<br />
Uns ist natürlich auch bekannt, dass wir nicht gerade beliebt<br />
sind. Am liebsten hat keiner mit uns ernsthaft Kontakt,<br />
weil man vor dem Jugendamt Angst hat. Aber um<br />
genau das aufzulösen, müssen wir uns vernetzen. Aus<br />
meiner Sicht ist nur derjenige wirklich gut in dieser Arbeit,<br />
der jede Gelegenheit nutzt sich zu vernetzen und sein Beziehungsnetz<br />
zu vergrößern. Unter anderem deswegen machen<br />
wir unsere Sozialraumerkundung, ich bin also voll auf<br />
der Welle der SRO, nach anfänglicher Skepsis. Ich dachte,<br />
da kommen die Provinzler und wollen uns Berlinern was<br />
erzählen. Aber inzwischen bin ich an vielen Stellen sehr<br />
begeistert von dem Konzept. SRO ist das Konzept der Sozialraumorientierung,<br />
nach der wir Berlin weit inzwischen<br />
arbeiten, die meisten Jugendämter sind darin inzwischen<br />
geschult. In diesem Konzept geht es u.a. darum, von dem<br />
Fall wegzukommen und mehr in Richtung Umfeld zu gucken,<br />
also dieser Vernetzungsgedanke, dieser Gemeinwesenarbeitsgedanke,<br />
steht dort im Vordergrund.<br />
Auf jeden Fall ist einer der Bereiche der Sozialraumorientierung<br />
Sozialraumerkundung. D.h., mit meinem Kiezteam<br />
mache ich seit zwei Jahren diese Sozialraumerkundung,<br />
drei oder vier Mal im Jahr. Wir gucken uns Institutionen<br />
an, nicht nur der Jugendhilfe, sondern wir gehen in Kirchengemeinden,<br />
in Sportvereine, in alle Bereiche, die für<br />
Kinder und Jugendliche und Familien relevant sind. Auch<br />
da haben wir die Möglichkeit, uns bekannt zu machen. Wir<br />
berichten über unsere Arbeit, die Leute können sich uns<br />
vorstellen, d.h. wir werden zu Menschen und bleiben nicht<br />
die Behörde, die dahinter steht.<br />
Das hat schon eine ganze Menge bewirkt, nämlich dass die<br />
Leute schneller auf uns zukommen. Wir bekommen oft Anrufe<br />
von Leuten, die früher nie angerufen hätten. Sie fragen<br />
mich irgendwas, was sie bewegt oder was sie bedrückt. Heute<br />
Morgen habe ich einen Anruf von einer Mitarbeiterin einer<br />
Schulstation bekommen, ob mir jemand einfällt, der sich mit<br />
sexuellem Missbrauch auskennt, sie war bei einem Jungen<br />
unsicher und brauchte einen kompetenten Experten. Schon<br />
solche Kleinigkeiten machen den Alltag leichter.<br />
In diesem Kiez-Team haben wir verschiedene Fachleute.<br />
Ich bin ganz wild daran interessiert, auch die Schulstationen<br />
hinzuzuziehen, denn seitdem wir unsere Jugendfreizeiteinrichtungen<br />
in dem Kiez-Team<br />
sitzen haben,<br />
merke ich auch bei<br />
den Kollegen, dass<br />
der Blick anders<br />
geschärft ist. Sie<br />
gehen mit einer<br />
ganz anderen Sensibilität<br />
auf ihre<br />
Jugendlichen und<br />
ihre Besucher in den Einrichtungen zu. Sie gucken anders<br />
und kommen manchmal mit einer Rückmeldung, da müsste<br />
man noch mal genauer schauen, vielleicht fällt euch<br />
was ein, wie wir da unterstützen können. Und sie holen<br />
sich auch noch anderen Rat. Ähnlich ist es mit den Schulstationen.<br />
Sie merken, worauf ich hinaus will. Was ich Ihnen<br />
hier erzähle, kommt aus den präventiven Zusammenhängen,<br />
denn je früher wir ansetzen, desto mehr können<br />
wir im Kinderschutz tun und möglicherweise verhindern,<br />
vermeiden, vorbeugen.<br />
Die Schulstationen sind eine ganz wichtige Schnittstelle<br />
in diesem Zusammenhang. Sie sitzen zwischen diesen<br />
beiden komplexen Institutionen, einerseits der Jugendhilfe,<br />
sie werden oft von den Jugendhilfen finanziert; andererseits<br />
sitzen sie in den Schulen und müssen dort mit<br />
den Pädagogen möglichst auf Augenhöhe arbeiten. Somit<br />
haben sie eine ungeheure Kompetenz genau in diesem<br />
Arbeitsfeld. Das ist auch genau der Bereich, wo wir immer<br />
Schwierigkeiten haben. Um nämlich näher an die Schulen<br />
heranzurücken, brauchen wir Menschen, die da unsere<br />
Transformatoren sind.<br />
TN: Die Mitarbeiter der Schulstationen, sind das Ihre Zuträger,<br />
sind das Ihre Multiplikatoren oder sind das Ihre<br />
Außenstellen? Oder was sind sie? Das ist ja ein sensibler<br />
Bereich. Träger der Jugendhilfe bekommen bisweilen<br />
Probleme, wenn sie Kontakte zum Jugendamt herstellen<br />
und dann Vorwürfe von ihren Klienten bekommen, weil<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 39
40<br />
Workshop Verhindern, vermeiden, vorbeugen<br />
Verhindern, vermeiden ...<br />
sie sich vom Jugendamt von oben herab behandelt fühlen.<br />
Das kann Vertrauensverhältnisse stark belasten.<br />
Linda Ortleb: Das ist sicher ein möglicher Stolperstein.<br />
Es wäre eigentlich auch der Abschluss dessen, was ich,<br />
um das abzurunden, noch mal erwähnen will. Mir ist klar,<br />
wenn wir Fachleute alle so wunderbar vernetzt sind, dann<br />
achten wir möglicherweise nicht mehr so auf den Vertrauensfaktor.<br />
Ich erlebe das natürlich auch bei meinen<br />
Kollegen. Ich bin bei einem Kollegen sehr ungemütlich<br />
geworden, der einen Brief bekommen hatte, der möglicherweise<br />
auf einen massiven Kinderschutzfall hinwies.<br />
Er hatte nicht den Weg gewählt, den man eigentlich immer<br />
zuerst gehen muss, nämlich sofort zu versuchen, mit den<br />
Betroffenen Kontakt aufzunehmen. Er dachte, er müsste<br />
erst mal horchen, weil er Kontakt zu einem Lehrer hatte,<br />
ob der vielleicht was weiß. Das sind die Momente, wo man<br />
hellhörig sein muss. Ich sage ehrlich, es ist meine Aufgabe,<br />
darauf immer wieder hinzuweisen. Ich lege u.a. sehr<br />
viel Wert darauf, dass im Kiez anonym gearbeitet wird. Der<br />
einzige Bereich, wo dieser Vertrauensschutz aufgeweicht<br />
werden muss, ist, wenn ich mit den Betroffenen selber<br />
nicht mehr weiterkomme, aber bedrohliche Aspekte für<br />
ein Kind sehe.<br />
Ein weiterer Stolperstein, über den wir gerne diskutieren<br />
können, ist dadurch entstanden, dass Mitarbeiter<br />
aus einer meiner<br />
Jugendfreizeiteinrichtungen<br />
jetzt<br />
auch im Kiez-Team<br />
sitzen. Seitdem<br />
haben sie natürlich<br />
einen etwas<br />
wacheren Wächterblick.<br />
Und natürlich<br />
gibt es daraufhin<br />
viele berechtigte<br />
Stimmen, die sagen: Das sind Jugendräume, das sollen<br />
Freiräume für Jugendliche bleiben. Die wollen wir ja<br />
auch dringend erhalten.<br />
Wenn jetzt aber die Jugendförderer einerseits mit den<br />
Jugendlichen vertrauensvoll zusammenarbeiten, dabei<br />
möglicherweise gravierende Dinge erfahren, die nicht<br />
unbedingt ans Jugendamt gehen muss, andererseits die<br />
Jugendförderer aber sehr eng an uns, an den RSD angebunden<br />
sind, besteht die Gefahr, dass der Vertrauensschutz<br />
beeinträchtigt werden könnte. Hier gibt es sicher<br />
Bereiche, wo wir noch viel nacharbeiten müssen.<br />
Es gibt noch einen Punkt: Ich habe das Privileg, dass ich<br />
als Sozialraum-Teamleitung von der Fallarbeit freigestellt<br />
bin, während meine Kollegen in der Regel zwischen 50<br />
und 70 Fälle auf dem Schreibtisch haben. Sie können also<br />
gar nicht in der Form die Vernetzungsarbeiten leisten wie<br />
ich. Natürlich versuche ich alles, was ich weiß, zu multiplizieren,<br />
aber es ist eben sehr an meine Person gebunden.<br />
Das ist ein ganz großer Nachteil.<br />
TN: Die Polizei hat eine ähnliche Problematik in der Frage<br />
des Vertrauens. Jugendarbeiter auf der einen Seite<br />
bekommen Dinge mit, können aber auch was bewegen,<br />
weil sie nicht am Schreibtisch sitzen, sondern direkt interagieren.<br />
Ich habe Polizisten erlebt, die in der Hinsicht<br />
sehr viel gelernt haben. Sie wollen nicht mehr unbedingt<br />
– wie das früher in der Regel der Fall war – erst einmal<br />
alles wissen. Inzwischen passiert es, dass ein Polizist in<br />
einem Konfliktgespräch bewusst in bestimmten Situationen<br />
den Raum verlässt, damit die Sozialarbeiter in offenem<br />
Gespräch weitermachen können. Weil er sonst in<br />
seiner Eigenschaft als Polizist etwas hört, wo er handeln<br />
müsste. Das finde ich sehr gut, weil sie damit anderen Interventionsformen,<br />
die vielleicht mehr bewirken können,<br />
eine Chance lassen.<br />
Linda Ortleb: Ich glaube auch, dass wir manchmal Kollegen<br />
von außen brüskieren, indem wir sagen: Das dürfen<br />
Sie jetzt gar nicht sagen. Manchmal ist es auch andersrum,<br />
dass Leute sagen: Ich habe diese Erfahrung mit<br />
Familie XYZ, wie sieht es bei Ihnen aus, was haben Sie?<br />
Mit Schulen kommt das vor. Ich kann dann nur sagen: Ich<br />
kann Ihnen dazu nichts sagen, weil ich zur Verschwiegenheit<br />
verpflichtet bin. Dann fühlen die sich manchmal zurückgewiesen,<br />
nach dem Motto, na gut, entweder wollt ihr<br />
euch nun vernetzen oder nicht. Das ist zweischneidig.
TN: Das Jugendamt hat, das steht in der Ausführungsvorschrift<br />
zum Gesetz, auch einen Rechercheauftrag. Der<br />
wirkt an manchen Stellen doch sehr eng. Früher gar nicht,<br />
da hat man den Eltern einen Brief in den Briefkasten gesteckt<br />
mit der Bitte um einen Besuchstermin. Teilweise<br />
bei schweren Kinderschutzfällen wurde gewartet, dass die<br />
Eltern sich melden. Das hat natürlich nicht funktioniert.<br />
Diese ganze Debatte, auch in den Medien, hat zum Teil Positives<br />
befördert. Wichtig ist, dass bei Kinderschutzfällen<br />
alle Beteiligten professionell auf Anzeichen und Informationen<br />
reagieren. Ich erlebe es immer wieder, wie wichtig<br />
das Wissen um die Anzeichen von Gefährdung ist, wirklich<br />
zu wissen, wo wir Alarmsignale aussenden müssen. Psychische<br />
Störungen, häusliche Gewalt, Alkohol, all das ist<br />
zum Teil ganz schwer zu erkennen. Man kann sich immer<br />
anonym beraten lassen, wenn man einen Verdacht hat.<br />
Das heißt, der Fall, über den man sprechen möchte, kann<br />
zunächst anonym bleiben. Dazu ist es ganz toll, dass es in<br />
allen Bezirken Kinderschutz-Koordinatoren gibt. Bei denen<br />
kann man sich Rat holen, wenn man über die Symptome<br />
oder die einzuleitenden Schritte unsicher ist.<br />
TN: Wie sind Sie denn vernetzt für die kleineren Kinder, die<br />
1- bis 6-Jährigen, also bevor die Schule anfängt?<br />
TN: Da sind wir u.a. mit dem Kinder- und Jugendnotdienst<br />
vernetzt. Natürlich haben wir auch eine Vernetzung über<br />
Kitas. Wobei ich gestehe, es gab in den letzten zwei Jahren<br />
ziemlich viel Unruhe, Aufregung, Trägerwechsel usw.,<br />
insofern ist das einer meiner nächsten Schritte, dass ich<br />
auf die Kitas losstürze. Gerade in Kitas besteht noch viel<br />
Unsicherheit bei diesem Thema.<br />
Linda Ortleb: Ich meine, ich kann in erster Linie nur das<br />
Angebot zur Vernetzung machen. Das ist meine Überzeugung.<br />
Ich biete an zu den Elternabenden zu kommen,<br />
um mich vorzustellen, nicht nur ich, sondern auch meine<br />
Kollegin. Ich weiß, in anderen Regionen wird das auch so<br />
gehandhabt. Ich weiß, dann gibt es ein Gesicht zu dem<br />
Jugendamt, dann traut man sich vielleicht eher, mal was<br />
zu fragen. Viel mehr kann man da nicht machen.<br />
TN: Mit dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst gibt<br />
es jetzt eine richtige Kooperationsvereinbarung, zwischen<br />
dem Dienst und dem Jugendamt. Dann weiß jede Behörde,<br />
was zu tun ist, wenn bestimmte Verhaltensaspekte<br />
bekannt werden. Gerade für die kleinen Kinder ist das<br />
mit dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst toll, der<br />
zuerst etwas erfährt, genaue Standards hat, die er abarbeitet,<br />
d.h., er prüft erst mal seine Möglichkeiten, wie<br />
weit er damit dieser Gefährdung begegnen kann. Reichen<br />
seine Möglichkeiten nicht aus, dann muss sofort auch<br />
das Jugendamt noch mal entscheiden, damit man dann<br />
gemeinsam das Kind gut schützen und auch die Eltern gut<br />
unterstützen kann.<br />
TN: Zu der Gefährdungseinschätzung in der Kita: Wir haben<br />
das häufig, dass die Einschätzungen der Gefährdung,<br />
gerade zwischen Kita-ErzieherInnen und Jugendamt, sehr<br />
auseinanderklaffen. Erzieher sehen sehr viel früher eine<br />
Gefährdung, sie sagen: Mensch, die kommen ohne Frühstück<br />
in die Kita, das geht nicht, da muss das Jugendamt<br />
ran. Aber das Jugendamt sieht da noch lange keine Gefahr.<br />
Kita-ErzieherInnen fangen dann ganz stark an, selber<br />
in Familien reinzugehen, selber Hilfen anzubieten. Aber sie<br />
sind dann ganz schnell überfordert damit. Ich weiß nicht,<br />
ob Sie das kennen?<br />
TN: Ja. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Kitas gesetzlich<br />
zum Eingreifen verpflichtet sind, wenn sie Befürchtungen<br />
haben. Sie müssen selber Unterstützung anbieten und<br />
nach ihren Möglichkeiten die Familie unterstützen. Damit<br />
soll ja die Kita-ErzieherIn nicht alleine gelassen werden,<br />
sondern sie wendet sich an eine Fachkraft. Die muss<br />
es entweder in der Kita geben oder aber zumindest im<br />
Dachverband oder auch bei anderen freien Trägern, dem<br />
Jugendamt, wo auch immer sie die herbekommt. Mit so<br />
einer Fachkraft kann sie sprechen, um die Gefährdung<br />
abschätzen zu können. Aber auch um zu gucken, wie<br />
die Familie unterstützt werden kann. Erst wenn die Kita<br />
an den Punkt kommt, dass sie es mit ihren Mitteln nicht<br />
mehr schafft, dieses Kind zu schützen oder sie können<br />
nicht einschätzen, wie viel Gefährdung vorliegt oder nicht,<br />
weil sie keinen Ermittlungsauftrag hat, dann erst schaltet<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 41
42<br />
Workshop Verhindern, vermeiden, vorbeugen<br />
Verhindern, vermeiden ...<br />
man das Jugendamt ein. Aber es ist durchaus im Sinne der<br />
Kinder und der Familien, dass erst mal die Stelle vor Ort,<br />
die nahe an den Eltern ist, die Kontakt mit ihnen hat, das<br />
Thema zur Sprache bringt.<br />
TN: Zwei Stunden pro Woche bieten wir eine Beratung von<br />
außen an. Da gehen viele Eltern hin, die nicht unbedingt<br />
mit mir als Kitaleiterin sprechen wollen oder mit Kita-Erzieherinnen,<br />
wo wir aber viel mehr die Möglichkeit haben,<br />
konkrete Fragen zu stellen zu allen Punkten, über die sie<br />
unsicher sind. Wenn es um Kinderschutz geht, wenden<br />
wir uns ans Jugendamt. Wir kennen aber auch sehr gut<br />
die für uns Zuständigen auf dem Jugendamt. Wir haben<br />
auch die Elternvertreter zum Austausch eingeladen. Das<br />
ist auch hilfreich.Die Bedenken gegen das Jugendamt gibt<br />
es schon bei den Eltern. Aber wir gehen dort zusammen<br />
hin, sie brauchen ihren Namen nicht zu sagen, es geht nur<br />
um eine Beratung, sie könnten auch wieder rausgehen,<br />
aber erst mal helfen wir ihnen, dass sie da hingehen. Ich<br />
denke, dass das für Eltern ganz wichtig ist.<br />
TN: Was Sie gerade erzählen, das finde ich klasse. Ich würde<br />
es gerne klar formulieren: Der § 8a hat ganz viel in<br />
Gang gesetzt, nicht nur bei Ihnen, sondern eigentlich ist<br />
das eine große Chance, dass alle davon profitieren, dazulernen,<br />
den Blick schärfen, um vernetzter zu arbeiten. Das<br />
Problem ist, wir reden alle gerne von Vernetzung, aber in<br />
der Umsetzung hapert es häufig. Diese ewige Schimpferei<br />
über das Jugendamt ist auch demotivierend für die, die<br />
die Hilfe brauchen, umgekehrt auch für die KollegInnen<br />
im Jugendamt, das heißt, es erwächst daraus viel. Die<br />
Fachlichkeit müsste besser unterstützt werden in den Einrichtungen.<br />
Es lohnt sich, dort anzusetzen, die Ausbildung<br />
dahin auszurichten, besser zu beraten. Da haben wir ein<br />
Defizit. Ich weiß nicht, wie das hier ist, ob Sie da schon<br />
weiter sind?<br />
TN: In Berlin gibt es zum Beispiel für Fachkräfte der freien<br />
Träger eine 10-tägige Fortbildung, über mehrere Module,<br />
die ich sehr gut finde. Ich kann das beurteilen, weil ich selber<br />
daran teilgenommen habe. Ich arbeite im öffentlichen<br />
Träger und interessanterweise wird davon ausgegangen,<br />
dass im RSD alle per se Fachkräfte sind, während man bei<br />
freien Trägern extra diese Ausbildung machen muss. Ich<br />
fand diese Ausbildung für mich sehr wichtig und hilfreich.<br />
TN: Ich glaube auch, dass da eine Debatte in Gang gekommen<br />
ist. In Berlin werden diese Dinge sehr unterschiedlich<br />
gehandhabt, von Bezirk zu Bezirk, aber auch von Person<br />
zu Person verschieden.<br />
TN: Die Fachkräfte brauchen m.E., wenn sie in schwierigen<br />
Situationen kommen, unbedingt die Möglichkeit, sich anonym<br />
beraten zu lassen, damit sie selbst angemessen handeln<br />
können. Viele Jugendämter erwecken den Eindruck,<br />
dass sie mehr daran interessiert sind, Fälle gemeldet zu<br />
bekommen, um selbst sofort einzugreifen. Das verunsichert<br />
und erhöht die Schwelle, sich fachkundigen Rat zu<br />
holen.<br />
TN: Anonym und anonym, das können zwei ganz unterschiedliche<br />
Dinge sein. Das eine ist die anonyme Meldung,<br />
das andere ist die anonyme Beratung. Zu sagen:<br />
Ich glaube, das ist ein Kinderschutzfall, da mache ich mir<br />
Sorgen aus den und den Gründen, aber ich will nicht sagen,<br />
wer ich bin, obwohl ich eine Fachkraft bin, das finde<br />
ich nicht okay. Aber genau diesen Fall hatte ich ganz oft<br />
in der Vergangenheit. Aufgrund der Zusammenarbeit mit<br />
Schulstationen hatte ich Anrufe wie: Ich habe so einen<br />
Fall, bei dem habe ich Bauchschmerzen, aber wenn ich<br />
den jetzt Ihnen vom Jugendamt erzähle, dann geht das<br />
Ganze Prozedere los, das will ich im Moment nicht. Dann<br />
habe ich geantwortet, dass wir es so halten können, dass<br />
er mir das anonym sagt und ich sage meine Einschätzung<br />
und wie wir damit umgehen würden. Dann kann der Anrufer<br />
entscheiden, wie er damit umgehen will. Das ist wie<br />
die Situation mit der Polizei, wo der Polizist rausgeht. Das<br />
kann man praktizieren.<br />
Beate Köhn: Das kann ich durch ein Beispiel untermauern:<br />
Wenn bei der Hotline Kinderschutz jemand anruft<br />
und sagt: Ich bin Familienhelferin, wir haben hier einen<br />
Fall, dann wird klar, es ist eine schwere Gefährdung, akuter<br />
Handlungsbedarf. Und dann sagt ein Profi, ja, ich will
aber nicht namentlich genannt werden. So etwas hatten<br />
wir schon. Dann sagen wir: Stopp, das geht nicht. Wenn<br />
jetzt die Nachbarin sagt, dass sie Angst hat, dann ist das<br />
okay, aber bei Profis? Es ist notwendig, die Dinge möglichst<br />
transparent zu halten und wenn man das unter Profis nicht<br />
macht, ist das problematisch. Es kann ja einen Super-Sonder-Einzelfall<br />
geben, wo das Sinn macht. Aber in der Regel<br />
sind Professionelle für das Jugendamt die Quelle, unser<br />
Bezug, woher wir unser Wissen haben.<br />
TN: Mir fällt natürlich schon was ein, wo man tatsächlich<br />
einem Professionellen die Möglichkeit geben sollte, die<br />
Meldung anonym zu machen, beispielsweise in Jugendeinrichtungen.<br />
Warum nicht?<br />
Beate Köhn: Weil auch die dortigen Mitarbeiter eine Meldung<br />
nicht als Privatperson machen, sondern sie sind<br />
nach dem SGB VIII, Paragraf 8, Einrichtungen, die so eine<br />
Dienstleistung erbringen müssen.<br />
TN: Wenn hier gesagt wird, dass eine anonyme Beratung<br />
etwas anderes ist als die anonymisierte Meldung, das<br />
finde ich einleuchtend. Die Meldung kann nicht anonym<br />
sein, das hat was damit zu tun, dass man nicht einfach<br />
jemanden beschuldigen darf, ohne dafür auch einstehen<br />
zu müssen.<br />
Beate Köhn: Von dem allgemeinen und sehr umfangreichen<br />
Angebot zum Kinderschutz gehen wir wieder<br />
zurück auf einen Aspekt, nämlich mit Eltern überhaupt<br />
erst mal in Kontakt zu kommen und den Kontakt zu halten.<br />
Das ist ja für viele, die hier sind, ein Teil dieser direkten<br />
Arbeit. Auch dazu zu ermuntern, die angebotene<br />
Hilfe anzunehmen. Vieles von dem, was Ihre KollegInnen<br />
tun, die ehrenamtlich in den Familien sind, muss auch in<br />
der Kita, in Nachbarschaftsheimen oder Freizeiteinrichtungen<br />
passieren, weil wir es oft mit sehr entmutigten<br />
Familien zu tun haben. Wir haben es oft mit Familien zu<br />
tun, die bisher möglicherweise das Jugendamt oder auch<br />
andere Institutionen und staatliche Unterstützung nicht<br />
als hilfreich und nicht als würdigend und respektvoll<br />
erlebt haben. Insbesondere haben sie diese Erfahrung<br />
gemacht, wenn sie beim JobCenter bestimmte Anträge<br />
stellten mussten. Wer das mal mitgemacht hat oder sehr<br />
nahe an Leuten dran ist, die das mitmachen müssen,<br />
der weiß: Es ist unglaublich, welche Entmutigung damit<br />
einhergeht.<br />
Ich habe das jetzt ein bisschen auf Nachbarschaftsheime<br />
ausgerichtet, aber Sie können sich das auch umdenken:<br />
Wie im Gegensatz dazu eine stärkende und ermutigende<br />
Einstellung bei denjenigen, die Hilfe anbieten, präsent ist.<br />
Denn damit wird was vorgelebt, damit wird ein bestimmtes<br />
Beziehungsgeschehen vorgelebt, das stimmt auch für Ihre<br />
Ehrenamtlichen, die leben das. Das theoretische Wissen<br />
darüber, was Kinder brauchen, um gesund und glücklich<br />
aufwachsen zu können, haben viele. Aber darüber hinaus<br />
halte ich es für enorm wichtig, dass wir uns, ob ehrenamtlich<br />
oder professionell, Risikofaktoren, mit Gefährdungseinschätzung<br />
befassen, um eine mögliche Gefährdung<br />
eines Kindes erkennen zu können.<br />
Einen Teil macht der gesunde Menschenverstand, andere<br />
Teile sind schon ein bisschen schwieriger zu erkennen. Gut<br />
gemeint ist nicht immer gut, wenn man desolate Verhältnisse<br />
mit seiner Unterstützung vielleicht aufrecht erhält.<br />
Ich bin durch meine Arbeit immer mit den Super-Krisen-<br />
Fällen befasst, mit häuslicher Gewalt usw. Wenn man da<br />
nach dem Motto hinsieht: Eigentlich ist er doch ganz nett,<br />
ist auch ganz nett zum Kind, ohne zu erkennen, welche<br />
Dynamik und welche Gefährdung dahinter steckt, dann ist<br />
das nicht hilfreich.<br />
Deswegen ist ein bestimmtes Wissen schon gut. Die<br />
zweite Seite ist das Wissen um die gesellschaftlichen<br />
Hintergründe, auf denen familiäres Leben stattfindet.<br />
Ökonomische Verhältnisse werden manchmal außer<br />
Acht gelassen. Oder etwa: Was bedeutet es, wenn jemand<br />
zum Beispiel inhaftiert gewesen ist, wie erlebt der<br />
die Unfreundlichkeit des Arbeitsmarktes, usw., was bedeutet<br />
das für die Familien? Es gibt diesen nicht ausgesprochenen<br />
Satz in Familien mit großen Schwierigkeiten:<br />
Niemand soll wissen, niemand darf wissen. Das ist natürlich,<br />
wenn man mit seinem schönen Hilfe-Setting aus<br />
irgendeinem gut gemeinten professionellen Grunde ankommt,<br />
unverständlich: Wie sind die denn drauf? Was<br />
ist denn da los? Warum finden die das nicht toll, ich bin<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 43
44<br />
Workshop Verhindern, vermeiden, vorbeugen<br />
Verhindern, vermeiden ...<br />
schon drei Mal gegangen, um die Ecke gibt es die Stadtmission,<br />
da können die sich komplett einkleiden, die sagen<br />
aber Nein, das mache ich nicht.<br />
Das heißt, wir müssen erst mal überlegen, welche Gefühle<br />
herrschen in Familien mit schwierigen und schwerwiegenden<br />
Problemlagen überhaupt vor. Wir haben es mit<br />
Angst zu tun, mit Scham, mit Schuldgefühlen, z.B. keine<br />
gute Mutter oder guter Vater sein zu können, Schuldgefühle<br />
wegen ewig andauernder Arbeitslosigkeit zu haben,<br />
keinen Job zu finden, damals in der Schule schon nicht<br />
genug Ehrgeiz entwickelt zu haben, usw. Wir haben es mit<br />
Verzweiflung zu tun, mit Anspannungen, Unsicherheiten,<br />
mit einer großen Einsamkeit in vielen Familien, mit Hilflosigkeit<br />
und auch mit Beziehungslosigkeit.<br />
Aus diesen Gefühlen ergibt sich auch eine bestimmte<br />
Haltung und es ergeben sich soziale Folgen. Die ergeben<br />
sich direkt für uns, wenn wir mit unserem netten Hilfeangebot<br />
da stehen, denn da schlägt uns Abwehr und Verweigerung<br />
entgegen. Das ist ein Abschotten, Resignation<br />
und Hoffnungslosigkeit. Wenn ich von einigen Familien<br />
Geschichten höre, was sie schon alles probiert haben und<br />
wie es ihnen dabei ergangen ist, dann geht es mir als Profi<br />
seit vielen Jahren schon so, dass ich beinahe selber nichts<br />
mehr machen möchte. Warum sollte es Leuten, die ehrenamtlich<br />
tätig sind oder vielleicht nicht so viel damit zu tun<br />
haben, anders ergehen? Das heißt, da passiert auch was<br />
mit demjenigen, der Hilfe anbietet.<br />
Geheimhaltung ist ein großes Thema, insbesondere wenn<br />
es wirklich gefährlich werden kann, wenn das Beziehungsgeflecht<br />
innerhalb der Familie durch eine Hilfe in Ungleichgewicht<br />
geraten kann. Dann kann es sehr kritisch und<br />
gefährlich werden, also muss gedeckelt werden. Soziale<br />
Isolation, Beziehungs- und Bindungsverweigerung, das<br />
heißt, wenn es ein bisschen gemütlich wird,<br />
Unkenntnis über Hilfemöglichkeiten oder falsche Vorstellungen:<br />
Das einfachste Beispiel dafür ist das Jugendamt<br />
- was Leute fantasieren, was sich auf dem Amt tut oder<br />
nicht tut, das ist unglaublich. Da ist es toll, wenn es in<br />
einigen Bezirken die Möglichkeit gibt, ein bisschen Zeit<br />
aufzuwenden und eine offensive Arbeit zu machen, aufzuklären<br />
darüber, welche Möglichkeiten und Rechte Familien<br />
haben. Es gibt Familien, die bisher schlecht zum Zuge<br />
gekommen sind, übersehen worden sind, obwohl sie Hilfe<br />
ganz besonders nötig haben. Gerade bei denen kommt<br />
oft die Hilfe nicht an. Das ist etwas ganz Kompliziertes.<br />
Es wäre mal hochinteressant, bei Wellcome zu evaluieren,<br />
ob der Mut nach Hilfe zu fragen, bei diesen kritischen<br />
Familien vorhanden ist, ob sie sich überhaupt an so ein<br />
Projekt wenden. Denn sie erwarten ja keinerlei Hilfe.<br />
TN: Das ist ein ganz großes Problem bei Wellcome, weil<br />
keiner gerne um Hilfe bittet. Auch die normale Familie<br />
nicht, zumindest nicht in der Krise. In einer starken Position<br />
kann man gut um Hilfe bitten, wenn man sich gut<br />
fühlt. Aber wenn man sich schlecht fühlt, dann geht das<br />
viel schwerer.<br />
Beate Köhn: Dann gibt es das Gefühl der Außenbedrohung.<br />
Das kann darin münden, wenn in der Kita eine Erzieherin<br />
zu der Mutter sagt, dass das Kind schon wieder kein<br />
Frühstück dabei hat, dass die Mutter dann fadenscheinige<br />
Erklärungen sucht. Sie fühlt sich kontrolliert, was sogar zur<br />
Abmeldung des Kindes führen kann. Die Versagensängste,<br />
dass man eine schlechte Mutter sein könnte, schweben<br />
gerade über solchen Müttern, die in der Versorgung<br />
ihrer Kinder teilweise lückenhaft sind. Gegenüber dieser<br />
Außenbedrohung muss geleugnet werden, deswegen wird<br />
zum Beispiel gesagt: Ja, der hat heute Morgen wieder so<br />
ein Theater gemacht, dass er die Brote vergessen hat. Es<br />
gibt immer tausend andere Gründe.<br />
Die Autonomie von Eltern muss konsequent im Vordergrund<br />
stehen. Das Fehlverhalten von Eltern, das, was<br />
fehlt, sollte wirklich nur als ein Verhalten unter anderen<br />
beschrieben werden. Und nicht, wie es vielleicht Eltern<br />
in einer schlechten und schwachen Position empfinden,<br />
dass es um ihre Person geht. Immer wollen mir alle sagen,<br />
was ich zu tun habe. Da ist gleich ein Angriff drin. Es<br />
geht also nur um einen Ausschnitt aus dem elterlichen<br />
Verhaltensspektrum. Mit dem positiven Effekt, dass es<br />
auch immer eine Veränderungsdynamik gibt. Auch in Gefährdungsfällen,<br />
auch wenn es schon richtig haarig ist,<br />
wenn ein Kind geschlagen wird, wenn ein Kind alleine<br />
gelassen wird, z.B. die Aufsichtspflicht vernachlässigt<br />
wird, weil die Eltern nachts nicht da sind. Es gibt immer
auch eine andere, bessere Seite. In der Klärung muss<br />
man diese gute Elternseite ansprechen, gerade auch bei<br />
Eltern mit ganz kleinen Kindern ist die Chance groß, die<br />
Zustände bessern zu können. Man muss also schauen,<br />
was diese gute Eltern-Seite braucht. Es ist aber nicht gesagt,<br />
dass man das Problem im bestehenden familiären<br />
Kontext lösen kann. Aber es geht darum, die gute Seite<br />
erst mal im Kopf zu haben.<br />
Jeder in dieser Konstellation hat eine unterschiedliche<br />
Rolle, aus der heraus er agiert. Diese Rollen müssen geklärt<br />
werden. Welches ist Rolle und Aufgabe des Jugendamtes?<br />
Das ist auch die des Buh-Manns, das Wächteramt<br />
zu haben. Das haben nicht die Ehrenamtlichen, sondern<br />
das hat das Jugendamt. Die staatliche Gemeinschaft<br />
wacht über das Wohl der Kinder. Damit sind nicht alle gemeint,<br />
sondern das ist in Deutschland so geregelt, dass es<br />
ein Jugendamt gibt, das notfalls über das Familiengericht<br />
seine Maßnahmen durchsetzt. Aber der Job der Leute an<br />
der Basis, die den Kontakt zu den Kindern und den Eltern<br />
haben, ist es, eine Beziehung aufzubauen, um Familien<br />
davon überzeugen zu können, Hilfe vom Jugendamt, vom<br />
Nachbarschaftshaus oder von woanders anzunehmen.<br />
Natürlich ist Grundvoraussetzung bei Gefährdungsfällen,<br />
die Gefährdung realistisch einschätzen zu können und<br />
auch zu sehen: Halt, hier geht es über meine Kompetenz<br />
hinaus, das muss ich weitergeben. Allen, die direkt mit<br />
Kindern und Kleinstkindern zu tun haben, ist es wichtig,<br />
das zu vermitteln, das heißt, Rücksprache mit Fachleuten<br />
– unter dem 4-Augen-Prinzip -, die Absprache mit mehreren<br />
Fachkräften. Also Professionalität und Kooperation<br />
sind wichtige Punkte, neben dem Aspekt, die Beziehung<br />
aufzubauen.<br />
Der andere Aspekt ist das Stützen, Begleiten und Vernetzen<br />
und auch Standhalten. Wenn da jemand sagt: Nein,<br />
das will ich nicht, das sehe ich ganz anders, muss man<br />
dranbleiben, auch gegen den Widerstand von Scham, Verleugnung<br />
und Isolation muss man ruhig standhalten.<br />
Welche notwendigen Schutzmaßnahmen müssen gegebenenfalls<br />
eingeleitet werden? Liegen Dinge dabei auf<br />
derVerbrechensebene? Natürlich ist zu bedenken, dass<br />
Eltern, auch wenn Kinder kurz- oder langfristig aus der<br />
Familie genommen werden, immer Eltern bleiben und in<br />
ihrer Elternrolle extrem wichtig sind. Auch wenn das Kind<br />
gerade in einer Einrichtung oder im Heim untergebracht<br />
ist, behalten Eltern ihre Elternrolle, da geht es auch immer<br />
noch darum, die Beziehung zu halten, zu stützen. Es<br />
kann ja auch ein guter Schritt sein zu sagen, ich schaffe<br />
es nicht, ich werde das Kind in eine Pflegefamilie geben.<br />
Das kann eine hochgradig verantwortliche Entscheidung<br />
von Eltern sein.<br />
Jedes Problem ist ein Abfahrtsbahnhof zu einem Ziel. Es<br />
geht darum, aus dem jeweiligen Kontext mit der Familie<br />
einen Fahrplan zu erstellen, einen Veränderungsprozess<br />
in Gang zu setzen, und sei es nur in Gesprächen oder in<br />
kleinen Schritten. Wir müssen Wege aus der Hilflosigkeit,<br />
aus der Entmutigung und Resignation bauen helfen. Weil<br />
wir teilweise mit<br />
Familien zu tun haben,<br />
denen es so<br />
schlecht geht und<br />
wo viele Sachen<br />
sehr erdrückend<br />
sind, wo nebst<br />
Krankheit und<br />
Trennung und Gewalt<br />
und eigenen<br />
schlechten Erfahrungen<br />
und Arbeitslosigkeit noch andere Faktoren dazukommen.<br />
All das ballt sich zu einem unübersichtlichen<br />
Haufen, so dass man nur Schritt für Schritt gucken kann,<br />
wie ist da standzuhalten, um den nächsten Schritt zu finden.<br />
Man muss gemeinsam Ziele entwickeln, das können<br />
ganz kleinteilige Sachen sein. Eine Stabilisierung zu erreichen<br />
heißt: Nach Möglichkeiten zu suchen, wie Eltern<br />
über bestimmte Prozesse ihres Lebens wieder Kontrolle<br />
kriegen können. Schule, Schulden, Arbeit, all das sitzt<br />
ihnen im Nacken. Oder das Kind tanzt mir auf der Nase<br />
herum, der macht mich wahnsinnig. Das sind Momente,<br />
die gefährlich werden, wo die Situation im Affekt aus<br />
der Kontrolle geraten kann. Das Gefühl der Kontrolle ist<br />
wichtig, es muss in kleinen Schritten stabilisiert werden,<br />
durch die schrittweise Verwirklichung von Zielen. Das ist<br />
der Prozess, den wir begleiten und unterstützen.<br />
Diese Kompetenzstärkung, die Erfahrung, das ist erstaun-<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 45
46<br />
Workshop Verhindern, vermeiden, vorbeugen<br />
Verhindern, vermeiden ...<br />
lich, wenn Eltern dieses „Ich kann“ erfahren, ich kann<br />
in diesem Punkt eine gute Mutter sein usw., die ist sehr<br />
beeindruckend. Wenn sich z.B. das bisher übliche abendliche<br />
Chaos langsam beruhigt und die Mutter die Situation<br />
endlich im Griff hat. Es klappt nicht immer alles. Aber es<br />
gibt Dinge, die gehen jetzt.<br />
Auch Solidaritätserfahrung ist wichtig: Ich bin nicht alleine,<br />
es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen so. D.h. durch<br />
Elterngruppen, Seminare, nachbarschaftliche Unterstützung<br />
erfährt man Solidarität und findet gemeinsam Wege.<br />
TN: Für die Familienmitglieder ist es ganz wichtig zu wissen,<br />
woran sie mit mir sind. Wie ist meine Einschätzung?<br />
Wie ist mein Blick? Was ist meine Aufgabe? Welche Spielräume<br />
habe ich? Welches Ziel will ich gemeinsam mit der<br />
Familie für das Kind erreichen? Auf diesem Wege kann<br />
ich zum Erfolg kommen, trotz all dieser schwierigen Kinderschutzdiskussionen<br />
und Vorbehalte, die da sind.<br />
TN: Das Jugendamt Steglitz-Zehlendorf verschafft sich einen<br />
Vorteil: es wirbt für sich, verglichen mit anderen Jugendämtern.<br />
Ich habe das mal recherchiert, es gab nur zwei<br />
Jugendämter, die z.B. zum Thema Kinderschutz auf ihrer<br />
Website etwas geschrieben haben und eine Orientierung<br />
gaben. Das waren lediglich Spandau und Steglitz-Zehlendorf,<br />
alle anderen nicht. Die anderen Jugendämter sind gegenüber<br />
Leuten, die Probleme haben , verschlossener.<br />
Häufig ist der erste Satz bei einem Gespräch mit dem Jugendamt,<br />
wenn eine Mutter mit einem problematischen<br />
Kind kommt: Denken Sie bloß nicht, dass Sie von uns eine<br />
Wohnung kriegen können. Hinter so einer ablehnenden<br />
Äußerung steckt das Gefühl: es kommt noch jemand, der<br />
will was von uns. Irgendwie muss man aber doch an dem<br />
Denken der Leute ansetzen, was sie wollen und brauchen,<br />
an deren Sicht auf die Dinge. Wenn sie kein Problemempfinden<br />
haben, kann man wahrscheinlich nur ganz schwer<br />
einen gemeinsamen Ansatzpunkt finden. Wenn sie aber<br />
ein Problemempfinden haben, dann wird das Problem<br />
höchstwahrscheinlich anders wahrgenommen als ich es<br />
sehe. Sie sehen es anders, aber wenn ich da nicht rankomme,<br />
komme ich auch nicht durch ein Lösungsangebot<br />
ran, weil sie das auch nur als Bedrohung empfinden.<br />
TN: Es geht um unsere Haltung. Ich glaube, was oftmals<br />
fehlt, ist eine Reflektion darüber, warum wir diese Arbeit<br />
machen und was wir erreichen möchten.<br />
TN: Was diese Haltung betrifft: Einerseits hoffe und glaube<br />
ich, dass sich in letzter Zeit was geändert hat. Man muss<br />
sich realistisch ansehen, wie diese Familien alltäglich leben.<br />
Und das gilt ebenso für die Umstände, unter denen<br />
die Kollegen in den Jugendämtern arbeiten.<br />
Ich weiß, dass es dort Leute gibt, die sich wirklich von ihren<br />
Aktenbergen bedroht fühlen. Und jeden Morgen kann<br />
etwas in der Presse stehen. Es gibt Kollegen, die sagen:<br />
Wenn ich zur Arbeit komme, bin ich jedes Mal froh, wenn<br />
ich keinen Zeitungsausschnitt auf dem Tisch habe, dass<br />
sich eine Mutter aus meinem Kiez mit ihrem Säugling<br />
aus dem Fenster gestürzt hat. Denn damit kann ich jederzeit<br />
rechnen. Sie haben wenige Möglichkeiten. Es gibt<br />
Jugendämter, Spandau gehört dazu, die haben nicht mal<br />
intern ihre Computer vernetzt. Das heißt, es werden in der<br />
freien und öffentlichen Jugendhilfe zur Erfüllung dieses<br />
Schutzauftrages zu wenig Mittel zur Verfügung gestellt.<br />
Zur Veränderung der Haltung den Eltern gegenüber hat es<br />
Fortbildungen und Schulungen gegeben, da ist viel passiert.<br />
Heute heißt es: Eltern ins Boot, respektvolle Haltung<br />
gegenüber den Eltern, hoffentlich verankern sich diese<br />
Prinzipien. Aber wir wissen natürlich alle, dass es leichter<br />
gesagt als getan ist, Eltern aus diesem schwierigen Feld<br />
Respekt entgegen zu bringen. Diese Einstellung zu entwickeln,<br />
braucht Zeit und Geduld.<br />
TN: In unserem Nachbarschaftshaus haben wir ein Projekt<br />
zur Schulbegleitung von Roma-Kindern gemacht. Wir<br />
arbeiten mit den Familien zusammen, die keinen Kontakt<br />
zu den Jugendämtern haben, und dennoch oft dringend<br />
Unterstützung brauchen. Meine Kolleginnen versuchen,<br />
die Eltern darauf vorzubereiten, dass das Jugendamt helfen<br />
kann, also nicht als eine Bedrohung empfunden werden<br />
muss. Dann gehen diese Eltern schließlich mit uns<br />
zu den Jugendämtern. Und da läuft es andersrum, dass<br />
wiederum wir dafür sorgen müssen, dass die Jugendämter<br />
sich dem Problem überhaupt öffnen und in Kooperation<br />
mit den Eltern treten. Manche Migrantenfamilien haben
die Erfahrung gemacht, dass sie total abgebügelt werden.<br />
Oder sie waren beim Amt, niemand hat sie unterstützt, dann<br />
gehen sie auch nicht mehr hin. Wenn man hingehen will,<br />
dann muss man auf beiden Seiten sehr viel aufbrechen, um<br />
überhaupt wieder eine Bereitschaft dafür zu haben.<br />
Willy Eßmann: Ich möchte das unterstützen. Das ist ein<br />
extra Thema, das mit Migranten zu tun hat. Wir haben<br />
auch so ein Projekt, wo es darum geht, dass Kollegen<br />
von uns in Familien gehen und es erstmalig sozusagen<br />
dem Jugendamt ermöglichen, durch uns einen Kontakt zu<br />
solchen Familien zu bekommen. Das Projekt heißt „Kulturlotsen“.<br />
Die Jugendamtsmitarbeiter/innen bekommen<br />
dadurch Einblick in Lebenswelten, die ihnen trotz jahrelangen<br />
Kontaktes mit solchen Familien völlig fremd geblieben<br />
sind, weil sie sie nur in der künstlichen Welt ihrer Amtsstuben<br />
erlebt haben. Es gibt hier einen großen Nachhol- und<br />
Qualifizierungsbedarf.<br />
TN: Aber vielleicht braucht man ganz einfache Dinge. Ich<br />
hatte vor Kurzem ein prägnantes Erlebnis. Ich war zu einer<br />
Notfallbehandlung im Krankenhaus. Eine Ärztin hat zwar mit<br />
mir gesprochen, aber mir dabei in dreiviertel der Zeit den<br />
Rücken zugewandt, weil sie alles, was für die Untersuchung<br />
wichtig war, gleich in die Tastatur tippte und deswegen auf<br />
den Bildschirm guckte. Diese Ärztin bräuchte dringend<br />
eine Schulung in Körpersprache, um eine Ahnung davon<br />
zu bekommen, welche Nebenwirkung ihre Haltung auf den<br />
Patienten haben kann. Wenn bei den Jugendämtern eine<br />
ähnliche Situation entsteht, wenn dort als erstes dieser Erfassungsbogen<br />
ausgefüllt wird, dann wirkt dieses Verhalten<br />
sicherlich einschüchternd und abschreckend auf Eltern. Hier<br />
könnte eine Schulung für die Mitarbeiter helfen.<br />
TN: Vielleicht sollten die mal bei Karstadt eine Schulung<br />
für den Umgang mit Menschen machen ...<br />
TN: Das ist eine Super-Idee, ob bei Karstadt oder bei der<br />
Lufthansa, aber wir reden über Zeit und Geld. Ich will da<br />
nicht alles dran festmachen, aber ich glaube, dass hinter<br />
Qualität eine Menge steckt: Fortbildung, Empathie, Zeit<br />
usw. Ich habe Kollegen, die haben eine Bonbonschale auf<br />
ihrem Schreibtisch. Dann kommen Klienten und nehmen<br />
alle Bonbons raus. Dann könnten die Kollegen über den<br />
Tisch springen, die werden richtig sauer. Und was haben<br />
sie vorher erzählt? Sie werden nicht beachtet, sie müssen<br />
eine halbe Stunde rennen, um zum Kopierer zu kommen,<br />
sie haben kein Dienst-Handy, sie haben keinen vernünftigen<br />
Internet-Anschluss, sie werden nicht gewürdigt und<br />
sie haben die ganze Scheiße am Hals. Und in allen Familien<br />
grummelt es, wir haben es mit einer relativ heißen<br />
Situation hier in manchen Berliner Bezirken zu tun, da<br />
geht es rapide bergab, die Aggressionen steigen, auch bei<br />
den Klienten. Da ist richtig Bewegung drin. Da gibt es eine<br />
Menge Möglichkeiten zu schulen, neue Gedanken oder<br />
auch andere Strukturen reinzubringen. Das ist jetzt die<br />
Frage, wo sind die Ursachen für Verhaltensmängel? Was<br />
ist gewollt? Ein Mitarbeiter des Jugendamts sollte seine<br />
Aufgaben innerhalb seiner Arbeitszeit vernünftig erledigen<br />
können und nicht am Wochenende.<br />
TN: Ich denke, das hat mit gesellschaftlicher Wertschätzung<br />
zu tun, aber die ist nicht ausreichend vorhanden. Wie<br />
kann die hergestellt werden? Wie können wir Verständnis<br />
für unsere Aufgaben hervorrufen? Ich meine, da ist Sozialraumbezug<br />
und Transparenz ein wichtiger Ansatzpunkt.<br />
TN: Wenn es wirklich vorkommt, dass Kollegen an die 100<br />
Fälle auf dem Tisch haben, dann fehlt ihnen jede Grundlage<br />
für vernünftiges Arbeiten, dann können die einfach<br />
nicht mehr. Dann können sie nur noch sehen, wie sie irgendwie<br />
mit dem Leben davonkommen. Ich kann mir auch<br />
vorstellen, dass in so einer Stresssituation solche Unmöglichkeiten<br />
passieren. Das ist keine Entschuldigung, aber<br />
das ist eine Erklärung.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 47
48<br />
Workshop<br />
Zwischentöne<br />
Generationendialoge und Generationenverantwortung<br />
der Verantwortung, die wir in unserer Tätigkeit in Nachbarschaftshäusern<br />
und Stadtteilzentren auch für die<br />
verschiedenen Generationen haben.<br />
Inputs:<br />
Karl-Fried Schuwirth, Wiesbaden<br />
„Aktives Netzwerk im Alter“<br />
Bettina Zey (NBH Mittelhof) und Timm Lehmann<br />
(NBH Mittelhof, Mehrgenerationenhaus Zehlendorf-Süd)<br />
„Zeitzeugenprojekte - Begegnung von Grundschulkindern<br />
und Senior/innen“<br />
Barbara Rüster (GWV Heerstr. Nord, Berlin)<br />
„Die Glücksfee - Beispiel einer Generationenbegegnung“<br />
Andrea Brandt (Biffy Berlin - Big Friends for Youngsters e.V.)<br />
„Patenschaftsprojekt für Berliner Kinder“<br />
Moderation:<br />
Petra Sperling<br />
Petra Sperling: Unser Augenmerk richtet sich auf den<br />
Dialog zwischen den Generationen. Bei Älteren ist es ja<br />
heute häufig so, dass sie nicht mehr nahe bei ihrer Kernfamilie<br />
leben, sondern in anderen Städten. Wir müssen<br />
darum den Blick auf die Generationen erweitern, weil<br />
die alten Menschen, die im Gemeinwesen leben, oft<br />
keine Familie mehr haben. Auf der anderen Seite gibt<br />
es die Kinder, die den Kontakt zu alten Menschen dringend<br />
brauchen. Wir beschäftigen uns mit dem Dialog<br />
zwischen den Generationen, aber gleichzeitig auch mit<br />
Karl-Fried Schuwirth: Ich bin seit vier Jahren im Ruhestand,<br />
nach 30 Jahren Arbeit im Nachbarschaftshaus in<br />
Wiesbaden. Damals merkte ich, dass es ganz viel Ruhe<br />
gibt nach der hektischen Arbeitsphase. Ich habe mir nie<br />
darüber Gedanken gemacht, wie mein Leben als Rentner<br />
später mal aussehen würde, so wie ich mir keine<br />
Gedanken über meine Altersversorgung gemacht habe.<br />
Ich dachte über meine Rente: Ich habe bisher eingezahlt,<br />
jetzt seid ihr Jüngeren dran mit dem Einzahlen und davon<br />
lebe ich dann. Es wurde mir natürlich auch sehr schnell<br />
klar, dass es da ein paar Probleme gibt. Die demografische<br />
Entwicklung sieht in dieser Beziehung nicht gut<br />
aus, die steigende Lebenserwartung steht dem entgegen,<br />
dass die nächste Generation für die Renten aufkommen<br />
kann. Es ist wichtig sich Gedanken zu machen, wie es<br />
später aussieht. Ihr wisst alle, dass das ein heftiges Problem<br />
wird, sicher auch für euch, wie die Altersversorgung<br />
aussieht. Die Frage ist, wo sind da noch Kapazitäten? Es<br />
gibt eigentlich nur noch ganz wenige Möglichkeiten, Kapazitäten<br />
zu bekommen.<br />
Ich habe auf einmal gemerkt, dass ich als noch nicht<br />
so ruhebedürftiger Rentner Kapazitäten habe. Ich habe<br />
durchaus eine Lebensperspektive, die ersten 15 Jahre<br />
kann ich ganz viel geben von dem, was ich vielleicht<br />
in den nächsten 15 Jahren dann umso mehr brauchen<br />
werde. Da sind Kapazitäten. Ich habe Zeit. Ich kann hier<br />
für meine Altersversorgung etwas einbringen, meine Zeit,<br />
meine Hilfe.<br />
Es gibt eine ganze Menge Leute, die nichts mehr für<br />
die finanzielle Altersversorgung tun können, die aber<br />
ganz viel Zeit haben. Es gibt ganz viele, die nicht mehr<br />
richtig im Berufsleben integriert sind, die viel Zeit hätten,<br />
aber keine finanziellen Möglichkeiten. Da fühle<br />
ich mich sehr einig auch mit jüngeren Leuten, die im<br />
Augenblick keine Perspektive haben, um sich beruflich<br />
weiterzuentwickeln und die möglicherweise auch sehr<br />
viel Zeit haben. Wir haben Zeit, das zu geben, was wir<br />
später brauchen.
Und jetzt kommt ANIA. ANIA ist genau an der Schnittstelle,<br />
wo es darum geht, heute etwas einzubringen, was man<br />
später selber brauchen wird. ANIA ist das aktive Netzwerk<br />
im Alter. Viele von Euch kennen Tauschringe und deren<br />
Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Tauschringe.<br />
Tauschringe kranken oft daran, dass es eigentlich ein ausgeglichenes<br />
Verhältnis geben muss zwischen dem, was<br />
gegeben wird und dem, was genommen wird. Es gibt aber<br />
ganz viele, die viel geben wollen, die aber nichts brauchen.<br />
Deswegen ist dann das Konto nicht ausgeglichen, das ist<br />
das große Problem der Tauschringe.<br />
Wenn ANIA da ist, dann ist das kein Problem, denn das<br />
kann ich zeitlich völlig anders dimensionieren. Damit kann<br />
ich jetzt noch viele Jahre lang etwas geben, bevor ich später<br />
davon selber profitiere.<br />
ANIA ist auch eine Bank, mit einem Konto, auf das ich jetzt<br />
ansparen kann. Zu einem späteren Zeitpunkt kann ich es<br />
dann abrufen, nämlich dann, wenn ich Hilfe brauche. Jeder,<br />
der jetzt durch Hilfeleistungen einzahlt, tut etwas für<br />
seine Altersversorgung. Das ist eine Motivation, die sehr<br />
intensiv und ernsthaft betrieben werden kann, wirklich ein<br />
Stück Altersversorgung, ich kann wirklich etwas geben für<br />
das, was ich später brauchen kann. Wenn diese Bank meine<br />
Konten richtig führt. Ich brauche tatsächlich ein Stück<br />
Bürokratie, indem meine jetzigen Leistungen registriert<br />
werden, damit sie später als Guthaben da stehen, das ich<br />
dann abrufen kann.<br />
ANIA ist leider noch nicht da. ANIA kommt noch. ANIA muss<br />
kommen! Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit<br />
dazu beitragt, damit ANIA kommt. Was aber schon da ist:<br />
Es gibt ganz viele Netzwerke im Alter, fast jede Stadt hat<br />
solche Netzwerke. ANIA hätte die große Chance, eine Vision<br />
zu geben, in der alle diese Netzwerke ein Stück Zukunft<br />
haben, sich weiterzuentwickeln. Jeder kleine Tauschring<br />
hätte die Möglichkeit, sich als Filiale von ANIA, dieser großen<br />
Bank, zu fühlen, wenn es möglich wäre, dass all diesen<br />
kleinen Filialen Know-How, ein Programm, zur Verfügung<br />
gestellt würde, das es ermöglicht, die Tauschmöglichkeiten<br />
zu registrieren und zu sammeln. So lange ANIA noch nicht<br />
da ist, haben wir uns in Wiesbaden zusammengetan und<br />
ein Netzwerk im Alter etabliert. Das Nachbarschaftshaus<br />
ist mit von der Partie und einige andere Einrichtungen.<br />
Dieses Netzwerk zeichnet sich nämlich genau durch den<br />
Charme aus, dass fast keine Bürokratie nötig ist. Man<br />
kann sich als älterer Mensch, 55Plus, registrieren und<br />
einklinken. Man kann sich ganz schnell mit anderen Menschen<br />
verbinden, die ähnliche Interessen haben.<br />
In diesem Netzwerk gibt es ein Telefon, das Netzwerkhilfen<br />
vermittelt. Es gibt in diesem Netzwerk ganz viele, die<br />
sich als Helfer geoutet haben. Und es gibt ein Büro. Das ist<br />
eine Aktentasche, in der ein Handy und eine Liste stecken.<br />
Man kann zu jeder Tages- oder Nachtzeit dort anrufen, zwischen<br />
10 und 12 ist dieses Handy persönlich erreichbar.<br />
Dieses Handy – also das Büro – wird Woche für Woche<br />
weitergegeben, wir sind acht Leute, die dieses Büro betreuen,<br />
man kommt also alle zwei Monate dran, das ist<br />
machbar. Und außerdem ist es im Internet und man kann<br />
sich sehr schnell mit seinen Interessen verknüpfen.<br />
Meine Hoffnung ist, dass dieses Netzwerk – wie alle anderen<br />
Netzwerke – irgendwann sich wieder findet in ANIA,<br />
was bedeutet Aktive Netzwerke im Alter. Ich bin überzeugt,<br />
dass das die einzige Möglichkeit ist, um ein Stück der Vorsorgeproblematik<br />
zu bewältigen. Wenn ihr das auch so<br />
seht, würde ich mich freuen, wenn ihr unterstützt, dass<br />
ANIA kommt. Weitere Informationen können Sie aus dem<br />
<strong>Rundbrief</strong> entnehmen.<br />
TN: Was sind die Themen, die am meisten nachgefragt<br />
werden? Oder mit welchen Interessen kommen die Leute,<br />
die schon da sind? Hier steht eine ganze Liste, aber ist es<br />
das?<br />
Karl-Fried Schuwirth: Was da genannt ist, ist sehr repräsentativ.<br />
Dieses Netzwerk lebt eigentlich davon, dass es<br />
kein virtuelles Netzwerk ist, sondern dass die Leute sich<br />
begegnen. Das ist sehr wichtig, dass man sich wirklich<br />
persönlich begegnet. Merkwürdigerweise floriert in Wiesbaden<br />
besonders, gemeinsam die Wirtschaften zu erkunden.<br />
Das ist sehr beliebt und sicher auch ein Motor für<br />
vieles andere. Dabei wird dann zum Beispiel erzählt, dass<br />
jemand mit seiner Fernbedienung vom Fernseher nicht<br />
zurecht kommt, schon ist ANIA-Hilfe angesagt. Die Computergruppe<br />
hilft sich gegenseitig oder die Gruppe Praktische<br />
Philosophie, die durchaus auch Perspektiven über<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 49
50<br />
Workshop Zwischentöne<br />
Zwischentöne<br />
die Sinnhaftigkeit des Tuns oder des Lebens erörtert. Besonders<br />
gefragt sind gesellige Veranstaltungen, möglichst<br />
mit nicht so furchtbar viel Verbindlichkeit, wo man kommt,<br />
aber auch wieder gehen kann.<br />
TN: Ich komme aus Freiburg aus einem Stadtteilzentrum.<br />
ANIA ist überregional oder soll es überregional werden?<br />
Und worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist territorial<br />
auf die Stadt bezogen?<br />
Karl-Fried Schuwirth: Genau. ANIA ist eine große Sache.<br />
Wo kann ANIA überhaupt angesiedelt werden? Für mich<br />
ist ANIA in einem Wohlfahrtsverband besonders gut angesiedelt.<br />
Ich denke, der Paritätische wäre prädestiniert.<br />
Ich habe auch in dieser Richtung mal gebohrt und mich<br />
kundig gemacht und gemerkt, dass ein lebhaftes Interesse<br />
daran besteht.<br />
Der einzige Einwand, den ich mir vorstellen kann ist, dass<br />
natürlich in Wohlfahrtsverbänden auch professionelle Hilfen<br />
organisiert sind, für die das durchaus eine Konkurrenz<br />
sein könnte.<br />
TN: Ich komme vom Nachbarschaftshaus Schöneberg. Das<br />
klingt ja nach Leistung gegen Leistung, nach Aufrechnen<br />
und Abrechnen. Woher kommt genau diese Idee, in dieser<br />
Art zu formalisieren, dieses Ansparen und Abrufen?<br />
Karl-Fried Schuwirth: Ich glaube, dass eine ernsthafte<br />
Altersvorsorge auch ernsthaft installiert sein müsste. Es<br />
gibt ganz viel guten Willen bei den Menschen. Die werden<br />
sich nach wie vor auch ohne ANIA engagieren. Aber es gibt<br />
auch das Motiv, ein sehr existenzielles Motiv, nämlich etwas<br />
für die Altersvorsorge zu unternehmen. Ich denke, da<br />
braucht es wirklich diese Sicherheit, damit es eine Altersvorsorge<br />
wird, die ich auch berechnen kann.<br />
TN: Wenn ich mir überlege: Jetzt kann ich noch, ich pflege<br />
mal jemanden, ich moderiere mal einen Workshop, ich kann<br />
pro Woche fünf Stunden was tun. Dann gibt es jemand, der<br />
schreibt das in ein Buch, das kommt auf mein Konto. Also<br />
bekomme ich pro Monat 20 Stunden Guthaben. Das kann ich<br />
dann in meinem späteren Alter abrufen. Funktioniert das so?<br />
Karl-Fried Schuwirth: Ja, also es gibt ANIA bereits, zum<br />
Beispiel in einem Ort in der Nähe von Wiesbaden, Dietzenbach<br />
heißt der, hat 38.000 Einwohner. Dieser Ort hat<br />
2.000 Mitglieder von der Senioren-Selbsthilfegruppe, die<br />
genau so arbeiten, sich registrieren, aber nur im lokalen<br />
Bereich. Ich denke, diese Idee mit dem lokalen Bereich<br />
entspricht nicht der Mobilität der Gesellschaft. Wenn es<br />
im lokalen Bereich funktioniert, dann sollte es auch überregional<br />
funktionieren.<br />
TN: Das Prinzip kennen wir ja von Tauschbörsen. Was ist<br />
jetzt das Besondere an ANIA?<br />
Karl-Fried Schuwirth: Das Besondere ist der große Zeitunterschied.<br />
Das ist genau das Problem der jetzigen<br />
Tauschringe, sie kommen mit diesem Zeitunterschied<br />
nicht zurecht.<br />
TN: Was ja dazukommt, es muss ein hohes Maß an Verbindlichkeit<br />
gewährleistet sein. Man müsste wissen, dass<br />
diese Organisation in 10 Jahren noch existiert. Das setzt ja<br />
Strukturen voraus und Qualitätsstandards.<br />
Karl-Fried Schuwirth: Genau, eine Bank.<br />
TN: So etwas ist ja nicht neu. In der Geschichte gab es immer<br />
wieder bestimmte Nischen, Raiffeisenbanken haben mal so<br />
angefangen, Genossenschaften, eine Form von Selbsthilfe,<br />
wo bestimmten Notlagen mit genau solchen Modellen begegnet<br />
wurde. Ich finde, das ist eine ganz spannende Idee.<br />
TN: Aber es gibt doch schon so Komplementärwährungen,<br />
die auf diese Idee abzielen.<br />
Karl-Fried Schuwirth: Genau, nur sind die alle sehr, sehr lokal.<br />
Bei den Komplementärwährungen geht es darum, dass<br />
lokal tatsächlich auch gekauft wird, also dass Produkte<br />
oder Dienstleistungen der Region vermarktet werden. Das<br />
ist der Hintergrund dieser alternativen Währungen.<br />
TN: Steckt dahinter der Gedanke, Pflege zu organisieren?<br />
In Essen wurde das diskutiert.
Karl-Fried Schuwirth: Um das deutlich zu sagen: ANIA ist<br />
keine Antwort auf die Pflegebedürftigkeit. Aber davor ist<br />
ja noch sehr viel. Wir sind ja auch alle darum bemüht, so<br />
lange wie möglich zu Hause zu wohnen. Dafür ist ANIA eigentlich<br />
gedacht.<br />
Ich glaube, dass auch ANIA nicht nur eine virtuelle Datenbank<br />
ist, sondern ANIA braucht lokale Treffpunkte. Man<br />
muss sich kennen, wenn man sich gegenseitig hilft. Ich<br />
freue mich auch, dass es in Wiesbaden angefangen hat,<br />
dass unter dem Gesichtspunkt der Vorsorge für das Alter<br />
die Menschen sagen: Jetzt müssen wir uns kennen lernen.<br />
Für mich ist es ganz spannend, neue Leute kennen zu lernen<br />
und dass man sich in meinem Alter noch mit Menschen<br />
befreunden kann.<br />
Bettina Zey: Ich bin Mitarbeiterin im Nachbarschaftsheim<br />
Mittelhof in Berlin-Zehlendorf und dort in der Selbsthilfe<br />
und auch für die Seniorenarbeit zuständig.<br />
Timm Lehmann: Ich bin auch im Mittelhof tätig und leite<br />
dort ein Mehrgenerationenhaus, das dieses Jahr eröffnet<br />
hat. Vielleicht kann man an den demografischen Wandel<br />
und Generationenbegegnungen anknüpfen, so wie auch<br />
an die Tatsache, dass die Familienkonstellationen sich<br />
verändert haben. In unserer Tätigkeit ist es ja so, dass wir<br />
Begegnungen inszenieren, das heißt, wir schaffen etwas,<br />
was im natürlichen Bereich so nicht mehr oder immer<br />
weniger zustande kommt. Nämlich dass Generationen zusammenkommen<br />
und ihr Erfahrungswissen weitergeben<br />
oder überhaupt in den Austausch kommen.<br />
Bettina Zey: Unser Zeitzeugenprojekt entstand auf Initiative<br />
einer Grundschullehrerin. Sie hat uns angesprochen<br />
und gefragt, ob nicht die Senioren aus unserem Haus Lust<br />
hätten, in den Sachkundeunterricht zu kommen und sich<br />
als Zeitzeugen befragen zu lassen. Eine 4. Klasse hatte<br />
das Thema Krieg und Nachkriegszeit. Ich habe in Seniorengruppen<br />
nachgefragt und wir sind dann zu viert zur<br />
Schule gegangen. Wir wussten nicht genau, was uns da erwartet,<br />
welche Fragen kommen, wie wird diese Begegnung<br />
mit den Schülern sein, können wir den Fragen gerecht werden?<br />
Aber auch, was passiert, wenn bei den Zeitzeugen etwas<br />
aufbricht an Erfahrung, Erinnerung, Traumatisierung?<br />
Das war schon auch ein heikles Thema, was man dabei<br />
auch unbedingt berücksichtigen sollte. Wir zeigen einen<br />
kleinen Filmausschnitt von dieser Begegnung.<br />
Filmausschnitt: Senioren in der Schulklasse, Seniorin erzählt<br />
von ihrem Vater, der im Krieg war, während die Familie<br />
bei Alarm in den Bunker musste.<br />
Bettina Zey: Das Ganze ging zwei Stunden – mit einer<br />
kurzen Pause. Wir haben festgestellt, dass auch in der<br />
Pause und danach interessante Gespräche stattgefunden<br />
haben. Die jungen Leute konnten sich gar nicht trennen.<br />
Sie sind auf die Senioren zugestürzt und hatten noch ganz<br />
viele Fragen. Das war sehr spannend und auch bewegend.<br />
Die Senioren hatten auch so ein Mitteilungsbedürfnis<br />
dann gehabt, dass wir gedacht haben, dass wir noch etwas<br />
anderes machen müssen.<br />
TN: Wessen Idee war es denn, diese Begegnung als Podiumsdiskussion<br />
zu machen?<br />
Bettina Zey: Das ist von der Schule so eingerichtet worden.<br />
Wir sind da wirklich einfach hin, wir hatten keine Ahnung,<br />
wie die Sitzordnung ist. Das war ja Frontalunterricht.<br />
Die Fragen der Schüler wurden schon im Unterricht entwickelt<br />
und waren vorbereitet, aber für uns war es total<br />
unvorbereitet. Wir wollten gerne die Kinder mehr einbeziehen,<br />
damit ein wirklicher Dialog entstehen konnte. Dazu<br />
möchten wir Ihnen jetzt noch kurz etwas zeigen.<br />
Letzte Woche waren wir mit einer anderen Seniorengruppe,<br />
die aufgrund des Films gesagt hat: Wir wollen auch so<br />
was machen, wir haben auch viel zu erzählen, in einem<br />
Kinder- und Jugendfreizeithaus, das ist eine nachschulische<br />
Betreuung. Die haben uns zum Thema „Schule,<br />
Freizeit und Spiele früher und heute“ eingeladen. Da sind<br />
wir hin. Die Senioren haben von ihren Schulerlebnissen<br />
erzählt, wie der Unterricht war, zum Beispiel, dass von der<br />
1. bis 8. Klasse alle zusammen in einem Raum waren,<br />
unvorstellbar heutzutage. Schule während der Kriegszeit<br />
war natürlich auch ein Thema. Aber was der Renner war,<br />
wo alle angetan waren, das waren die Spielgeräte von da-<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 51
52<br />
Workshop Zwischentöne<br />
Zwischentöne<br />
mals. Die Senioren hatten Bänder mitgebracht, das nennt<br />
man „Abnehmen“. Sie haben das den Kindern gezeigt,<br />
das ist eine Woche her. Gestern habe ich die Erzieherin<br />
getroffen, die dabei war. Sie sagte, dass die Kinder immer<br />
noch mit den Bändern rumrennen und spielen.<br />
Auch die Kinder haben ihr Spielzeug gezeigt. Die Jüngsten<br />
waren 6, die Ältesten waren 10. Sie haben zum Beispiel<br />
den Damen ihre Kuscheltiere gezeigt. Oder die Jungs<br />
hatten irgendwelche Monsterroboter gezeigt, womit eine<br />
Dame erst mal gar nichts anfangen konnte. Oh weia, was<br />
habt ihr denn für Spielzeug? sagte sie, weil ja auch nicht<br />
alle Enkelkinder haben. Ich hatte immer wieder Vorurteile<br />
von den Senioren gehört: Ach, die interessieren sich doch<br />
sowieso nicht für uns, was wollen wir da? So ging das<br />
manchmal los. Und im Nachhinein waren sie begeistert,<br />
wie interessiert die Kinder sind, mit was für Fragen sie<br />
kommen. Das Schönste ist dann einfach zu hören: Ja, die<br />
sind ja doch interessiert und wollen was von uns wissen.<br />
Und wir können denen was erzählen. Ich kann nur sagen,<br />
dass kleine Gruppen, gemischt, wirklich gut funktionieren,<br />
besser als dieses Frontale.<br />
Timm Lehmann: Der Austausch mit der Kriegsgeneration<br />
ist aus meiner Sicht einseitig. Aber wenn man diesen Dialog<br />
will, dann ist es besser, kleinere Gruppen zu haben<br />
und Material zum Herumreichen, damit man gemeinsam<br />
etwas anschaut. In einer kleinen Gruppe gibt es mehr<br />
Möglichkeiten zum Nachfragen. Wenn ich ein Plenum mit<br />
20 Kindern habe, ist das so nicht möglich. In einer kleinen<br />
Gruppe entsteht eher ein Dialog. Ich habe als Kind auch<br />
etwas zu berichten, was du lernen kannst, wie es heute<br />
bei uns abgeht.<br />
Bettina Zey: Es war schön zu sehen, dass doch Gemeinsamkeiten<br />
da sind, dass die Schulstreiche von früher<br />
immer noch auch die Schulstreiche von heute sind: Der<br />
nasse Schwamm, auf den sich Lehrer setzen, ihn hinzulegen,<br />
der Lehrer setzt sich drauf; wo erzählt wurde,<br />
dass sie das mittlerweile auch mit Furzkissen machen.<br />
Die haben sich auf beiden Seiten amüsiert. Sie haben<br />
sich auch interessiert für Schulfotos, die herumgereicht<br />
wurden. Da kam ein kleines Mädchen mit einem Bild<br />
nach vorne: Was haben die jungen Mädchen denn da<br />
auf dem Kopf? Früher hatten die so Propeller-Schleifen,<br />
das hat sie so fasziniert, dass sie wirklich nachfragen<br />
konnten, auch wie sie verstehen, dass sich das im Laufe<br />
der Jahre verändert.<br />
Wir waren in einem anderen Kinder- und Jugendclub, da<br />
war das Besondere, dass die Jüngste 6 Jahre alt war und<br />
der Älteste 14. Wir haben uns durch ein gemeinsames<br />
Frühstück kennen gelernt, was alles auflockerte. Dann<br />
sind wir nach nebenan in einen Raum gegangen, wo die<br />
Senioren wieder von Schule früher berichteten, Spiele<br />
früher. Da war es so, dass die Senioren nachher kaum<br />
noch zu Wort gekommen sind, weil die Kinder so viel<br />
zu erzählen hatten von ihrer jetzigen Situation an den<br />
Schulen. Da waren die Damen nachher ganz enttäuscht,<br />
weil sie meinten, sie hätten noch viel, viel mehr erzählen<br />
können. Sie wollen dann noch mal zu einem nächsten<br />
Treffen dorthin gehen.<br />
Timm Lehmann: Hier gab es von den Kids aus dem Club<br />
eine kleine Aufführung, als Pause, um mal Bewegung reinzubringen.<br />
Nicht, weil es sie nicht interessiert, sondern<br />
altersgemäß brauchen sie eine Pause.<br />
Bettina Zey: Im November 2008 haben wir ein Treffen im<br />
Mehrgenerationenhaus, am späten Nachmittag, wo das<br />
ein ganz anderes Thema ist, weil das eher Jugendliche<br />
sind. Das Thema ist dann „Jugendzeit früher und heute“.<br />
Heutzutage geht es ja um Idole, Musik, Tanz, Verabredungen,<br />
die ersten Liebschaften, im Vergleich zu dem,<br />
wie das früher war, was in war und was heute in ist. Mal<br />
gucken, was kommt.<br />
Der Nebeneffekt für die Senioren ist natürlich auch, dass<br />
sie auf diese Weise eine Einrichtung kennen lernen. Sie<br />
bekommen dann gleich auch eine Hausführung, wie die<br />
nachschulische Betreuung gemacht wird, was da angeboten<br />
wird. Das ist für sie eine ganz neue Welt. Das gab es ja<br />
damals alles nicht.<br />
Barbara Rüster: Meine persönliche Motivation für meine<br />
Arbeit habe ich schon von Kindesbeinen an, weil ich<br />
nämlich immer schon gerne Theater gespielt habe. Das
zieht sich durch mein Leben und hat mich geprägt. Ich<br />
war sehr lange an der Universität der Künste und habe<br />
dort Theaterpädagogik gemacht und habe dann dort<br />
aufgehört. Und jetzt habe ich gedacht, oh Gott, was mache<br />
ich mit dem Rucksack voller Dinge, die ich gemacht<br />
habe? Durch einen Zufall gab es einen Versuch, ein Kieztheater<br />
anzubieten. Ich gehöre sozusagen zu den Alten,<br />
und die Frage ist: Was passiert im Zusammenspiel mit<br />
den Jüngeren?<br />
Es gibt viele Möglichkeiten sich auszudrücken: mit Musik<br />
oder Bauen oder Performance machen. Aber ich habe<br />
überlegt, was man in einer gemeinsamen Theateraktion<br />
machen kann, weil das mein Handwerk ist.<br />
Das Projekt begann mit einer Kooperation zwischen der<br />
Kindertagesstätte „Wunderblume“ und einem Seniorenwohnhaus<br />
am Maulbeerweg in Staaken. Das gemeinsame<br />
Thema, was beide Bereiche hatten, war „Das Glück“. Ich<br />
fand es interessant, dass für Kinder Glück so abstrakt ist,<br />
während die Älteren dazu wunderbare Geschichten erzählt<br />
haben. Wir haben einen Videofilm darüber gemacht,<br />
wie sie über ihre Glückserfahrungen sprachen. Für die<br />
Kinder bestand der konkrete Ausdruck von Glück in der<br />
Glücksfee. Die Glücksfee haben wir zusammen gespielt.<br />
Die Älteren, die auch an dem Thema gearbeitet haben,<br />
sind in die Kita gegangen. Wir haben dann Warm-Ups gemacht,<br />
einfache Übungen, Klatschen, auch Kinderspiele,<br />
mit den Älteren zusammen. Das war am Anfang. Im Spiel<br />
selber haben auch einige mitgespielt: ein Herr hat den<br />
Baum von Frau Holle gespielt, eine Dame hat die Frau<br />
Holle gespielt, sie haben direkt in die Handlung mit eingegriffen,<br />
denn das war ja das Prinzip. Das ist nicht ganz<br />
leicht.<br />
Das war wunderbar und einzigartig. Aber die Situation ist,<br />
dass die Älteren oft sehr, sehr alt sind. Der Herr war schon<br />
86, die andere 76. Die wurden dann auch innerhalb kurzer<br />
Zeit sehr krank. Unter solchen Bedingungen kann man<br />
kein richtiges Theater aufbauen, was ich eigentlich wollte.<br />
Aber es waren dann doch einige, die über zwei Jahre an<br />
dieser Theaterarbeit teilgenommen haben.<br />
Die Kita und die Senioren zusammen, das war der Anfang,<br />
sie spielen zusammen und machen Theater auf<br />
eine ganz einfache Weise. Ich habe schon viel probiert,<br />
aber das fand ich fast das Konstruktivste, es waren immer<br />
dieselben Älteren und Kinder. Die kannten sich und<br />
freuten sich, das war so beglückend für die Kleinen,<br />
denn sie haben teilweise ja keine Großeltern mehr, aber<br />
sie lieben die Älteren, da wurde umarmt und gedrückt.<br />
Ich weiß nicht, offenbar spielen Großmütter und Großväter<br />
doch eine Rolle im Leben der Kinder. Hier war es<br />
so, dass wir zusammen ein Theaterstück gesehen haben,<br />
Däumelinchen, das hatten auch Theaterpädagogen<br />
von der UDK gemacht. Die Älteren und die Kinder gingen<br />
zusammen ins Kulturhaus Spandau. Hinterher haben<br />
wir das dann nachbereitet, mit einem der Schauspieler,<br />
der auch ein sehr guter Musiker ist. Die Lieder, die in<br />
„Däumelinchen“ vorkamen, haben wir zusammen gesungen,<br />
aber auch richtige Tänze aufgeführt. Ich werde<br />
heute noch angesprochen, ob wir das nicht wieder mal<br />
machen.<br />
Mit den Hortkindern aus dem Spielhaus haben wir dann<br />
ein Stück entwickelt. Das haben die Kinder selbst entwickelt<br />
und hieß „Hilfe, Paula ist verschwunden“. Das war<br />
ein sehr interessantes Projekt. Da haben die Älteren, so<br />
ähnlich wie das, was wir gerade gehört haben, ihre Geschichten<br />
aus der Jugend erzählt. Das wurde mit eingebaut.<br />
Es gab nämlich dann eine Schiffspassage, wo sie<br />
alle auf der Suche nach Paula waren. Die Älteren fragten<br />
die Kinder in allen möglichen Rollen, Feuerschlucker oder<br />
Zirkus oder Tiger, und die Älteren haben den Kindern Geschichten<br />
erzählt. Das war ein bisschen schwierig, weil<br />
die Kinder nicht so lange zuhören können, aber man kann<br />
ihnen auch mal was abverlangen. Es war interessant,<br />
aber es war nicht so leicht, denn die Älteren identifizieren<br />
sich mit ihren Geschichten, wie ein Schauspieler auch,<br />
da ist es natürlich schwer eine Passage zu kürzen. Deswegen<br />
haben wir sie dann in aller Fülle ihre Geschichten<br />
erzählen lassen, das war auch für die Zuhörer sehr interessant.<br />
Das Bühnenbild haben praktisch die Schüler vom Gymnasium<br />
gemacht, so dass wir das alles zusammengenommen<br />
haben als eine Form von Kieztheater. Das Ziel wurde<br />
immer mehr ein Kieztheater. Das professionelle Theater<br />
hat ja eine unglaubliche Wandlung durchgemacht, genauso<br />
sehr wie sich heute die Erziehungswissenschaft<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 53
54<br />
Workshop Zwischentöne<br />
Zwischentöne<br />
und Pädagogik mehr dem Theater zuneigen. Das sind die<br />
Fahnenträger für die Theaterpädagogik, weil Vorschullehrer<br />
nicht mehr in Theater ausgebildet werden. Aber<br />
die Fachhochschulen haben es begriffen, denn von dort<br />
werden exzellente Theaterpädagogen überall hin entlassen<br />
und sie können die Landschaft verändern. Das sind<br />
Paradigmenwechsel.<br />
Die Paradigmenwechsel gibt es auch im Theater selber.<br />
Das Theater geht raus, es verlässt sein Haus und geht in<br />
die Welt. Und so hat das Kieztheater das hier auch probiert.<br />
Es geht natürlich immer um Alt und Jung, die Verbindung<br />
war im Hinterkopf. Die Älteren erzählen den Kleinen,<br />
die Kleinen spielen mit den Älteren. Die Älteren erzählen<br />
Geschichten, zum Beispiel „Der Riese Riesig“, also Oscar<br />
Wilde. Das Erzählen wird dann auch szenisch bearbeitet.<br />
Manchmal ist es nur einer, manchmal drei oder vier, die<br />
das Projekt steuern. Einer macht Musik, der andere mehr<br />
szenische Sachen, der andere macht die Kostüme usw.<br />
Wir haben ja Glück, dass wir das durch das Quartiersmanagement<br />
finanziert bekommen, sonst würde das gar<br />
nicht gehen.<br />
Dadurch konnten wir uns auch wie ein Tintenfisch in dem<br />
Kiez ausbreiten und da und dort bestimmte Aspekte wie<br />
selbstbestimmtes Handeln entstehen lassen. Unsere<br />
Gesellschaft wird ja so fremdbestimmt, dass es ein bestärkendes<br />
Gefühl ist, wenn man plötzlich die eigene<br />
Kraft spürt, dass man auftreten kann, dass man was sagen<br />
kann, ich kann mit anderen gemeinsam etwas entwickeln,<br />
ich halte durch. Es gibt auch Frust. Aber wenn<br />
der Vorhang aufgeht, das Licht angeht, und dann die Älteren<br />
da sitzen und zugucken, dann ist der Frust vergessen.<br />
Die Kinder sehen, die Älteren können Geschichten<br />
erzählen, sie können was erfinden, sie können mit ihnen<br />
spielen, sie sind nicht irgendwie abgeschrieben. Sie sind<br />
lebendig und ein Bestandteil des Kiezes, in dem sie zur<br />
Geselligkeit beitragen, was mir sehr wichtig ist.<br />
Diese Form des Theaterspiels ist für mich auch eine Form<br />
von politischem Handeln. Dass man erlebt, dass Theater<br />
als Kunst nur funktionieren kann, wenn man zusammen<br />
spielt und wenn man den Dialog aufnimmt zu denen, die<br />
zuschauen.<br />
Petra Sperling: Wir haben zwei Arten kennen gelernt, in<br />
einen Generationendialog zu gehen. Jetzt ist Zeit für Fragen<br />
und Anregungen.<br />
TN: Ich bin vom Mütterzentrum Mehrgenerationenhaus<br />
in Braunschweig. Frau Rüster, ich würde gerne wissen, ob<br />
man das auch ohne Fachkenntnisse umsetzen könnte?<br />
Barbara Rüster: Nein. Ursprünglich haben wir in Schulen<br />
gespielt. Dann wurde dies von Frau Laurien abgeschafft,<br />
die sagte, dass jeder deutsche Lehrer spielen könnte. Dass<br />
jeder Lehrer spielen kann und das nicht lernen muss, das<br />
finde ich nicht, weil das sehr kompliziert ist. Wenn man<br />
wirklich den Klassenverband im Spielen auflöst, was da<br />
alles an Emotionen hoch kommt und was alles passiert,<br />
das muss man echt lernen.<br />
Aber deswegen bin ich ja sehr froh, dass bei den Fachhochschulen<br />
auch sehr viele in Theaterpädagogik ausgebildet<br />
werden. Und es gibt außerdem immer Begnadete, die das<br />
können. Also sehr große Theaterleute hatten gar keine<br />
Ausbildung, die haben das einfach gemacht. Man sollte<br />
nicht sagen, dass es nicht geht, aber ich denke schon, es<br />
sollte eine Vorbildung geben. Ich habe Fortbildungen für<br />
Erzieher gemacht, damit Theater über sie wieder in die Kitas<br />
geht, und ich habe auch Lehrer fortgebildet, wir haben<br />
auch mit Lehrern und Erziehern zusammengearbeitet. Es<br />
gibt eben auch nicht die typischen Alten, eine ganze Reihe<br />
von ihnen ist quasi gar nicht alt.<br />
Timm Lehmann: Eine kurze Anmerkung zum Thema Fachhochschule:<br />
Wir haben bei uns im Mehrgenerationenhaus<br />
eine Kooperation mit der Evangelischen Fachhochschule,<br />
die genau so einen Studiengang haben. Die müssen auch<br />
etwas Praktisches machen, sodass sie ihren Praxisteil bei<br />
uns im Haus gemacht haben. Das könnte ein Potenzial<br />
sein, das man nutzen kann.<br />
TN: Ich arbeite im Quartiersmanagement. Meine Begeisterung<br />
spare ich mir jetzt auf Grund der Zeit, aber klasse!<br />
Ist in den Projekten die direkte Sprache zwischen den<br />
Generationen ein Thema? Das ist etwas, was uns gerade<br />
beschäftigt, weil wir wirklich Jugendliche haben die sagen,
also es gibt so viele Bücher über den Jugendslang, aber<br />
wir verstehen zum Teil die Alten gar nicht mehr mit ihren<br />
komischen Begriffen, die die haben. Ist das Problem da<br />
aufgetaucht? Oder gibt es andere Erfahrungen dazu?<br />
TN: Es gibt doch ein Wörterbuch, wo die ganzen Trendwörter<br />
drin stehen.<br />
TN: Es geht nicht um die Worte, die Trend sind, sondern<br />
es geht um ein Wörterbuch für die Jugendlichen, damit sie<br />
die ältere Generation verstehen.<br />
TN: Ich habe noch eine Frage an Bettina: Gibt es Ideen,<br />
von eher singulär inszenierten Begegnungen zu einer Regelmäßigkeit<br />
zu kommen?<br />
Bettina Zey: Wir sind ja gerade im Aufbruch, wieder daran<br />
zu arbeiten. Wir haben jetzt demnächst Begegnungen, das<br />
sind zusammengewürfelte Gruppen, Mitglieder von Seniorengruppen,<br />
die sich gar nicht untereinander kennen. Wir<br />
wissen nicht, wie viele Jugendliche kommen werden, vielleicht<br />
fünf, keine Ahnung. Aber in den Einzelgesprächen in<br />
den Pausen hat man die Chance, zu jemand hinzugehen.<br />
TN: Ich bin Projektkoordinatorin im Projekt „Agenda<br />
2010“. Wir arbeiten genau so. Ich finde es spannend, über<br />
diese Kombination aus Zeitzeugenarbeit und Theaterprojekt<br />
zu hören. Unser Projekt ist auf 2 ½ Jahre angelegt,<br />
dass sie einander begegnen. Insgesamt sind es sechs<br />
Schulklassen, die sich jeweils bei einem oder zwei Treffen<br />
im Jahr begegnen. Wir haben einen Pool von 22 Freiwilligen,<br />
die dabei sind. Unsere Erfahrungen sind sehr unterschiedlich,<br />
weil die Klassen sehr unterschiedlich sind.<br />
Es gibt einerseits die Schüler, die so engagiert sind und<br />
auf die Erwachsenen zugehen, wie Sie es beschrieben haben.<br />
Aber es gibt auch andererseits eine Schulklasse, bei<br />
der ich aufgrund ihrer Stumpfheit doch sehr erschüttert<br />
war. Dieses Fernsehen! Die Kinder haben davon berichtet,<br />
dass sie abends um 23 Uhr Wrestling gucken. Und in der<br />
Art und Weise sind sie auch miteinander umgegangen.<br />
Das war eine ganz große Schwierigkeit, da Ruhe herzustellen,<br />
um überhaupt das Erfahrungswissen der Älteren zum<br />
Vorschein zu bringen, was ja das Anliegen des Ganzen<br />
war, und überhaupt eine Kommunikation zu ermöglichen.<br />
Wir waren bei dieser Klasse eher mit Konfliktmanagement<br />
beschäftigt. Wir haben da eine Emotionsdusche gemacht,<br />
um eine positive Atmosphäre herzustellen, damit da überhaupt<br />
menschlich was passieren konnte. Andererseits war<br />
eine projekterfahrene Klasse da, die fanden das ganz nett,<br />
wollten aber noch mehr machen, waren sehr engagiert.<br />
Das heißt, das Leistungsgefälle und die Anforderungen<br />
waren sehr unterschiedlich.<br />
Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ob man Theater<br />
nicht einfach auch so machen kann, ohne spezifische<br />
Ausbildung - da würde ich eindeutig Nein sagen. Aber ich<br />
merke, selbst unsere ausgebildeten Leute, die viele Projekttage<br />
an Schulen gemacht haben, können ihre Fähigkeiten<br />
noch weiterentwickeln, weil die Anforderungen an<br />
sie sehr unterschiedlich sind. Es ist aber auch ein Thema,<br />
welche Erinnerungen bei den Älteren hochgeholt werden.<br />
Wir machen deshalb extra Vorbereitungstreffen mit den<br />
Älteren, um erst mal ins Thema zu kommen. Mich hat es<br />
schon überrascht, was auf einmal bei dem Thema „Schule<br />
früher und heute“ alles bei den Älteren hochkam. Das<br />
müssen wir auf jeden Fall vorbearbeitet haben, damit sie<br />
da nicht im Übermaß in Tränen ausbrechen. Da sind einige<br />
Dinge zu beachten, weshalb es wichtig ist, dass es schon<br />
professionelle Leute machen.<br />
TN: Bei uns gibt es seit Kurzem ein Erzählcafé. Da wollte<br />
ich einfach mal etwas von den Erfahrungen der Senioren<br />
hören. Ich war total überrascht und auch schockiert, dass<br />
die 30- oder 40-Jährigen das Erzählcafé verlassen haben,<br />
weil die Senioren scheinbar cool und abgebrüht von der<br />
Judendeportation berichtet haben. Also wir mussten dann<br />
die Gefühle der jüngeren Generation aufarbeiten, das war<br />
für mich eine ganz neue Erfahrung, auf die ich nicht gefasst<br />
war.<br />
TN: Bei uns existiert ein Gesprächskreis zwischen den<br />
Generationen. Der entstand schon vor längerer Zeit. Wir<br />
bereiten die jeweiligen Treffen in Gesprächen mit den Senioren<br />
vor. Die Schule hatte zum Beispiel das Thema Nationalsozialismus<br />
mit den Schülern vorbereitet. Wir hatten<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 55
56<br />
Workshop Zwischentöne<br />
Zwischentöne<br />
dann ein von der Schule und von mir angeleitetes Treffen,<br />
wo die Schüler und die Erwachsenen sich bei einem<br />
Kaffee vorgestellt haben. Dann haben wir zusammen zu<br />
dem Thema gearbeitet. Darüber ist übrigens auch ein sehr<br />
schöner Film entstanden, mit Erzähleinheiten. Nachher<br />
haben die Schüler die Geschichten in Schwarz-Weiß hinterlegt<br />
und immer mit Musik gewechselt. Das war sehr<br />
beeindruckend.<br />
Am besten läuft es, wenn eine Projektgruppe aus einer<br />
Jahrgangsstufe 8 oder 9 da ist und nicht eine ganze Klasse<br />
teilnimmt. Sonst ist da ständig Unruhe und die Schüler<br />
sind nicht so motiviert. Dieses Projekt Nationalsozialismus<br />
endete dann mit einer gemeinsamen Fahrt nach Weimar,<br />
weil die Schüler mit dem Film einen Preis gewonnen hatten.<br />
Während dieser Fahrt ist ganz viel aufgebrochen, bei<br />
den Schülern und bei den Erwachsenen, nachdem wir<br />
auch das Konzentrationslager dort besichtigt haben. Aber<br />
da war Zeit, das aufzufangen.<br />
TN: Was die Sprache angeht, stehe ich in der Mitte, ich<br />
verstehe manchmal die Jungen nicht und die Alten auch<br />
nicht. Aber als Problem ist mir das noch nicht begegnet.<br />
Ich glaube, der Schlüssel zum Verstehen liegt im gegenseitigen<br />
Respekt: Wenn ich verstanden werden will, muss ich<br />
mich bemühen, so zu sprechen, dass man mich verstehen<br />
kann. Das muss für alle gelten.<br />
Wir versuchen Nachhaltigkeit der Begegnungen uninszeniert<br />
hinzukriegen, indem wir unser Haus als Begegnungsstätte<br />
sehen, das sich aus einer Jugendeinrichtung entwickelt<br />
hat. Das Haus ist erst mal besetzt mit Kindern und<br />
Jugendlichen, als Mehrgenerationenhaus, das ist für ein<br />
Mehrgenerationenhaus ein Vorteil. Die Begegnung der<br />
Generationen findet vor Ort statt, da das Haus von allen<br />
genutzt wird. Und dort kann man sich am Tresen austauschen.<br />
Es geht darum, aktuelle Sachen aufzugreifen, Probleme<br />
mit der Schule, mit der Arbeit oder sonst was, dafür<br />
ist immer der Raum da.<br />
Barbara Rüster: Das mit den Zeitzeugen, das finde ich<br />
alles sehr wichtig. Wichtig ist auch die Balance, dass die<br />
Älteren sehen, aha, sie sind als Alte nicht mehr, was sie in<br />
der Vergangenheit waren.<br />
TN: Ich würde gerne noch stärker hervorheben, dass bei<br />
diesem Beispiel die alten Menschen die Erfahrung haben<br />
machen können, dass sie jetzt agieren können, da<br />
sind, wach sind, eine Aufgabe oder eine Rolle haben. Ich<br />
denke, das ist bei diesem Projekt das Besondere, weil es<br />
in der Jetzt-Zeit erlebt wird und sie auch noch Lernen und<br />
Wachstum erleben können, dadurch, dass sie eben in diese<br />
Rollen reinfinden müssen.<br />
TN: Wir haben im Haus der Generationen und Kulturen<br />
Am Schlaatz gerade ein Projekt begonnen, das nennt sich<br />
„Gelebte Erinnerung“. Da geht es um einen ähnlichen<br />
Ansatz. In unserem Projekt geht es darum, dass Kinder<br />
einer 6. und einer 7. Klasse die Geschichte am Thema<br />
„Schulerfahrungen von Erwachsenen“ lebendig werden<br />
lassen. Da sind die Erwachsenen die Erzähler, die Kinder<br />
sind die Interviewer, und am Ende wird kreativ dargestellt,<br />
wie es damals war. Und damit soll auch die Geschichte<br />
des Stadtteils lebendig werden. Aber dann geht es im eigentlichen<br />
Hauptteil darum, dass die Kinder mit den Älteren<br />
zusammen die Schule der Zukunft erarbeiten und<br />
die Vision der Schule der Zukunft als Theaterspiel, als<br />
Skulptur oder als Bild oder als alles Mögliche umsetzen<br />
und präsentieren.<br />
TN: In Wiesbaden gibt es unheimlich viele jüngere Senioren,<br />
die ganz viele Fähigkeiten einbringen. Es sind jetzt<br />
„Singpaten“ entstanden, die in Kindergärten und Altenheime<br />
gehen und dort singen und klatschen.<br />
Andrea Brandt: Ich stelle heute das Patenschaftsprojekt<br />
„Biffy“ in Berlin vor. Ich reiche unseren Flyer herum und<br />
verweise auf unsere Homepage, die recht umfassend ist<br />
und auch einen kleinen Film enthält von einem Beispiel<br />
unserer Arbeit, ein Interview mit einer Mutter, einem Paten<br />
und einem Kind.<br />
Ich bin immer in einer Doppelfunktion unterwegs. Und<br />
zwar leite ich die Freiwilligenagentur in Kreuzberg-Friedrichshain,<br />
da gibt es eine gemischte Trägerschaft, aber<br />
der Hauptträger ist das Nachbarschaftshaus Urbanstraße.<br />
Biffy habe ich damals – Ende 2000 – für die Freiwilligenagentur<br />
als Einzelprojekt aufgebaut, das gab es in zwei
weiteren Stadtteilzentren in Berlin. Inzwischen ist daraus<br />
ein eigenständiger Verein geworden. Als die Förderung<br />
auslief, haben wir mit engagierten Eltern und Paten diesen<br />
Verein gegründet.<br />
Die Patenschaften bestehen zwischen Kindern etwa ab<br />
dem Schulalter, bis ungefähr 16 oder 17 Jahre, danach<br />
haben Jugendliche von sich aus kein Interesse mehr daran,<br />
meistens hört es schon ein Stück vorher auf. Aber<br />
wenn zum Beispiel mit 13, also zu Beginn der Pubertät,<br />
bereits eine Patenschaft besteht, dann besteht sie häufig<br />
auch über die Pubertät hinaus bis in die Erwachsenenzeit<br />
fort. Unsere längsten Patenschaften gehen mittlerweile 6<br />
bis 7 Jahre.<br />
Es geht immer um 1:1-Beziehungen, also die freundschaftliche<br />
Beziehung, die ein Pate oder eine Patin zu<br />
einem Kind aufbaut. Die eine Seite sind die Erwachsenen,<br />
die im Alter von 21 oder Anfang 20 bis Ende 60<br />
sind, sie sind häufig allein stehend und interessieren<br />
sich dafür, etwas mit einem Kind zu unternehmen. Auf<br />
der anderen Seite stehen zum ganz überwiegenden Teil<br />
allein erziehende Familien, die ihren familiären Hintergrund<br />
nicht in Berlin haben, wo Verwandte bzw. Großeltern<br />
in anderen Teilen Deutschlands leben, weshalb das<br />
familiäre Netzwerk fehlt. Es fehlt den allein erziehenden<br />
Eltern auch oft die Zeit, um sich ein soziales Netzwerk<br />
zu erschließen.<br />
Die Patenschaften zielen darauf ab, einmal in der Woche<br />
an einem Nachmittag gemeinsam etwas mit dem<br />
Kind zu unternehmen und im regelmäßigen Austausch<br />
mit uns und dem Elternteil zu sein. Daraus folgt, dass sie<br />
gemeinsam die Freizeit gestalten. Ein Pate, der sich für<br />
ein Kind interessiert, kommt erst einmal zu einem ausführlichen<br />
Erstgespräch zu uns. Eine Familie, die sich für<br />
eine Patenschaft interessiert auch.<br />
Die Paten werden dann an zwei Abenden darauf vorbereitet,<br />
was mit so einer Patenschaft auf sie zukommt.<br />
Auch mit den Eltern sind wir dann noch mal näher im<br />
Gespräch, dann bringen wir Vorschläge dafür, welche<br />
Konstellationen für uns denkbar sind. weil wir beide Seiten<br />
sehen, da könnten bestimmte Interessen passen, da<br />
könnte eine bestimmte Förderung passen. Für uns ist<br />
immer auch maßgeblich, dass die jeweiligen Wohnorte<br />
nicht so ganz weit entfernt liegen, also dass es überbrückbare<br />
Entfernungen sind, damit sich die Kinder irgendwann<br />
auch selbstständig auf den Weg zu ihren Paten<br />
machen können.<br />
Ganz wichtig ist, dass diejenigen, die sich freiwillig dafür<br />
engagieren, zuverlässig sind. Es ist darauf angelegt, dass<br />
es mindestens erst mal über ein Jahr läuft. Häufig ist es<br />
so, wenn daraus eine stabile Beziehung und eine freundschaftliche<br />
Beziehung entstanden ist, dann läuft es sogar<br />
über mehrere Jahre.<br />
Wir haben im Moment etwa 110 Patenschaften, die wir<br />
begleiten. Die andere Koordinatorin und ich stehen für<br />
Gespräche bereit, für Konflikte, wir vermitteln zwischen<br />
beiden Seiten. Wir haben ein Begleitangebot, das heißt<br />
„Pasta für Paten“, wir laden andere Paten zu einem Essen<br />
ein, der Vorstand kocht. Da gibt es Austauschmöglichkeiten<br />
für die Paten untereinander. Vier Mal im Jahr gibt<br />
es Tea-Times, da kommen alle zusammen, die an dem<br />
Programm beteiligt sind und können sich an einem bunten<br />
Nachmittag begegnen. Es werden für Kinder ein paar<br />
Spiele angeboten. Es findet Austausch statt, wir machen<br />
das durch Namensschilder kenntlich, wer die Erfahrenen<br />
sind, die schon Patenschaften haben, sowohl Kinder als<br />
auch Erwachsene haben dann rote Schilder. An den grünen<br />
Schildern sieht man, dass jemand zur Vermittlung da<br />
ist. So kann man miteinander ins Gespräch kommen. Die<br />
Eltern kann man auch an einem andersfarbigen Namensschild<br />
identifizieren.<br />
Das ist der Rahmen. Wie gesagt, das Programm läuft<br />
seit Ende 2000. Wir haben inzwischen viele Nachfragen<br />
auf beiden Seiten, da macht sich sehr stark bemerkbar,<br />
dass Berlin sehr viele allein erziehende Familien hat.<br />
Auch für Migrantenfamilien ist das Angebot interessant,<br />
damit Kinder im Alltag mit einem deutschen Paten zum<br />
Beispiel mehr Deutsch sprechen können und dadurch<br />
eine andere, spielerische Art haben, um die Sprache zu<br />
lernen. Wenn sie in der Schule sind, bleiben sie häufig<br />
auf einem Sprachniveau, was noch ausreicht, um sich<br />
mit den Schulkameraden zu verständigen, aber die<br />
nächste Stufe erreichen sie nicht, weil bei ihnen zu Hause<br />
die Heimatsprache gesprochen wird.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 57
58<br />
Workshop Zwischentöne<br />
Zwischentöne<br />
TN: Sie sagten, dass es auf beiden Seiten Bedarf gibt.<br />
Gibt es einen Überhang auf einer der Seiten?<br />
Andrea Brandt: Im Moment ist es so, dass es zahlenmäßig<br />
relativ ausgewogen ist, allerdings nicht in der<br />
räumlichen Verteilung. Das heißt, zum einen haben wir<br />
auf der Patenseite immer etwas mehr Nachfragen von<br />
Frauen, während auf der Familienseite die Nachfrage<br />
häufig nach männlichen Bezugspersonen höher ist. Das<br />
gilt besonders für Mütter mit Söhnen, denen schon in<br />
Grundschulen, in der Kita und im Hort männliche Bezugspersonen<br />
fehlen, weil dort das Personal überwiegend<br />
weiblich ist. Gerade wenn es zum Vater überhaupt<br />
keinen Kontakt gibt oder nur sehr sporadischen Kontakt,<br />
dann fehlt einfach eine männliche Bezugsperson. Die<br />
Mütter merken, dass sie diese Seite nur schwer ausfüllen<br />
können, weil Männer und Jungs ganz anders im Umgang<br />
sind. Sie sind häufig sehr viel körperbetonter, sehr<br />
viel sportlicher, rausgehen, sich austoben. Während<br />
die Mutter eine hohe Belastung durch ihre Berufstätigkeit,<br />
durch die Versorgung von mehreren Kindern hat.<br />
Sie muss den Alltag bewältigen, Haushalt, Schule, also<br />
der Belastungspegel der Mütter, die zu uns kommen, ist<br />
extrem hoch. Da ist der Wunsch nach einer Entlastung<br />
natürlich ganz stark.<br />
Und da trotzdem ins Gespräch zu kommen, dass es nicht<br />
vordergründig nur der entlastende Aspekt ist, sondern<br />
auch der Raum, was gemeinsam zu entwickeln, dass<br />
sich Freundschaft zwischen dem Kind und dem Erwachsenen<br />
entwickeln soll, dieser Beziehung auch Spielraum<br />
und Vertrauen zu geben, das ist natürlich von Familienseite<br />
erst mal ungewohntes Terrain, das zu betreten viel<br />
Mut erfordert.<br />
Die Frauen, die sich dafür interessieren, müssen manchmal<br />
warten. Diese Patenschaften sortieren sich sehr<br />
stark gleichgeschlechtlich, das heißt, da warten Frauen<br />
häufig auf Mädchen. Ein Junge will oft unbedingt eine<br />
männliche Bezugsperson, dann werde ich ihm nicht eine<br />
Frau vor die Nase setzen. Insofern haben wir da nicht<br />
unbedingt ausgeglichene Pools.<br />
TN: In Wiesbaden gibt es ein nicht ganz vergleichbares<br />
Projekt, nämlich Leihomas oder Wunschomas, wo ein<br />
großer Überhang an jungen Familien ist, die älteren Menschen<br />
sich aber im Großen und Ganzen verweigern.<br />
Andrea Brandt: In Berlin haben wir mit über 800 Patenschaften<br />
den Großelterndienst. Wir arbeiten da auch immer<br />
mal eng zusammen mit einzelnen Patenschaftsprojekten,<br />
die es bereits gibt. Wir haben inzwischen auch<br />
schon die Gründung von kleinen, regionalen Berliner<br />
Projekten begleitet. Wir haben auch immer wieder Anfragen<br />
aus dem Bundesgebiet. Bei uns fokussiert sich das<br />
nicht so stark auf die Großeltern-Generation, sondern<br />
wir haben eigentlich in der mittleren Altersgruppe zwischen<br />
Mitte 30 bis Mitte 40 eine Häufung von nachfragenden<br />
Paten, weil das die Menschen sind, die für sich,<br />
wenn sie allein stehend sind, an die Grenze kommen,<br />
ob sie noch mal eine eigene Familie gründen. Sie sagen<br />
sich, das sieht vielleicht eher nicht so aus, aber sie hätten<br />
gerne Umgang mit einem Kind. Insofern ist das auch<br />
noch mal eine wichtige Zielgruppe, die sich stark damit<br />
identifiziert. Innerhalb dieser Paten sind homosexuelle<br />
Männer eine starke Gruppe. Sie sagen: Ich habe sonst<br />
überhaupt keine Gelegenheit mit einem Kind umzugehen<br />
und ich würde sehr gern einen Kontakt haben, wenigstens<br />
einmal in der Woche.<br />
Zum Glück besteht in diesem Punkt auf der anderen<br />
Seite die entsprechende Aufgeschlossenheit. Voraussetzung<br />
ist natürlich eine hohe Transparenz, die Lebenssituationen<br />
müssen bei beiden Seiten durchsichtig sein.<br />
Für uns sind deshalb auch ausführliche Gespräche und<br />
eine gute Vorbereitung notwendig, auch im Hinblick auf<br />
das Thema Kinderschutz, Kindesmissbrauch. Schon in<br />
der Vorbereitung ist das ein Thema, weil wir da nur durch<br />
eine hohe Transparenz ein gewisses Maß an Schutz geben<br />
können, der aber nicht vollkommen ist.<br />
TN: Hier steht, dass die Paten in einem Training geschult<br />
werden. Wie werden sie vorbereitet? Wie werden sie begleitet?<br />
Werden sie getestet?
Andrea Brandt: Nachdem sie zu einem sehr ausführlichen<br />
Gespräch zu ihrer persönlichen Situation und zu Informationen,<br />
die wir ihnen mit auf den Weg geben wollen,<br />
schon bei uns waren, kommen sie dann noch mal wieder<br />
als Gruppe von Paten zu einer Abendveranstaltung. Die<br />
Gruppe lernt sich kennen, wer will das noch machen, welche<br />
Motive stecken dahinter, jeder reflektiert noch mal,<br />
warum er das möchte und was er damit verbindet, was er<br />
für sich selber in so einer Patenschaft entwickeln möchte,<br />
wo sie die Grenzen dessen sehen, was sie einbringen<br />
wollen. Zum Beispiel kann das eine Vereinnahmung sein.<br />
Oder viele wollen nicht in eine reine Betreuung rein oder<br />
sagen, jetzt bin ich hier der Ersatz-Babysitter oder Bringedienst,<br />
also der Rahmen dieser Patenschaft muss klar<br />
werden, aber auch ihre Aufgabe.<br />
Es geht auch darum, dass Paten, die am Anfang in eine<br />
Familie kommen, erst mal wie ein Gast sind, aber in eine<br />
Rolle hineinwachsen, die annähernd eine familiäre Rolle<br />
ist. Und dass sie durchaus, wenn sie mit einem Kind alleine<br />
unterwegs sind, in eine erzieherische Rolle hineinkommen.<br />
Das heißt, sie müssen eine Vorstellung davon<br />
haben, wie sie mit solchen Situationen umgehen. Gleichzeitig<br />
braucht es immer diese Dreier-Konstellation, dass<br />
eine Mutter auch dahinter steht und das mit trägt bzw. damit<br />
einverstanden ist.<br />
Konflikte resultieren vor allem daraus, dass die Erwachsenen<br />
unterschiedliche Vorstellungen haben, so wie<br />
Paare auch unterschiedliche Erziehungs- oder Wertvorstellungen<br />
haben. Dann haben wir eine notwendige<br />
Funktion, wir erbitten oder fordern die regelmäßige<br />
Rückmeldung, damit wir einen Einblick haben, und wollen<br />
in Konfliktsituationen auch zurate gezogen werden.<br />
Wir hatten schon in der Vergangenheit dazu Workshop-<br />
Reihen, wo Eltern und Paten zum Thema Konflikte eingeladen<br />
waren, z.B.: Wie kommunizieren wir wertschätzend<br />
miteinander?, Der Rollenwechsel in der Patenschaft. Damit<br />
beide Seiten ein Forum finden, wo sie miteinander<br />
sprechen können. Aber die Einzelbegleitung steht bei<br />
Einzelkonflikten im Vordergrund. Wir hören uns beide<br />
Seiten an und laden beide gemeinsam ein, um das Problem<br />
konfliktgerecht zu moderieren und zu lösen.<br />
Das kann auch mal heißen, dass eine Patenschaft beendet<br />
wird. Das hängt sehr stark davon ab, wie gut sie<br />
miteinander in Kontakt kommen. Das hat ganz viel mit<br />
Beziehungsgestaltung zu tun, ganz viel mit Öffnung und<br />
Vertrauen, wie weit ich jemanden in meine Familie rein<br />
lasse. Ich wünsche mir vielleicht eine Entlastung, habe<br />
aber eine Grenze, wo sich jemand nicht einmischen<br />
oder mitbestimmen darf. Das ist für jemanden, der ein<br />
Stück Verantwortung übernimmt, an bestimmten Punkten<br />
ganz schwierig, so was braucht dann Klärung oder<br />
Moderation.<br />
Petra Sperling: Was bedeutet die demografische Veränderung<br />
für Nachbarschaftszentren? Es gibt immer mehr<br />
ältere Menschen, auch jüngere Menschen brauchen Aufgaben.<br />
Was bedeutet das und entsteht dadurch eine neue<br />
Aufgabe für uns? Herbert Scherer hat schon gesagt, dass<br />
es sein könnte, dass es heißt, die Nachbarschaftsheime<br />
springen auf alles an, was im Moment durch die Presse<br />
geht. Wie gehen Sie mit dem Gesamtthema Generationendialog<br />
und Generationenverantwortung um?<br />
TN: Es gibt eine große Sehnsucht nach heiler Familie,<br />
die wird von der Werbung viel genutzt. Ich denke, wenn<br />
jeder sich hinterfragt, hat er auch solche Anteile in sich.<br />
Die Menschen, die zu den Mehrgenerationenhäusern oder<br />
Nachbarschaftszentren kommen, kommen aus einem bestimmten<br />
Bedürfnis heraus. Es ist wichtig zu hören, was<br />
sie brauchen, um ein aktiver Teil dieser Gesellschaft sein<br />
zu können. Dafür müssen wir ihnen verschiedene Modelle<br />
anbieten. Das ist eine unserer wichtigen gesellschaftlichen<br />
Aufgaben. Die Menschen sind häufig sehr einsam, das betrifft<br />
Junge und Alte, Menschen in völlig unterschiedlichen<br />
Lebenslagen.<br />
Wir haben bei uns oft junge Familien oder allein erziehende<br />
Frauen, die extrem einsam sind. Wir haben aber<br />
auch die alte Frau, die zu uns kommt, weil sie einsam<br />
ist. Wir sollten das Thema einfach angehen – ohne es<br />
zu idealisieren. Nicht jeder Kontakt zwischen Jung und<br />
Alt ist nett, es ist bestimmt auch nicht immer einfach,<br />
aber es kann auch sehr beglückend sein. Wir haben<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 59
60<br />
Workshop Zwischentöne<br />
Zwischentöne<br />
zum Beispiel auch eine Wunschgroßeltern-Vermittlung<br />
im Haus, da gibt es so wunderbare Beispiele, aber es<br />
gibt auch die gescheiterten Fälle.<br />
Barbara Rüster: Ich war sehr lange in meiner Hochschule,<br />
das ist ja ein Elfenbeinturm. Jetzt bin ich wieder in die<br />
Praxis gekommen und bin ein bisschen schockiert, was da<br />
passiert. In Berlin ist die Situation so, dass sich der Staat<br />
zurückzieht, weil es kein Geld gibt. Ich finde es wichtig,<br />
Forderungen zu stellen, Jugendhäuser, Nachbarschaftsheime,<br />
all diese Einrichtungen brauchen einfach Hilfen,<br />
also sie brauchen auch professionelle Schauspieler,<br />
Künstler, alles Menschen, die mit zupacken, damit es ein<br />
lebenswertes Leben ist.<br />
TN: Ich teile Ihre Auffassung vollkommen, nur nicht an<br />
einer Stelle, nämlich dass sich der Staat zurückzieht. Das<br />
wird immer gerne gesagt. Die Branche, die hier am weitesten<br />
ausgebaut wird, ist nach wie vor der Gesundheitsbereich,<br />
alles, was mit Sozialarbeit im weitesten Sinn und<br />
mit Bildung zu tun hat. Es ist einfach nicht wahr, dass sich<br />
der Staat zurückzieht. Es sind schon auch unsere Einrichtungen<br />
und Institutionen selbst, die ihre Möglichkeiten,<br />
die sie haben, nicht nutzen. Es wurden jetzt viele Möglichkeiten<br />
dargestellt, die es gibt. Ich glaube nicht, dass man<br />
dafür immer extra Geld braucht.<br />
Ich glaube etwas anderes, zum Beispiel in unseren Institutionen<br />
sollten nicht nur Sozialarbeiter und Erzieher beschäftigt<br />
werden. Es gibt einen eigenen Standesdünkel und<br />
ein eigenes Standesdenken, so wie in den Schulen auch.<br />
Schulen hindern sich oft selber daran, Künstler, Handwerker<br />
oder etwas anderes einzustellen, um den Alltag, und<br />
Theater ist auch irgendwie Alltag und Lebenserfahrung,<br />
reinzuholen. Das ist für mich der zentrale Punkt, dass wir<br />
verlangen, und das auch in unseren eigenen Institutionen<br />
realisieren, dass andere Berufsgruppen eine Chance haben<br />
bei uns, um etwas in Bewegung zu bringen.<br />
Vorhin wurde gesagt, ob Theaterarbeit jeder Sozialarbeiter<br />
oder jeder Fachmitarbeiter machen kann. Wer eine Idee<br />
dazu hat, glaube ich, kann das auch machen, außerdem<br />
kann er sich durch entsprechende Fortbildungen qualifizieren.<br />
Wir haben gerade in unseren Einrichtungen, den<br />
Nachbarschaftsheimen, eine Menge von guten Beispielen,<br />
wo das erfolgreich von Sozialpädagogen oder Sozialarbeitern<br />
gemacht wird, die vorher keine Ausbildung in Theaterpädagogik<br />
gemacht haben. Natürlich ist das vorteilhaft,<br />
wenn man das dann auch noch kann.<br />
TN: Mir geht es um die Frage von Herbert Scherer, ob<br />
Nachbarschaftsheime bei aktuellen Themen auf den Zug<br />
aufspringen. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich,<br />
ich bin die Gründerin des Tauschrings Charlottenburg. 1996<br />
hatte ich ihn gegründet, das ist ein Non-Profit-Unternehmen,<br />
also Gelder fließen da gar nicht, sondern es geht wirklich um<br />
Ideen, um Kreativität. Und da kann ich nur sagen, natürlich<br />
sind die Nachbarschaftsheime dafür wichtig. Das sind die<br />
Orte, in denen sich so etwas realisieren kann.<br />
Vorher war ich in einem anderen Workshop, da ging es um<br />
niedrig schwellige Angebote in den Nachbarschaftshäusern.<br />
Bei Familien oder Alleinerziehenden liegt wirklich<br />
viel im Argen, die erreicht man nicht über Behörden oder<br />
Jugendämter, weil die da gar nicht hingehen, damit wollen<br />
sie nichts zu tun haben. Aber Sie erreichen sie über die<br />
Nachbarschaftsheime, indem dort Angebote sind, von denen<br />
Vater oder Mutter angesprochen werden. Deswegen<br />
finde ich Nachbarschaftsheime unbedingt wichtig, gerade<br />
für diese Angebote.<br />
TN: Wenn nicht wir, wer dann? Bei uns sollen Bedarf und<br />
Umsetzungsmöglichkeiten zusammenkommen, wenn es<br />
darum geht Vernetzungen herzustellen, um einen Ausweg<br />
aus der Einsamkeit zu finden. Wobei ich für uns diese Form<br />
von Projektwochen sehr gut finde, die wir haben. Es gibt<br />
ja viele Familien, die gar nicht in Nachbarschaftszentren<br />
gehen, wo die Kinder einfach vor dem Fernseher oder auf<br />
der Straße abhängen. Da merke ich, wie viel Potenzial<br />
da ist, was alles zu tun wäre. Diese Kinder aus den Klassen<br />
haben offensichtlich wenig Gelegenheit zu Konfliktgesprächen<br />
mit ihren Eltern, überhaupt zu Gesprächen,<br />
überhaupt von den Erwachsenen angesprochen zu werden.<br />
Manche Kinder mussten erst einen Moment überlegen,<br />
dann wurden sie noch mal gefragt, noch mal gefragt,<br />
es wirkte so, als müssten sie sich erst an die Situation<br />
gewöhnen, ein persönliches Gespräch zu haben.
Wir haben innerhalb dieser Projekttage ein Konfliktgespräch<br />
gemacht, denn in der Schulklasse war es so, dass<br />
über mehrere Jahre bestimmte Konflikte gedeckelt worden<br />
sind, damit sie überhaupt ihren Lehrstoff schaffen.<br />
Wir haben uns gewundert, warum da nichts passierte,<br />
warum jeder für sich ein kleines Atom war und die alle immer<br />
aneinander schlugen. Wir haben versucht, diese Arbeit<br />
zu machen, und ich habe den Eindruck, dass man als<br />
Nachbarschaftszentrum noch mehr in diese schwierigen<br />
Verhältnisse reingehen könnte. Wir könnten mit Familien<br />
und Kinden, die sonst nichts mit anderen Einrichtungen<br />
zu tun haben, viel mehr machen. Da ist noch ganz viel Potenzial.<br />
Andrea Brandt: Ich denke, dass Nachbarschaftshäuser<br />
genau der Ort sind, an dem jeder seine Ideen einbringen<br />
und ausprobieren kann, was er oder sie zusammen mit<br />
anderen auf die Beine stellen kann. Und zwar eigenverantwortlich<br />
und mit Unterstützung. Nachbarschaftshäuser<br />
sind aber auch ein Forum für Menschen, die sich begegnen.<br />
Auf der anderen Seite müssen wir als Träger aber<br />
auch selber nach außen gehen um zu gucken, welche Initiativen<br />
wir im Stadtteil noch anregen können, wofür es ein<br />
Potenzial an interessierten Leuten gibt.<br />
Selbstverständlich muss ein Nachbarschaftshaus immer<br />
auch Entwicklungstrends aufnehmen. Was ich mir aber<br />
aus den Erfahrungen der letzten Jahre Nachbarschaftsarbeit<br />
wünsche, ist an bestimmten Punkten wieder mehr<br />
Beständigkeit. Denn da ist eine Schnelllebigkeit reingekommen<br />
durch Projekte und Akteure, die nur kurze Zeit<br />
da sind. Das finde ich nicht gut. Initiativen fangen an, sind<br />
aber oft gleich wieder beendet. Dann ist etwas Gutes angestoßen,<br />
aber es geht nicht weiter. Diese ganz kurzen<br />
Laufzeiten bekommen Menschen nicht gut.<br />
Wir haben in der Freiwilligenagentur auch ein Projekt für<br />
Lernen durch Engagement, wo es einfach darum geht,<br />
dass Menschen über einen bestimmten Zeitraum die<br />
Chance haben in ihren Vorhaben begleitet zu werden und<br />
herauszufinden, was ihnen so ein freiwilliges Engagement<br />
bringen kann. Auch vielleicht in Bezug auf eine Perspektive,<br />
die sie suchen, weil sie erwerbslos sind.<br />
TN: Ich habe mit Klaus Dörner gesprochen, das ist der<br />
ehemalige Leiter der Westfälischen Klinik für Psychiatrie<br />
in Gütersloh. Er beschäftigt sich jetzt ganz intensiv mit<br />
dem eigenen Altwerden. Der Zusammenhang, in dem<br />
er das tut, ist interessant: Er beschäftigt sich mit Nachbarschaft.<br />
Er sieht die Nachbarschaft als den unbedingt<br />
notwendigen dritten Sozialraum an, neben einem privaten<br />
und familiären und einem gesellschaftlichen und öffentlichen<br />
Sozialraum. Aus seiner Sicht ist genau dieser<br />
nachbarschaftliche Sozialraum das Herzstück jeder Gesellschaft,<br />
weil in diesem Raum Beziehungen entstehen<br />
und die physischen Grenzen von Familie durchlässig und<br />
zugleich gestärkt werden. In diesem Raum wird geleistet,<br />
was Familie nicht leisten kann, aber was auch der öffentliche<br />
Raum nicht leisten kann. Er bringt es so auf den<br />
Punkt: In diesem Raum geben wir uns gegenseitig Bedeutung.<br />
Klaus Dörner hat ein Buch herausgegeben, mit dem<br />
Titel „Leben und Sterben wo ich hingehöre“, da fasst er<br />
das alles zusammen.<br />
TN: Ich glaube, das stimmt unbedingt, dass Nachbarschaften<br />
sehr wichtig sind, für die Menschen Kontakte<br />
und damit Bedeutung zu stiften. Aber Nachbarschaften<br />
müssten möglicherweise auch dort geschaffen werden,<br />
wo sie eben nicht oder kaum existieren.<br />
TN: Ich möchte noch mal eine Überlegung dazu anstellen:<br />
wie führt der Weg zum Geld? Das geht nur, indem wir uns<br />
um Trägerschaften und Einrichtungen bemühen, indem<br />
wir unabhängig werden, indem wir die Chancen, die gerade<br />
da sind, nutzen. Schulsozialarbeiter, da wird es demnächst<br />
– nicht nur in Berlin – viele Stellen geben. Rein<br />
in die Schulen als Nachbarschaftszentren. Kindertagesstätten<br />
gründen oder übernehmen. Ganztagsbetreuungen<br />
an Schulen, rein, die Schule könnte schlechthin zu dem<br />
Ort der Nachbarschaft oder des Stadtteils gemacht werden,<br />
mit unserer Unterstützung, eine komplette vorhandene<br />
Infrastruktur könnten wir nutzen. Es ist auch mein<br />
dringender Wunsch, dass Nachbarschaftszentren Trägerschaften<br />
übernehmen, weil das der Weg sein wird, wie wir<br />
stark werden.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 61
62<br />
Workshop Zwischentöne<br />
Zwischentöne<br />
TN: Guckt man mal kritisch hin, dann ist heute ein Großteil<br />
der sozialen Einrichtungen sehr isoliert. Auch wenn in<br />
Altenheimen oder in Pflegeheimen, im Kitabereich schon<br />
sehr viel geschehen ist, sind aber Seniorenheime fast geschlossene<br />
Einrichtungen. Sie sind nur für eine bestimmte<br />
Zielgruppe geöffnet und die damit verbundenen Besucher.<br />
Das ist eine Entwicklung, die wir bremsen müssen, weil<br />
der größte Teil unserer Professionalität in solchen Einrichtungen<br />
eigentlich für das Gemeinwohl gar nicht zur Verfügung<br />
steht. Aber das ist eine wichtige Ressource.<br />
Deshalb ist es so wichtig, dass die Nachbarschaftseinrichtungen<br />
ihren Sozialraum in ihre Arbeit einbeziehen. Das<br />
ist ihre große Chance. Wir müssen diesen Paradigmenwechsel<br />
vollziehen, ältere Menschen nicht als Belastung,<br />
sondern als Chance für eine Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen<br />
Engagements zu sehen.<br />
Andrea Brandt: Als Freiwilligenagenturen sind wir einerseits<br />
mit diesen ganz vielen verschiedenen Bereichen<br />
konfrontiert. Zum anderen eröffnen sich aber auch neue<br />
Handlungsfelder, ob das die Pflege der Senioren ist, ob das<br />
die Familien oder die Kinder sind, also da taucht das alles<br />
auf. Da ist natürlich bürgerschaftliches Engagement überall<br />
vorhanden und auch der Wunsch, Bereiche zu wechseln<br />
und in verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern.<br />
Ich sehe es als unsere Aufgabe an, dafür Infrastruktur zu<br />
schaffen und die Fähigkeit der Leute zu stärken, selbst zu<br />
reflektieren, wie sie ihr Engagement oder ihr Ehrenamt gestalten<br />
wollen.<br />
Es gibt den ganz starken Wunsch nach Unterstützung,<br />
gerade bei kleinen Initiativen. Den nehmen wir zum Beispiel<br />
gerade mit Seminaren auf. Da geht es um Fragen<br />
wie: wie kann ich meine Vorstellungen kommunizieren<br />
und in eine Einrichtung hineintragen. Und umgekehrt, wie<br />
können Einrichtungen, die oftmals zunächst eine Scheu<br />
vor neuen Gruppen haben, den Umgang damit lernen, und<br />
gerade kleinen Initiativen eine Chance geben, den Zugang<br />
zu Nachbarschaftshäusern zu finden. Wir haben dazu gerade<br />
ein kleines Projekt abgeschlossen, woraus ein Leitfaden<br />
entstanden ist, wie man Freiwillige gut einbinden und<br />
vermitteln kann. Das sind die Bausteine, die die Gruppen<br />
auch ein Stück weit zueinander führen.<br />
Fotos von Angela Kröll<br />
zum Beitrag von Barbara Rüster
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 63
64<br />
Workshop<br />
SOS- Eltern in Not<br />
Hilfe und Selbsthilfe<br />
Inputs:<br />
Manja Mai (Outreach) und Ute Wollburg (Marzahn)<br />
„Zeig Courage - Selbsthilfegruppe von Eltern,<br />
deren Kinder Opfer von Gewalt geworden sind“<br />
Josella Stolz (Tauschring Charlottenburg)<br />
„Ein Tauschring als Selbsthilfeinitiative<br />
armer Menschen - geht das?“<br />
Dirk Fischer (ehem. Exit)<br />
„Hilfe für Eltern (rechts-)extremistisch<br />
orientierter Jugendlicher“<br />
Moderation:<br />
Herbert Scherer<br />
Manja Mai: Wir wollen das Projekt „Zeig-Courage“ gemeinsam<br />
vorstellen. Ich werde den Part übernehmen,<br />
wie kam das Jugendprojekt dazu, wie ist die Initiative<br />
entstanden, was haben wir begleitet, was haben wir getan.<br />
Und Frau Wollburg erzählt über die Initiative, was<br />
die Intention war, was sie erlebt hat.<br />
Im Frühjahr 2007 hatten wir im Stadtteil Marzahn große<br />
Probleme mit Gewalt. Es ging dort um Schutzgelderpressungen<br />
an Schulen und zwar im großen semiprofessionellen<br />
Maßstab. Abziehen von Jugendlichen als Volkssport<br />
sozusagen. Es war aber so, dass das offensichtlich<br />
vonseiten der Polizei wenig wahrgenommen wurde,<br />
sondern eher vonseiten der Sozialarbeiter und der Betroffenen.<br />
Aber es gab keinen öffentlichen Skandal und<br />
keine öffentliche Diskussion darüber.<br />
Wir haben mit Eltern von Jugendlichen, die uns auch bekannt<br />
waren, darüber diskutiert. Es gab keine offizielle Runde,<br />
sondern es war Teil unserer Arbeit, uns oft mit Eltern zu<br />
unterhalten und mit ihnen in die Diskussion zu kommen.<br />
Wir haben uns gefragt, was man jetzt tun kann und welche<br />
Wünsche Eltern haben. Und welche Erfahrungen von<br />
Eltern gibt es bereits?<br />
Ute Wollburg: Unsere Erfahrung war, dass Opfer immer<br />
sehr wenig Hilfe bekommen. Es dreht sich immer viel<br />
um den Täter. Wir haben uns gedacht, nein, so soll das<br />
nicht sein, wir wollen das so nicht mehr. Deshalb kam<br />
uns die Idee mit der Elterninitiative. Wir hatten aber<br />
noch keine konkrete Vorstellung davon, wo und wie man<br />
am besten ansetzt. Dann haben wir uns Unterstützung<br />
von außen geholt.<br />
Manja Mai: An dieser Stelle sind dann wir ins Spiel gekommen,<br />
weil wir auch am Entstehungsprozess dieser<br />
ganzen Geschichte beteiligt waren und die Eltern Vertrauen<br />
zu uns hatten. Was kann man machen? Wie gründet<br />
man eine Initiative? Wohin kann man sich wenden?<br />
Wo kriegen wir mal Räume? Wir wollten ein großes Netzwerk<br />
aufbauen und haben Pläne, aber wie können wir<br />
vorgehen?<br />
Das war erst mal ein ziemlich großer Berg, aber auch eine<br />
sehr große Motivation vonseiten der Eltern. Wenn niemand<br />
da ist, um das zu strukturieren oder zu unterstützen, dann<br />
kann es auch sein, dass es einfach ins Leere läuft. Die<br />
Unterstützung haben wir als unsere Aufgabe gesehen.<br />
Wir sind ja wirklich in erster Linie für Jugendliche da und<br />
nicht für Eltern. Aber in dem Fall wollten wir dafür sorgen,<br />
dass es zum Laufen kommt, damit die Eltern auch<br />
selbstständig agieren können. Unsere Aufgabe war,<br />
das Know-How zu vermitteln, Finanzierungswissen, wie<br />
schreibt man einen Antrag, wo kann man sich hinwenden.<br />
Die zweite Aufgabe war, die Initiative bekannt zu<br />
machen. Wie kann man die vielen Fachrunden der Sozialarbeit<br />
erreichen? Die ganze Jugendsozialarbeit wird
vernetzt und alle reden miteinander, aber häufig sind<br />
diejenigen, die aus ihrer eigenen Erfahrung sprechen<br />
können, nicht dabei. Und der Zugang ist für diese Leute<br />
oft auch schwierig. An den Fachrunden teilzunehmen,<br />
war manchmal schon nicht so einfach oder den Zugang<br />
zu finden. Das war der andere Teil, bei dem wir Unterstützung<br />
gegeben haben.<br />
Wir haben einen Antrag gestellt bei den Gesellschaftern,<br />
also bei der „Aktion Mensch“, darüber sind wir ein Jahr<br />
finanziert worden. Finanziert wurde der Aufbau einer Internetseite<br />
zu dem Thema Notfalltelefon und Informationsveranstaltungen,<br />
das war ein Wunsch der Eltern.<br />
Herbert Scherer: Also eher Kleingeld.<br />
Manja Mai: Aufwandsentschädigungen, auch für die Eltern,<br />
die sich ja mit großem Engagement in diese Sache<br />
reingeworfen haben.<br />
Ute Wollburg: Wir haben erst mal eine Internetseite geschaltet<br />
und ein Notfalltelefon eingerichtet. Durch Flyer<br />
haben wir bekannt gemacht, wie man uns erreichen kann.<br />
Dann haben wir Kontakt zum Weißen Ring aufgenommen<br />
und zum Jugendamt, um ihnen allen mitzuteilen, dass es<br />
uns gibt und was wir vorhaben. Wir haben auch immer wieder<br />
um Unterstützung gebeten, was an vielen Stellen nicht<br />
immer geklappt hat.<br />
Dann ging es auch relativ schnell, dass sich die ersten<br />
Familien wirklich an uns gewendet haben, denen haben<br />
wir – soweit es ging und soweit sie es gewünscht haben<br />
– unter die Arme gegriffen. Ob das erst mal nur ein Gespräch<br />
war oder ein Gang zur Polizei. Viele sträuben sich<br />
dagegen, eine Anzeige zu machen. Wir haben ihnen auch<br />
vermittelt, dass es sehr wichtig ist, sich als Opfer nicht zu<br />
verstecken, sondern die erfahrene Gewalt immer wieder<br />
zur Sprache zu bringen. Wir haben die Leute begleitet und<br />
gesehen, wie man sich meistens in solchen Situationen<br />
verhält und dass man als Opfer nicht schweigen sollte.<br />
Denn häufig erfährt man von diesen Dingen gar nichts.<br />
Selbst wenn man fragt, kriegt man in der Regel ausweichende<br />
Antworten<br />
TN: Könnt ihr etwas darüber sagen, wie alt diejenigen waren,<br />
die abgezogen haben, und wie alt die Kinder waren,<br />
die abgezogen wurden?<br />
Ute Wollburg: Beide Gruppen waren ungefähr in demselben<br />
Alter, zwischen 16 und 25 Jahre.<br />
TN: Also nicht die Kleinen, die man abgreifen kann.<br />
Ute Wollburg: Nee, nee.<br />
Manja Mai: Gerade im Rahmen dieser Schutzgeldgeschichte<br />
ist eine Menge passiert. Die Frauen aus dem Projekt<br />
sind zu den Eltern nach Hause gegangen, denn über<br />
ihre eigenen Kinder wussten sie ja, wer abgezogen worden<br />
ist, wer erpresst wurde. Wir wussten auch, wer die Täter<br />
sind. Wir haben eine Veranstaltung mit der OGJ gemacht,<br />
das ist die Operative Gruppe Jugendgewalt, Zivilfahnder<br />
von der Polizei. Die haben auch erklärt, wie wichtig es ist,<br />
dass wir eine Anzeige machen, weil sie ohne Anzeige nicht<br />
reagieren können.<br />
Innerhalb relativ kurzer Zeit ist ein bis dahin als unbescholten<br />
geltender junger Mann dann als Mehrfach-Intensivtäter<br />
erkannt geworden, weil die Eltern dann doch<br />
Anzeige erstattet haben. So konnte dann diese Schutzgeldgeschichte<br />
beendet werden, zumindest vorläufig.<br />
Ute Wollburg: Die Erpressungen haben im großen Rahmen<br />
stattgefunden. Es sind Eltern bedroht worden. Von<br />
einer Mutter wurde der Sohn erpresst, aber er hat sich<br />
geweigert zu zahlen. Daraufhin wurde die Mutter vor der<br />
Kaufhalle zusammengeschlagen, um dem Sohn mehr<br />
Druck zu machen. Diese massive Gewalt hat uns veranlasst<br />
in die Familien zu gehen und dort zu sagen: Ihr<br />
müsst das anzeigen. Viele hatten Angst, was man in so<br />
einer Situation ja auch verstehen kann. Aber wir haben<br />
ihnen erklärt, lieber jetzt noch mal kurz Angst haben als vielleicht<br />
noch über Monate oder Jahre Angst. Denn wenn das nie einer zur<br />
Sprache bringt, wird es nie besser werden. Nachdem der Kopf dieser<br />
Bande gefasst worden war, kehrte einmal ganz schnell wieder<br />
Ruhe ein. Zu dem Zeitpunkt waren wir drei Eltern bei „Courage“.<br />
Manche Eltern wollten für einen Notfall zur Verfügung stehen.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 65
66<br />
Workshop SOS - Eltern in Not<br />
SOS - Eltern in Not<br />
TN: War die Schule nicht auch involviert?<br />
Ute Wollburg: Zum Thema Schule: Diese Abzieherei war<br />
auf der Schule meiner Tochter. Die stand daneben, wie da<br />
jemand abgezogen oder erpresst wurde. Daraufhin ist sie<br />
zum Direktor gegangen. Da wurde ihr erklärt, dass das vor<br />
der Tür stattfindet und sie damit als Schule nichts damit<br />
zu tun haben.<br />
Ich habe meine Tochter dann versucht zu überzeugen,<br />
dass sie am nächsten Tag noch mal zu ihrer Schulsozialarbeiterin<br />
geht und dort noch mal mit Nachdruck sagt,<br />
dass es zwar vor der Tür passiert ist, es aber ein Schüler<br />
aus ihrer Schule war. Das hat sie dann auch getan, glücklicherweise<br />
hatte sie den Mut. Am nächsten Tag hat sie das<br />
gleich angezeigt. Daraufhin war die Schule dann sehr wohl<br />
involviert. Aber – ja, da kam nicht allzu viel.<br />
TN: Wie habt ihr euch sachkundig gemacht, woher hattet<br />
ihr die notwendigen Informationen, um Eltern Hilfestellung<br />
leisten zu können? Zum Beispiel wie das mit der Anzeige<br />
läuft, wie von den Gerichten damit umgegangen wird, wie<br />
die Polizei damit umgeht, usw. Hattet ihr Fortbildungen?<br />
Ute Wollburg: Wir hatten einfach das große Glück,<br />
dass von Anfang an die Presse auf uns zugekommen<br />
ist. Dadurch haben wir viele Kontakte gekriegt, auch<br />
zur Polizei, zur Gewerkschaft der Polizei. Aus solchen<br />
Gesprächen konnten wir natürlich für uns ganz viel Material<br />
mitnehmen, ganz viel Hintergrundwissen. Man<br />
erfährt als Initiative natürlich auch viel mehr, als wenn<br />
ich nur als Mutter irgendwo hingehe und Hilfe will. Oder<br />
wenn wir jemanden zum Gericht begleitet haben, dann<br />
haben wir meistens die Gelegenheit genutzt und einen<br />
Jugendrichter mit unseren Fragen gelöchert. So haben<br />
wir uns eben unser Wissen angeeignet. Wir haben auch<br />
bei Outreach immer wieder nachgefragt. Oder beim Jugendamt.<br />
Das hat ganz gut geklappt, wir haben dort<br />
viele Informationen bekommen.<br />
TN: Ihr habt mit dem Jugendamt gute Erfahrungen gemacht?<br />
Ute Wollburg: Mit der Mitarbeiterin vom Jugendamt, mit<br />
der wir zusammengearbeitet haben, schon. Die war sehr<br />
kooperativ.<br />
Herbert Scherer: Das kannst du bestätigen?<br />
Manja Mai: Ja, im Prinzip schon. Jetzt kommen wir wieder<br />
zu unserem Anteil. Wichtig dabei war, dass die Eltern<br />
plötzlich Fälle auf dem Tisch hatten und damit nicht umzugehen<br />
wussten. Sie waren nicht ausgebildet, wussten<br />
sich nicht zu schützen. Zum Teil sind sie vom Jugendamt<br />
benutzt worden. Die waren zwar freundlich, aber sie waren<br />
auch einfach nur froh, dass sie bei jemandem Fälle<br />
abladen konnten. Unsere Funktion in dem Konstrukt bestand<br />
darin, dass wir so etwas wie Supervision gemacht<br />
haben. Eltern können sich an manchen Stellen nicht<br />
abgrenzen. Sie wissen auch nicht, wann es besser ist,<br />
etwas in bestehende Systeme weiterzuleiten, und wann<br />
man neue Wege suchen sollte.<br />
Wir haben uns regelmäßig getroffen, haben gefragt, was<br />
inzwischen an Neuem passiert ist. Was in den Familien<br />
passiert ist oder in den einzelnen Institutionen Das war<br />
als Unterstützung gewünscht, um da eine Linie reinzukriegen.<br />
Es kamen Bemerkungen wie: Ach ja, da haben<br />
wir uns an der Stelle ganz schön übernommen, da wissen<br />
wir nicht weiter. Dann gab es auch Schwierigkeiten<br />
innerhalb des Stadtteils, weil die betroffenen Eltern, die<br />
Fälle, ja auch direkt aus dem Stadtteil kamen. Das war<br />
manchmal schwer auszuhalten für die Eltern. Da haben<br />
wir versucht, einen Schutz aufzubauen. Insgesamt ist<br />
das sehr gut gelaufen, es ist sehr viel passiert.<br />
Ein Punkt war noch wichtig: die Öffentlichkeit. Wenn<br />
man in sozialen Projekten arbeitet, dann weiß man, wie<br />
schwierig es manchmal ist, die Presse zu aktivieren. In<br />
dem Projekt war es so, dass die uns überrannt haben. Wir<br />
haben wirklich viel Unterstützung erfahren. Es bestand<br />
ein breites Interesse an dem Thema Opfer oder an dem<br />
Thema Courage. Manche Eltern haben die Öffentlichkeitsarbeit<br />
abgelehnt, weil sie sich die entweder nicht zutrauten<br />
oder sie wollten sich nicht vorführen lassen. Das<br />
war dann auch in Ordnung.
Obwohl sich das alles toll anhört, wollen wir mit den<br />
Schwierigkeiten nicht hinter dem Berg halten. Plötzlich<br />
hatten wir nämlich die folgende Situation: Was macht<br />
eine Eltern-Initiative, wenn die Eltern anfangen sich zu<br />
streiten? Sie wollten plötzlich nicht mehr miteinander<br />
reden, die Positionen und Motivationen veränderten sich.<br />
Das war schwierig.<br />
TN: Das war oder ist schwierig?<br />
Manja Mai: Wir haben uns in der Situation aus der Initiative<br />
als Berater zurückgezogen, weil es nicht unsere Initiative<br />
ist. Nicht wir gestalten sie, sondern die Eltern müssen<br />
selber eine Möglichkeit oder eine Lösung finden. Sie<br />
können diese Initiative weiterführen, auch wenn man sich<br />
nicht immer mag, sie kann ein loses Netzwerk sein, wo es<br />
um die Sache geht und nicht nur um einzelne Personen.<br />
Herbert Scherer: War die Initiative vielleicht zu erfolgreich<br />
und jetzt gibt es gar keinen Außenfeind mehr? Wenn der<br />
Druck, was zu tun, ganz groß ist, dann muss man sich einigen.<br />
Aber wenn man sich nur so trifft, …<br />
Manja Mai: Vielleicht ist ein Problem: Wenn man zu viel<br />
Öffentlichkeit bekommt, verleitet das auch. Es verleitet<br />
z.B. zur Egopflege. Dann verändern sich durchaus die Motivationen<br />
von Eltern, wenn die Selbstdarstellung wichtiger<br />
wird als das Thema an sich. Das war der Punkt, an dem wir<br />
gesagt haben: Wir wollen das gerne weiter unterstützen,<br />
aber vielleicht muss sich das mit den Eltern erst mal ohne<br />
uns zurechtrütteln. Die Frage ist jetzt: Wie kann so eine<br />
Initiative, die von unten entsteht, die sich verändert und<br />
sich verändern muss, weiterhin Bestand haben oder eine<br />
neue Qualität entwickeln?<br />
Frau Wollburg organisiert zusammen mit einer Jugendeinrichtung<br />
Anti-Gewalt-Tage an einer Schule in Marzahn,<br />
zwei Mal im Jahr. Das Thema Gewalt ist ja kein Thema,<br />
was vom Tisch verschwindet oder uns nicht mehr begleitet<br />
– bedauerlicherweise ist es weiterhin ein aktuelles Thema.<br />
Vielleicht können wir im nächsten Jahr berichten, wie<br />
sich die Initiative entwickelt hat.<br />
Herbert Scherer: Jetzt kommen wir zu Frau Stolz und dem<br />
Tauschring Charlottenburg. Wir haben uns verständigt,<br />
dass wir das im Dialog machen. Der Tauschring Charlottenburg-Wilmersdorf<br />
ist ja ein bisschen anders entstanden,<br />
Frau Stolz, als manche anderen, aber Sie hatten vorher<br />
auch schon in andere reingeschnuppert?<br />
Josella Stolz: Meine ersten Informationen über Tauschringe<br />
bekam ich in Form einer Broschüre der Kreuzberger<br />
Gruppe „Ohne Moos geht’s los“. Das hat mich wirklich<br />
interessiert, weil<br />
ich gedacht habe:<br />
Was, ohne Geld,<br />
das muss ja toll<br />
sein. Der Familientreff<br />
in der Ufa-Fabrik<br />
hatte die Idee,<br />
dort einen Tauschring<br />
zu etablieren.<br />
Das ging mit Informationsveranstaltungen<br />
los, die ich aber auch nur mit Unterstützung des<br />
Verbandes machen konnte, weil ich dort am Computer<br />
arbeiten konnte und kostenlos Papier, Sachmittel etc. bekommen<br />
habe.<br />
Das Ganze ging zehn Monate, bis der Stammtisch-Tauschring<br />
in Tempelhof entstand. Und dann kam mir die Idee,<br />
das war Anfang 1996, das auch in Charlottenburg zu machen.<br />
Herbert Scherer: Das hing damit zusammen, dass Sie in<br />
Charlottenburg wohnen. Vorher ging es eher darum, irgendwo<br />
tätig zu sein, danach aber auch außerhalb von einer bezahlten<br />
Tätigkeit zu sagen, ich suche Leute, die in einer ähnlichen<br />
Lage sind wie ich, nämlich dass wir kein Geld haben.<br />
Josella Stolz: Richtig, ja, so war es vordergründig. Und<br />
da waren eben die Ansprechpartner für Tauschringe und<br />
für andere soziale Initiativen die Nachbarschaftshäuser.<br />
Da muss ich auf das zurückkommen, was Sie bei der Eröffnung<br />
gesagt haben: Springen Nachbarschaftshäuser<br />
auf jeden Zug auf, der in den Medien gerade aktuell ist?<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 67
68<br />
Workshop SOS - Eltern in Not<br />
SOS - Eltern in Not<br />
Dazu kann ich nur sagen: Nachbarschaftsheime sind sehr<br />
wichtig, weil da wirklich etwas von unten nach oben passiert.<br />
Und es sind sogar die einzigen Orte, die für niedrig<br />
schwellige Jugendangebote oder auch für Tauschringe ideal<br />
sind.<br />
Herbert Scherer: Sie haben damals von dem Nachbarschaftshaus<br />
manchmal eine gewisse Unterstützung gekriegt,<br />
nicht immer, wenn ich mich recht erinnere.<br />
Josella Stolz: Ja, das war manchmal sehr schwer.<br />
Herbert Scherer: Das war sehr schwer, weil auch Nachbarschaftshäuser<br />
manchmal ihre eigenen Pläne in den<br />
Vordergrund stellen. Diese Initiative war wirklich eine Initiative<br />
von unten – und eine Initiative von unten ist auch<br />
immer ein bisschen lästig.<br />
Josella Stolz: Ja, das stimmt.<br />
Herbert Scherer: Wie haben Sie es geschafft, andere<br />
Leute zu finden, die da mitmachen? Und was sind das für<br />
Leute?<br />
Josella Stolz: Ich habe im Verband das Informationsmaterial<br />
erstellt, habe mich am Haus am Lietzensee darum<br />
gekümmert, dass ich am Wochenende einen Raum bekomme.<br />
Die haben dort ein Treffpunkt-Café, wo ich eine<br />
Informationsveranstaltung über Tauschringe abgehalten<br />
habe. In eigener Regie habe ich das publik gemacht, bin<br />
durch den Kiez gegangen und habe an jedem Baum einen<br />
Zettel angebracht. Ich war sehr gespannt, was sich<br />
dann tut. Aber es kamen gleich von Anfang an ziemlich<br />
viele Leute, mehr als 10, was sehr überraschend war. Ich<br />
fand das damals viel. Ich dachte, na gut, das ist ja mal ein<br />
Anfang.<br />
TN: Was stand auf den Zetteln?<br />
Josella Stolz: Ich kann ja mal so einen Flyer rumgehen<br />
lassen. Das ist eine generelle Information über Tauschringe:<br />
was ist ein Tauschring, was macht ein Tauschring? Diesen<br />
Flyer hatte ich im Kiez ausgehängt, die Leute haben<br />
ihn gelesen und sind auch gekommen. Nach der ersten<br />
Infoveranstaltung sind gleich fünf Leute eingetreten, also<br />
die ersten fünf Mitglieder. Das war vor zwölf Jahren, 1996.<br />
Heute hat der Charlottenburger Tauschring 300 Mitglieder,<br />
Tendenz steigend. Gerade in der letzten Zeit gibt es einen<br />
größeren Zulauf.<br />
Herbert Scherer: Wer managt den Tauschring? Das machen<br />
Sie oder machen das auch noch andere?<br />
Josella Stolz: Ich bin nicht der Tauschring, der Tauschring<br />
sind wir alle. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet. Eine<br />
Gruppe für die Zeitung, es gibt Arbeitsgruppen für die Talerkonten,<br />
für die Eurokonten. Man muss wissen, wer hat<br />
was getauscht, das muss nachvollziehbar sein. Wir haben<br />
so eine Art Scheckheft, da gibt es ein Kontenblatt, damit<br />
jedes Mitglied nachvollziehen kann, was getauscht wurde,<br />
sind meine Taler ordentlich abgerechnet worden. Das<br />
ist doppelte Buchführung, weil es immer drei Abschnitte<br />
gibt, einmal für die zwei Teilnehmer, die tauschen, einen<br />
Abschnitt für das Tauschringbüro. Da kann man jeden<br />
Monat in der Tauschringzeitung nachschauen, ob die<br />
Taler ordentlich abgerechnet sind. Meistens stimmt es.<br />
Für den Fall, dass was nicht stimmt und es Streitigkeiten<br />
gibt, haben wir auch eine Schlichtungsstelle mit einer Diplom-Psychologin.<br />
Da wird versucht, auf einen Nenner zu<br />
kommen und wieder gut auseinander zu gehen. Und das<br />
funktioniert.<br />
Herbert Scherer: Wie viele von den 300 Mitgliedern sind<br />
richtig aktiv dabei?<br />
Josella Stolz: Aktiv dabei sind ungefähr 80 Mitglieder.<br />
Herbert Scherer: Was kostet das?<br />
Josella Stolz: Das kostet 18 Euro im Jahr, d.h. monatlich<br />
1,50 Euro. Wenn jemand meint, er hat kein Geld, dann ist<br />
mein Argument: 1,50 Euro im Monat, das kann doch wohl<br />
nicht sein, dass jemand die nicht aufbringt. Wenn ich das<br />
vorrechne, dann klappt das auch.
Probleme gibt es natürlich trotzdem, angefangen bei dem<br />
Mitgliedsbeitrag, der einmal im Jahr fällig ist, diese 18<br />
Euro. Häufig wird die Zahlung vergessen, weil sie nur einmal<br />
im Jahr fällig ist. Inzwischen machen wir mit neuen<br />
Mitgliedern eine Einzugsermächtigung.<br />
Herbert Scherer: Was wird davon bezahlt?<br />
Josella Stolz: Von diesen 18 Euro wird die Miete bezahlt,<br />
das sind 50 Euro pro Monat, die wir an das Nachbarschaftshaus<br />
zahlen. Aber dafür haben wir dort unser Büro<br />
jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr. Das ist also immer ein<br />
fester Anlaufpunkt. Hinzu kommt jeden zweiten Montag im<br />
Monat der „Tauschrausch“, wo die Leute Sachen mitbringen<br />
und tauschen. Der eine hat einen neuen Besen, die<br />
andere eine Tischdecke, alles mögliche, alles, was man im<br />
Leben braucht. Und jeden dritten Montag im Monat haben<br />
wir für die Aktiven unser Organisationstreffen.<br />
Herbert Scherer: Was für Leute machen da mit?<br />
Josella Stolz: Es sind sehr viele arme Leute, sehr viele<br />
Arbeitslose, aber auch sehr viele Leute, die fest im Beruf<br />
stehen, die gut verdienen, momentan haben wir sogar einen<br />
pensionierten Professor drin, also ich bin begeistert.<br />
Es gibt auch wirklich gute Fachleute für praktische Dinge,<br />
dadurch gibt es ein so großes Potenzial an Tauschangeboten<br />
von A bis Z. Es ist ja so, die Arbeit geht nicht aus,<br />
nur die Lohnarbeit geht aus, aber Arbeit gibt es mehr als<br />
genug.<br />
TN: Im Laufe der Zeit steht gar nicht mehr der Tauschring<br />
im Vordergrund, denn es entstehen ja auch Freundschaften.<br />
Josella Stolz: Ja, gut, dass Sie es ansprechen. Das ist eigentlich<br />
das Tollste am Tauschring, was mich auch sehr<br />
froh macht. Es sind ziemlich viele Menschen aus Charlottenburg<br />
drin, aber auch aus Wilmersdorf, die normalerweise<br />
aneinander vorbeigelaufen wären, obwohl sie um die<br />
Ecke wohnen. Und es sind Freundschaften entstanden.<br />
Wir haben sogar zwei Tauschring-Kinder in den zwölf Jahren<br />
bekommen. Das Zwischenmenschliche ist ganz toll,<br />
was da passiert. Tauschen ist ja eine Vertrauenssache,<br />
deswegen einmal im Monat auch der Tauschrausch, denn<br />
wenn ich jemanden persönlich kenne, dann habe ich ein<br />
anderes Vertrauen, als wenn ich nur eine anonyme Anzeige<br />
lese.<br />
TN: Ist dieser Tauschring für alle Bezirke?<br />
Josella Stolz: Das ist der Tauschring Charlottenburg-Wilmersdorf.<br />
Da können auch andere kommen, wenn sie wollen.<br />
Aber man muss dazu sagen, Tauschringe machen nur<br />
vor Ort richtig Sinn, denn je länger die Wege sind, umso<br />
mehr verliert sich die Sache im Sande. Wir haben jetzt<br />
zum Beispiel jemanden aus Tempelhof, der ist bei uns eingetreten.<br />
Dann ruft jemand wegen seines Computers an<br />
und sagt: Können wir das nicht telefonisch machen? Das<br />
ist aber eine ältere Frau, die meint, dass sie am Telefon<br />
gar nix kapiert, sondern da schon einer persönlich kommen<br />
muss. Das sind Sachen, bei denen zu lange Anfahrtswege<br />
hinderlich sind. Wem diese Wege nichts ausmachen,<br />
gut, dann gerne, der Tauschring ist für alle offen. Aber Sinn<br />
macht er eigentlich vor Ort.<br />
Herbert Scherer: Markus, vielleicht kannst du das mit eurem<br />
Tauschring vergleichen. Ist es da ähnlich?<br />
TN: Vieles ist ganz ähnlich.<br />
Josella Stolz: Ihr seid ja auch meine Vorbilder, da ist die<br />
Ähnlichkeit klar.<br />
TN: Interessant ist, dass die Größe auch ähnlich ist. Wir<br />
hatten bestimmt mal 500 Leute, aber es wurde dann<br />
sehr schnell deutlich, dass in so einer großen Runde die<br />
Kommunikation nur ganz schwer möglich ist. Inzwischen<br />
hat sich der Tauschring wieder gesund geschrumpft. Bei<br />
uns zahlt der Tauschring keine Miete. Das ist zwar immer<br />
mal wieder Thema bei uns, aber eigentlich ist klar,<br />
wir als Nachbarschaftshaus haben so einen Gewinn vom<br />
Tauschring, weil dadurch so viele Menschen in unser Haus<br />
kommen, die sonst nicht kämen, dass wir von Anfang an<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 69
70<br />
Workshop SOS - Eltern in Not<br />
SOS - Eltern in Not<br />
den Tauschring mietfrei gestellt haben. Die kriegen auch<br />
den großen Saal einmal im Monat, sonntags, das ist alles<br />
kostenlos.<br />
Herbert Scherer: Jetzt muss man zur Ehrenrettung des<br />
Nachbarschaftshauses am Lietzensee sagen, dass es ein<br />
armes Nachbarschaftshaus ist, wo nur eine Personalstelle<br />
stammgefördert wird aus dem Stadtteilzentrumsvertrag.<br />
Ansonsten lebt das Haus davon, dass alle Gruppen, die<br />
dort sind, auch Geld bezahlen, um einen Teil der Kosten<br />
abzudecken.<br />
Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße als traditionelles<br />
Nachbarschaftshaus aus den 50er Jahren hat hingegen<br />
einen Status, dass es sich das leisten kann, Räume auch<br />
mietfrei zu vergeben. Von der Sache her hast du völlig<br />
Recht: Von einem Tauschring wird quasi die Arbeit des<br />
Nachbarschaftshauses selber gemacht.<br />
TN: Mich würde interessieren, ob das Gelingen tatsächlich<br />
von den Einkommensverhältnissen abhängig ist. Unser<br />
Verein hat vor zehn Jahren auch mit einem Tauschring<br />
angefangen. Ich glaube, dass die Vermögensverhältnisse<br />
noch ein bisschen besser sind, die Not ist nicht so groß,<br />
aber die Leute sind viel beschäftigt und haben keine Zeit.<br />
Dann ist der Tauschring eingeschlafen.<br />
Josella Stolz: Als ich in Charlottenburg angefangen habe,<br />
da war Charlottenburg bestimmt kein armes Viertel. Obwohl<br />
es eine versteckte Armut gibt, über die die Leute<br />
nicht gerne reden. Trotzdem finde ich wichtig, dass es<br />
nicht nur auf das Einkommen ankommt. Es gibt mehr einsame<br />
Leute als Arbeitslose, auch dagegen ist ein Tauschring<br />
vorbeugend. Viele Menschen würden alleine abends<br />
in ihrer Wohnung sitzen. Durch den Tauschring kennen<br />
sie aber Leute, können sich zum Kartenspielen treffen<br />
oder gemeinsam Kuchen essen oder Abendbrot essen.<br />
Der Tauschring ist generationsübergreifende Sozialarbeit<br />
in jeder Hinsicht.<br />
TN: Wie setzt sich das demografisch zusammen, altersmäßig,<br />
aber auch in Bezug auf Migrationshintergrund?<br />
Josella Stolz: Es sind schon überwiegend Ältere dabei,<br />
bis 65 oder 70 Jahre, bei 25 Jahren angefangen. Es sind<br />
auch Junge dabei, aber der größere Teil sind ältere Menschen.<br />
Wir haben auch viele türkische Mitglieder, russische<br />
Mitglieder, aus der Ukraine, es ist schon ein bisschen<br />
multikulti.<br />
TN: Machen Sie das ehrenamtlich?<br />
Josella Stolz: Ja, ich mache das seit 12 Jahren ehrenamtlich.<br />
TN: Bei uns knirscht es in den letzten Jahren ganz schön,<br />
auch in der Gruppe des Tauschrings. Es arbeite dort Leute<br />
miteinander, die beziehungstechnisch ganz große Schwierigkeiten<br />
haben. Wir hatten jetzt vor kurzem den kompletten<br />
Rücktritt der Bürogruppe. Wir machen das nicht<br />
mehr haben sie gesagt. Ist das bei euch auch so?<br />
Josella Stolz: Natürlich gibt es innerhalb des Orga-Teams<br />
auch Streitigkeiten, aber letztendlich kommen wir doch<br />
immer auf einen guten Punkt. Dass alle zerstritten sind,<br />
das gibt es gar nicht. Es kommt schon vor, dass man nicht<br />
einer Meinung ist. Aber das liegt auch daran, dass man in<br />
diesem Orga-Team unbedingt zwei Personen haben muss.<br />
Zum Beispiel bei unserem Team ist es die Diplom-Psychologin,<br />
die ausgleicht. Ich bin ein impulsiver Typ, den man<br />
eher runterfahren muss, während sie immer an meiner<br />
Seite sitzt und ganz diplomatisch und moderat ist. Wenn<br />
ich merke, dass es sich hochschaukelt, dann bin ich ruhig<br />
und lasse sie reden. Das funktioniert. Aber klar, es<br />
gibt Streitigkeiten – oft wegen Kleinigkeiten oder Nichtigkeiten.<br />
TN: Worüber wird gestritten?<br />
Josella Stolz: Zum Beispiel wird über den Bürodienst gestritten,<br />
eine hat jetzt einmal länger gemacht als die andere.<br />
Das sind ganz banale Sachen, aber die kann man<br />
aus der Welt schaffen und lösen. Das sind Sachen, wo es<br />
menschelt.
Herbert Scherer: Normalerweise gibt es doch immer<br />
Stress mit dem Geld. Hier ist ja auch reales Geld involviert.<br />
Da gab es doch schon mal Krach, oder?<br />
Josella Stolz: Mit Mitgliedsbeiträgen?<br />
Herbert Scherer: Oder mit Verdächtigungen, was passiert<br />
mit dem Geld oder wer verwaltet das Geld.<br />
Josella Stolz: Das war ganz am Anfang. Da hatten wir ein<br />
Mitglied, das hatte Mitgliedsbeiträge eingenommen und<br />
die nicht eingezahlt. Er hatte immer gesagt, er hätte das<br />
Geld zu Hause. Dann habe ich gesagt: Okay, du fährst<br />
nach Hause und holst es einfach. In dem Moment musste<br />
er Farbe bekennen. Aber er ist gleich am nächsten Tag gekommen<br />
und hat die Gelder gebracht. Damit war das dann<br />
vom Tisch. Aber er ist heute auch nicht mehr Mitglied.<br />
TN: Werden die Leute, die sich in Arbeitsgruppen engagieren,<br />
in Talern bezahlt oder machen sie es ehrenamtlich?<br />
Josella Stolz: Nein, die Orga-Arbeit wird mit Talern entlohnt,<br />
genau wie jede andere Arbeit auch.<br />
TN: Das heißt, jedes Tauschring-Mitglied zahlt monatlich<br />
einen Teil seiner Taler als Kontogebühr?<br />
Josella Stolz: Wir haben unsere Talerkonten und je nachdem,<br />
wie viele Mitglieder es sind, fällt immer eine Talergebühr<br />
an. Wenn es viele Mitglieder sind, fällt die sehr gering<br />
aus, das sind im Monat nur 2 oder 3 Taler. Sind es weniger<br />
Mitglieder, ist die Kontogebühr höher, weil das so richtig<br />
ist, denn von dieser Arbeit profitieren ja alle Mitglieder des<br />
Tauschrings. Die Talerkonten müssen geführt werden, die<br />
Zeitung muss gedruckt werden, das sind alles wichtige Arbeiten.<br />
Deswegen ist es nur recht und billig, wenn sich alle<br />
daran beteiligen.<br />
Herbert Scherer: Wie viel ist denn ein Taler wert?<br />
Josella Stolz: Damals, als ich angefangen habe, gab es<br />
ja noch DM, da waren 10 Taler 10 Mark. Seit es den Euro<br />
gibt, sind 20 Taler 10 Euro, so ist es bis heute. Eine Stunde<br />
Arbeit im Tauschring ist 20 Taler wert, egal, um welche<br />
Tätigkeit es sich handelt, ob das Arbeit am Computer oder<br />
Putzarbeit ist. Wir machen da keinen Unterschied, denn<br />
eine Stunde ist eine Lebensstunde, egal, welche Arbeit<br />
man macht. Wenn man da anfängt zu differenzieren, dann<br />
kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Aber eine<br />
Stunde ist für eine Putzfrau genauso eine Lebensstunde<br />
wie für den Akademiker. Das akzeptiert auch jeder.<br />
TN: Also zu dem, was man als Mitgliedsbeitrag bezahlt,<br />
kommen noch die Taler dazu?<br />
Josella Stolz: Ja.<br />
Herbert Scherer: Die Taler erwirbt man ja durch Arbeit und<br />
dann tauscht man sie wieder gegen Arbeit von jemand anders,<br />
weil man ja nicht mit den Talern bezahlen kann, also<br />
man kann nicht zur Bank gehen und sagen, ich will für so<br />
und so viele Euro Taler haben. Markus, wie funktioniert<br />
das mit dieser imaginären Währung?<br />
TN: Drei Leute treten zum Beispiel in einen Tausch. Ich<br />
bügle Ihre Wäsche, Sie reparieren das Fahrrad vom<br />
Herbert Scherer, der Herbert Scherer putzt bei mir die<br />
Fenster. Wenn wir das jeweils eine Stunde lang machen,<br />
dann haben wir alle dieselben Taler erbracht. Jeder hat<br />
eine Stunde gegeben und eine Stunde bekommen, dann<br />
sind wir wieder alle auf Null. Aber wenn nur ich zum Beispiel<br />
Ihre Wäsche bügle, dann habe ich 20 Taler. Und<br />
von den 20 Talern zahle ich dann 2 oder 3 Taler Kontogebühr,<br />
dann habe ich immer noch 17 Taler, mit denen<br />
ich noch irgendwo einen Dienst in Anspruch nehmen<br />
kann. Diese Taler sind nicht materiell da, sondern das<br />
ist eine imaginäre Währung, die nur auf dem Computer<br />
bzw. auf dem Konto ist.<br />
TN: Wer hat sich das mit den Tauschringen ausgedacht?<br />
Josella Stolz: Das ist schon uralt. Einer der Vordenker war<br />
Silvio Gesell. Dann gab es ja diesen tollen Artikel von dem<br />
Tauschring in Österreich, wo nach dem Krieg praktisch ein<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 71
72<br />
Workshop SOS - Eltern in Not<br />
SOS - Eltern in Not<br />
Dorf nur über den Tauschring überlebt hat. Der Bürgermeister<br />
hatte die Idee, weil die Wirtschaft am Boden lag. Dann<br />
haben die Leute einfach getauscht.<br />
TN: So wie jetzt in der Wirtschaftskrise...<br />
Josella Stolz: Ich habe unseren Professor Hermann malgefragt:<br />
Hermann, wie kommst du in den Tauschring als<br />
Professor? Da hat er gemeint, ja, es kommt die Zeit, wo ihr<br />
viele solche Leute<br />
wie mich braucht.<br />
Der kennt sich gut<br />
aus und hält jetzt<br />
am Montag einen<br />
Vortrag zum Thema<br />
„Bankenkrise und<br />
Tauschring“. Ja,<br />
wenn alles am Boden<br />
liegt, Tauschring<br />
läuft weiter.<br />
TN: Kann man einen Tauschring initiieren oder muss der<br />
wachsen in den Köpfen?<br />
Josella Stolz: Also einer muss anfangen.<br />
TN: Solche Initiativen von unten, die von Bewohnern gegründet<br />
worden sind, so wie unser Tauschring in Kreuzberg,<br />
das sind aus meiner Sicht die tragenden Tauschringe. Es<br />
gibt viele Versuche von Tauschringen über ABM-Stellen<br />
usw. Das funktioniert nicht, weil das nicht wirklich gewollt<br />
und mitgetragen wird.<br />
TN: Das braucht ja Menschen, die mit Begeisterung die<br />
anderen überzeugen.<br />
Josella Stolz: Man muss dahinter stehen.<br />
TN: Das merkt man auch bei Ihnen.<br />
Josella Stolz: Danke. Ich stehe auch voll dazu, das ist das<br />
Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, weil<br />
es einfach toll ist, wenn ich die Menschen sehe, wie die<br />
miteinander befreundet sind und glücklich sind, wenn sie<br />
sich sehen.<br />
Herbert Scherer: Das ist eigentlich ein wunderbares<br />
Schlusswort. Vielen Dank für die Vorstellung. Wir machen<br />
jetzt einen großen Bogen und kommen zu der Frage, wie<br />
Eltern unterstützt werden können, deren Kinder nicht Opfer,<br />
sondern Täter sind.<br />
Dirk Fischer: Ich habe grundsätzlich ein Problem damit,<br />
bei Rechtsextremisten per se von Tätern zu sprechen.<br />
Ich komme aus der Straßensozialarbeit, d.h. Streetwork,<br />
ich habe drei Jahre lang Streetwork am Zoo gemacht und<br />
danach 12 Jahre bei Gangway gearbeitet. Und ich bin<br />
als Streetworker in Hohenschönhausen, Lichtenberg und<br />
Prenzlauer Berg rumgelaufen. Ich bin ständig im Osten<br />
unterwegs gewesen. Ich habe die Entwicklung von Rechtsextremismus<br />
im Osten miterlebt.<br />
Eine logische Schlussfolgerung daraus ist, dass ich mich<br />
dieses Themas auch weiterhin annehme. Ich hatte immer<br />
mit rechtsextremistisch orientierten Jugendlichen zu tun<br />
in meiner täglichen Arbeit und bin auf die Art und Weise<br />
zu Exit gekommen.<br />
Exit ist bundesweit das einzige Aussteigerprogramm für<br />
Rechtsextremisten, das finanziell nicht auf staatlichen Füßen<br />
steht. Wir können uns leider nicht als NGO bezeichnen,<br />
weil wir von Sonderprogrammen und Bundesmitteln<br />
leben. Aber wir sind keiner Partei verpflichtet, wir sind keiner<br />
Institution verpflichtet, wir sind eigentlich niemandem<br />
verpflichtet – außer unserem humanistischen und demokratischen<br />
Weltbild.<br />
Dass Exit jetzt nicht mehr existiert hat damit zu tun, dass<br />
man im Bundesministerium für Arbeit die Förderung zum<br />
31.10. 2008 eingestellt hat. Daran hängen Fördermittel,<br />
die über Xenos gelaufen sind. Wer sich ein bisschen mit<br />
Finanzierungskriterien auskennt, der weiß, dass zu jeder<br />
Finanzierung eine Ko-Finanzierung gehört usw. Das ist uns<br />
jetzt alles weggebrochen.<br />
Unter dem Aussteigerprogramm Exit, wo sich Rechtsextremisten<br />
hinwenden können, wenn sie die rechtsextremi-
stische Szene verlassen wollen, gibt es eine Familienhilfe.<br />
Der Begriff der Familienhilfe ist von uns so festgeschrieben<br />
worden: Familie heißt für uns Mutter, Vater, Oma, Opa, Tante,<br />
Onkel, Patentante, Patenonkel, Lehrer, Erzieher, Bruder,<br />
Schwester, andere Betroffene, Multiplikatoren im Umfeld<br />
des von Rechtsextremismus betroffenen Menschen.<br />
Obwohl Rechtsextremismus ja kein Jugendphänomen ist,<br />
ist natürlich die Hauptklientel, die wir betreuen, Eltern von<br />
Jugendlichen, oder Großeltern oder Tanten oder Onkel,<br />
Lehrer, Lehrausbilder, Betreuer, z.B. aus Freizeiteinrichtungen.<br />
Aber der Hauptanteil der Personen, mit denen wir<br />
– oder ich – zu tun hatten, waren Eltern von männlichen<br />
Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 28 Jahren.<br />
So viel möchte ich gar nicht zur Arbeit sagen, die wir geleistet<br />
haben. Ich möchte eher – dem Thema geschuldet<br />
– was dazu sagen, wie Netzwerke entstehen können bzw.<br />
was es verhindert, dass Netzwerke entstehen. Dazu muss<br />
ich weiter ausholen:<br />
Exit als Projekt bzw. die Familienhilfe als Projekt ist bundesweit<br />
tätig gewesen, mit Sitz in Berlin. Es entstehen<br />
rein finanzielle, personelle und auch kommunikative Probleme,<br />
wenn man eine ernsthafte Betreuung leisten will,<br />
etwa in Saarbrücken. Wir haben Fälle betreut im Saarland,<br />
in Thüringen, in Dortmund, in Hamburg, Darmstadt,<br />
Frankfurt/Oder, in Lübben, im Berliner Raum, so dass das<br />
mit immensem Aufwand verbunden ist, da unser Projekt<br />
nur zwei Mitarbeiter hat.<br />
Die Betreuung läuft am Anfang immer über Telefon bzw. E-<br />
Mail. Über Telefon und E-Mail kann man viel regeln. Wenn<br />
sich eine Betreuung aber zu einer echten Betreuung<br />
entwickelt, kommt man an einem persönlichen Kontakt<br />
nicht vorbei. Nun kann man sich vorstellen, dass die Reisetätigkeit<br />
von Berlin in die entlegenen Winkel der Bundesrepublik<br />
nicht nur mit einem immensen finanziellen,<br />
sondern auch zeitlichen Aufwand zu tun hat, so dass die<br />
Initiierung und Betreuung von Netzwerken Betroffener ein<br />
integraler Bestandteil unserer Arbeit geworden ist. Sobald<br />
in einem Gebiet mehr als zwei Betroffene auf einem Haufen<br />
waren, haben wir versucht, da ein ganz niedrigschwelliges<br />
Netzwerk zu initiieren. Setzen Sie sich doch mal in<br />
Verbindung, tauschen Sie sich aus, gucken Sie, was Sie<br />
zusammen machen können, wir begleiten das.<br />
Das hat uns sehr viel Arbeit erspart. Das hat uns z.B. Reisekosten<br />
erspart. Das hat uns auch – so blöde das klingt<br />
– Zeit erspart, E-Mails zu schreiben, das hat uns Telefonkosten<br />
erspart, weil man das dann nur einem sagen muss,<br />
der es weiterträgt – der Netzwerkgedanke.<br />
Die Problematik an solchen Netzwerken ist natürlich die,<br />
dass die nur so lange interessant sind, wie die Mitglieder<br />
dieses Netzwerks Betroffene sind. Sobald eines dieser<br />
Netzwerk-Mitglieder sagt: Okay, für mich ist das Problem<br />
weg, ich habe kein Interesse mehr, kann es sein, dass das<br />
ganze Netzwerk zusammenbricht. Netzwerk ist ein großer<br />
Begriff, im Grunde genommen sind vier Leute, die über<br />
dasselbe reden, schon ein kleines Netzwerk. Wir wissen<br />
selber, das kann funktionieren, wenn man ein Thema hat,<br />
an dem man arbeiten kann, das alle betrifft, der Betroffene<br />
ist oftmals der beste Ratgeber für andere Betroffene.<br />
Wenn man das von außen begleitet und ein bisschen steuert,<br />
dann ist das sehr hilfreich und Erfolg versprechend.<br />
Natürlich ist so eine Netzwerkbildung nicht immer gewollt.<br />
Wenn sich Eltern zusammenrotten, um ihre Söhne aus einer<br />
Kameradschaft rauszuholen, dann ist das der Kameradschaft<br />
natürlich nicht lieb. Auf der anderen Seite gibt<br />
es Feuer aus Richtungen, aus denen man das nicht erwartet<br />
hat. Ich habe in der gesamten Tätigkeit keine Unterstützung<br />
von Jugendämtern bekommen. Die Jugendämter<br />
haben gesagt, nein, Ideologie ist nicht unser point of view,<br />
die Ideologie muss draußen bleiben, uns geht es nur um<br />
den Jugendlichen und seine Eltern. Ich habe mit Jugendämtern<br />
telefoniert und das letzte Wort von der anderen<br />
Seite war: Ich vermittle Sie mal in unsere Fachaufsicht.<br />
Ich dachte, mit wem rede ich da? Rede ich da mit Sozialarbeitern<br />
oder Sozialpädagogen oder mit wem? Es geht<br />
doch darum, die Eltern zu stärken und den Jugendlichen<br />
da rauszuholen. Das ist doch wohl eine Kernaufgabe eines<br />
Jugendamtes. Aber das war nicht so.<br />
Herbert Scherer: War das im Osten und im Westen<br />
gleich?<br />
Dirk Fischer: Es gibt da keine Unterschiede.<br />
TN: Wie haben Sie sich gewehrt?<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 73
74<br />
Workshop SOS - Eltern in Not<br />
SOS - Eltern in Not<br />
Dirk Fischer: Das ist immer ein bisschen problematisch,<br />
weil ich ja derjenige war, der um Unterstützung gebeten<br />
hat. Wenn ich die nicht bekam, konnte ich sagen: Danke<br />
für das Gespräch. Oder wir sind dann auch andere Wege<br />
gegangen. Wir haben die Eltern dabei unterstützt, sich an<br />
die Presse zu wenden.<br />
Der Netzwerkgedanke hat uns sehr viel Arbeit erleichtert,<br />
nicht abgenommen, aber erleichtert. Das Beispiel Saarbrücken<br />
hat wirklich sehr gut funktioniert. Einen großen<br />
Beitrag hat dazu geleistet, dass sich zwar die Eltern nicht<br />
kannten, aber dass die Söhne in der gleichen Kameradschaft<br />
waren. Da konnten über ganz kurze Wege Kontakte<br />
hergestellt werden, weil sich die Jungs kannten. Das hat<br />
einen Besuch in Saarbrücken erfordert, um da ein Netzwerk<br />
anzuschieben, das nach einer Anlaufphase von zwei<br />
Monaten, die recht intensiv betreut wurde, von alleine<br />
funktionierte. Das hat dann auch krakenartig um sich<br />
gegriffen, weil die Eltern, die da involviert waren, Leute<br />
waren, die – Gott sei Dank – wirklich dahinter gestanden<br />
haben. Sie haben das Ding dann weitergetragen und sich<br />
engagiert, auch nachdem ihre Söhne da raus waren. Das<br />
sind so positive Zufälle, mit denen muss man rechnen, ansonsten<br />
kann man es irgendwie auch lassen.<br />
Ich denke, dass die Initiierung von Netzwerken, gerade von<br />
Betroffenen- Netzwerken, in der Zeit nachlassender staatlicher<br />
Maßnahmen extrem wichtig ist. Ich sagte ja schon,<br />
es gibt keinen besseren Berater als den Betroffenen. Weil<br />
der weiß, wovon er redet, er weiß, was er erlebt hat und<br />
er kann sich mit betroffenen Leuten auf Augenhöhe unterhalten.<br />
Mir ist das und das passiert, erzähl doch mal<br />
deins. Wenn ich als Berater oder als Sozialpädagoge reinkomme,<br />
dann habe ich keine Innensicht, sondern nur die<br />
Sicht darauf. Ich kann 1000 Bücher gelesen haben und<br />
bei 95 Fortbildungen zu dem Thema gewesen sein, aber<br />
ich weiß nicht, was eine Mutter fühlt, die ihren Sohn aus<br />
der rechtsextremen Szene loseisen will. Ein Betroffenen-<br />
Netzwerk ist das Beste, was einem Helfer passieren kann.<br />
Wenn es ihm gelingt, so was in die Wege zu leiten, wo Leute<br />
sich miteinander vernetzen und vernetzen wollen, die<br />
unter derselben Repressalie leiden.<br />
Ich habe oftmals Feedback von betroffenen Eltern oder<br />
Müttern oder Vätern gekriegt, die sich bedankt haben:<br />
Danke, dass Sie mir erst mal zugehört haben. Viele Eltern,<br />
mit denen wir zu tun hatten, hatten eine Odyssee hinter<br />
sich. Das fing an bei den Lehrern, über den Schulsozialarbeiter,<br />
über die Polizeidienststelle, über den Verfassungsschutz,<br />
über den Staatsschutz, über sonst wen, und jeder,<br />
zu dem sie gekommen sind, hat ihnen gesagt: Wir danken<br />
Ihnen sehr für Ihr zivilbürgerliches Engagement, aber gehen<br />
Sie doch mal da hin. Das war auch bei der Kirche nicht<br />
anders: Viele Leute haben als letzten Ausweg den Pastor<br />
besucht. Der hat dann gesagt: Es tut mir herzlich Leid.<br />
Dann sind sie zu uns gekommen, merkwürdigerweise erst<br />
dann, und haben sich bedankt für 2 ½ Stunden Zuhören.<br />
Sie haben alle nicht zugehört. Es gibt Aussteigerhilfen, die<br />
nicht so funktionieren wie wir. Z.B. eine Ausstiegshilfe, die<br />
vom Verfassungsschutz initiiert ist, möchte Informationen<br />
aus der Szene haben. Die begreifen sich selber nicht als<br />
ein Hilfsangebot für jemand, der raus will. Sie sagen: Okay,<br />
ich helfe dir da raus, aber dafür will ich das und das wissen,<br />
wie kommen wir da zueinander?<br />
TN: Wie kann die Aufbauarbeit oder die Betreuungsarbeit<br />
aussehen? Wie bauen wir ein Netzwerk auf? Wie war das<br />
z.B. in Saarbrücken?<br />
Dirk Fischer: In Saarbrücken war es so, dass sich relativ<br />
zeitgleich zwei Familien bei uns gemeldet haben, die sich<br />
nicht kannten. Das ging dann eine zeitlang über Telefon<br />
und über E-Mail, bis wir – mein Kollege und ich – meinten,<br />
wir müssen da mal runter, weil das so nicht geht. Das kann<br />
man nicht alles am Telefon erledigen, weil sich um diese<br />
Sache Gespinste weben, darin waren schon zu viele Leute<br />
involviert, da war die Polizei involviert, das Jugendamt war<br />
schon involviert. Wir sind dann runtergefahren und haben<br />
uns mit den Leuten an einen Tisch gesetzt, ganz konspirativ,<br />
ich kam mir vor wie zu DDR-Zeiten.<br />
Wir haben uns in einer Hotelhalle getroffen und uns miteinander<br />
unterhalten. Dann kam raus, dass die Söhne<br />
sich kannten, weil sie beide zusammen in der gleichen Kameradschaft<br />
waren. Dann haben wir gesagt: Sie kennen<br />
sich jetzt und über Ihre Söhne lernen Sie andere Leute<br />
kennen. Die sind ganz von sich aus nach außen gegangen<br />
und haben nach den Eltern gesucht, die da mit dran betei-
ligt waren. Eigentlich haben sie sich ein eigenes Hilfsnetzwerk<br />
geschaffen. Ich saß hier in Berlin und dachte, okay,<br />
so einfach kann es sein.<br />
Das war sehr erhebend, weil ich gesehen habe, wie es<br />
funktionieren kann. Wir haben im Grunde genommen die<br />
Regiestelle in Berlin gehabt und mussten nur noch auf<br />
Fachfragen reagieren, für die wir sowieso immer Ansprechpartner<br />
sind, also auch für Lehrer und Erzieher. Aber da<br />
haben wir auf die Fachfragen der Eltern reagiert, die dann<br />
sowohl ins Juristische, als auch in die Jugendhilfe gingen.<br />
Ich habe mich wirklich am Telefon mit dem Jugendamt in<br />
Saarbrücken gefetzt, weil ich meinte, dass es nicht gesetzeskonform<br />
sei, wie sie vorgehen.<br />
TN: Also die Eltern hätten Hilfe zur Erziehung gebraucht,<br />
die sie nicht bekommen haben?<br />
Dirk Fischer: Ja, die haben sie nicht bekommen, weil das<br />
Jugendamt gesagt hat, dass es mit Politik nichts zu tun<br />
haben will.<br />
TN: Es geht ja darum, den Jugendlichen beim Ausstieg zu<br />
helfen. Aber in dem Fall waren es ja die Eltern, die kamen,<br />
während die Jugendlichen noch nicht das Bedürfnis hatten<br />
auszusteigen?<br />
Dirk Fischer: Wir haben uns immer so verstanden, dass<br />
wir ein Hilfeangebot für die Personen um die Jugendlich<br />
herum sind. Beim zweiten oder dritten Treffen hat man die<br />
Personen, um die es eigentlich geht, mit am Tisch.<br />
TN: Eigentlich geht es ja darum, dem Jugendlichen zu<br />
helfen auszusteigen, der aber erst mal gar nicht dieses<br />
Bedürfnis hat. Das halte ich für eine große Schwierigkeit<br />
dabei.<br />
Dirk Fischer: Den Ausstieg können wir nicht bewerkstelligen.<br />
Aber wir können die Eltern beraten, wie sie damit<br />
umgehen, dass ihr Sohn entweder rechtsextremistisch orientiert<br />
ist oder rechtsextremistisch organisiert ist. Ich<br />
habe auch Eltern schon gesagt, dass sie ihren Sohn bei<br />
der Polizei anzeigen sollen, wenn sie sich nicht mehr zu<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 75
76<br />
Workshop SOS - Eltern in Not<br />
SOS - Eltern in Not<br />
helfen wissen und sie vom Sohn körperlich bedroht werden.<br />
Das geht manchmal nicht anders. Das ist zwar ein<br />
Schritt, den man Eltern relativ ungern ans Herz legt.<br />
TN: Das Netzwerk in Saarbrücken hat funktioniert. Versteht<br />
ihr eure Rolle so, dass ihr aktiv mit denen im Kontakt<br />
bleibt oder nur dann, wenn Eltern nachfragen?<br />
Dirk Fischer: Wir haben einen Turnus entwickelt. Sobald<br />
wir 14 Tage lang nichts mehr von irgendwo gehört haben,<br />
haben wir selber angerufen. Manchmal gab es noch Bedarf,<br />
aber meistens mussten wir gar nicht zurückrufen.<br />
Wenn man nach 14 Tagen nachfragt, wie es denn aussieht,<br />
und die Antwort ist, dass es sich erledigt hat, dann<br />
kann man nur noch nach dem Warum fragen. Aber wenn<br />
es sich erledigt hat, dann hat es sich erledigt, da ist dann<br />
auch die Obhutspflicht nicht mehr da.<br />
TN: Wie hoch ist denn die Erfolgsquote, wenn man das so<br />
nennen kann? Was ist Erfolg in so einem Fall? Wenn Eltern<br />
oder Verwandte anrufen, dann ist ja ein Erfolg auf jeden<br />
Fall, wenn die wieder in Kontakt mit ihrem Sohn kommen.<br />
Manchmal haben sie ja auch Kontakt, aber einen gewalttätigen.<br />
Es ist sicherlich schwierig zu sagen, was da ein<br />
Erfolg ist. Der maximale Erfolg wäre, dass das Kind tatsächlich<br />
aus der Gruppe rauskommt.<br />
Dirk Fischer: Nein. In meiner Tätigkeit dort habe ich mich<br />
nicht als den Chefideologen begriffen. Mit den Jugendlichen,<br />
um die es eigentlich ging, habe ich sehr selten politisch-ideologische<br />
Kontroversen geführt. Ich habe mich da<br />
eher in der Profession als Sozialarbeiter begriffen – oder<br />
als Unterstützer. Der der Familie hilft eine Kommunikationsstruktur<br />
aufzubauen, sowohl mit ihrem Kind, als auch<br />
untereinander wieder, und ich habe die Unterstützerfunktion,<br />
Hilfe einzufordern und zwar nicht bei uns, sondern<br />
bei den Stellen, die wirklich helfen können, Polizei, Jugendamt,<br />
Staatsschutz, was auch immer.<br />
Ganz oft war die zweite oder dritte Frage am Telefon: Was<br />
habe ich denn falsch gemacht? Wo ich dann sage: Sie haben<br />
überhaupt nichts falsch gemacht. Ihr Sohn ist 16, 17,<br />
18, der will als erwachsener Mensch behandelt werden,<br />
dann soll er auch seine Entscheidungen wie ein erwachsener<br />
Mensch treffen, und dann muss er auch damit leben.<br />
Sie haben dabei nichts falsch gemacht. Sie können nur<br />
sehen, wo Ihre Rolle auf dem Weg ist, den Ihr Sohn oder<br />
Ihre Tochter gehen möchte. Und wo er oder sie Ihre Unterstützung<br />
noch braucht oder wo Sie Ihr Kind laufen lassen<br />
müssen im schlimmsten Fall.<br />
Ich habe ja nicht das Allheilrezept und ich bin auch nicht<br />
der Retter in der Not. Ich bin nur eine Anlaufstelle und im<br />
besten Fall dann auch eine Begleitung. Und dass solche<br />
Initiativen oder Netzwerke begleitet werden müssen, zumindest<br />
am Anfang, das ist extrem wichtig. Ich muss als<br />
Ansprechpartner für dieses Netzwerk und zum Teil auch<br />
als Koordinator unterwegs sein und muss für Fragen ansprechbar<br />
sein.<br />
TN: Wie wurden Sie finanziert?<br />
Dirk Fischer: Über das Ministerium für Arbeit.<br />
TN: Und die haben die Mittel gestrichen?<br />
Dirk Fischer: Nein, das ist ein falscher Zungenschlag. Die<br />
Förderung ist planmäßig ausgelaufen. Auf dieser Formulierung<br />
besteht besonders das Arbeitsministerium. Es gibt<br />
keine Anschlussfinanzierung.<br />
Herbert Scherer: Es gibt stattdessen ein neues Programm.<br />
Dirk Fischer: Na ja, da sagen die einen so, die anderen so.<br />
Also es gibt das Angebot des Arbeitsministeriums, ab April<br />
<strong>2009</strong> wieder eine Förderung zu geben. Wer sich allerdings<br />
auskennt, der weiß, dass nach einem halben Jahr die Arbeit<br />
von vorne losgehen wird. Man hält keine Kontakte<br />
über ein halbes Jahr aufrecht, selbst der Wohlmeinendste<br />
schafft das nicht.<br />
Josella Stolz: Ich finde diese Arbeit im Bereich Rechtsextremismus<br />
sehr wichtig, denn die Tendenz in diesem Bereich<br />
ist ja eher steigend. Ich hatte im Stern den Artikel<br />
über Exit gelesen, dass das Projekt bald zu Ende geht, und
war damals schon sehr betroffen. Gibt es da nicht Möglichkeiten,<br />
um so ein Projekt weiter zu erhalten? Zum Beispiel<br />
könnte man an jüdische Einrichtungen gehen, weil<br />
die ja direkt massiv betroffen sind. Die wollen ja mehr Sicherheit,<br />
zum Beispiel bei dem jüdischen Altersheim, was<br />
in Charlottenburg gerade gebaut wird. Dann müssen diese<br />
jüdischen Einrichtungen auch solche Projekte unterstützen.<br />
Oder sehe ich das falsch?<br />
Dirk Fischer: Mehr als Lippenbekenntnisse sind nicht<br />
drin. Ich verstehe nicht, warum Demokratie-Entwicklung,<br />
Toleranzförderung, Bekämpfung von Extremismus in der<br />
Bundesrepublik über Sonderprogramme und Fördertöpfe<br />
finanziert wird, was ja eigentlich eine originäre Staatsaufgabe<br />
ist. Aber nein, der Staat zieht sich da aus der Verantwortung<br />
und es wird nach Sonderprogrammen und nach<br />
Fördertöpfen geschrieen. Ich finde, da ist ein absolutes<br />
Ungleichgewicht drin. Da läuft was schief, das geht so<br />
nicht. Das wird uns auf die Füße fallen.<br />
neu erfunden werden. Und dann gibt es Leute, die die Fähigkeit<br />
haben, das Alte als was Neues so zu verkaufen,<br />
dass es in das nächste Förderprogramm reinpasst.<br />
Dirk Fischer: Es muss innovativ sein... Das AGAG, das Sonderprogramm<br />
gegen Aggression und Gewalt, aus den 90-<br />
er Jahren, das war ein Super-Programm, daraus sind ganz<br />
tolle Sachen entstanden. In der wievielten Fortsetzung<br />
sind wir jetzt mit Xenos?<br />
Herbert Scherer: Es wird nicht richtig geprüft, ob etwas<br />
Erfolg versprechend ist. Meistens ist das, was Erfolg versprechend<br />
ist, ja gar nicht unbedingt so innovativ, sondern<br />
es fußt auf Erfahrungen, die langfristig gemacht worden<br />
sind, und macht da weiter.<br />
Herbert Scherer: Jetzt kommen wir in eine sehr, sehr<br />
grundsätzlichen Diskussion.<br />
Dirk Fischer: ... und das wollten wir eben nicht.<br />
Herbert Scherer: Doch, das wollten wir schon. Wir leben<br />
in anderen Strukturen, nicht in Sonderprogramm-Strukturen,<br />
sondern in auf Dauer angelegten Strukturen, so<br />
verstehe ich z.B. Nachbarschaftshäuser. Das Problem ist<br />
möglicherweise, dass Dinge, die in die Regelstrukturen<br />
gehören, auch in unserem Denken in Sonderprogrammen<br />
aufgehoben zu sein scheinen. Da ist ja jemand, der sich<br />
drum kümmert, dann denkt man zu wenig daran, dass das<br />
eigentlich in die Fläche gehört. Deswegen ist es unheimlich<br />
wichtig, das Know-How weiterzutragen. Es muss aber<br />
da ankommen, wo auf Dauer gearbeitet wird. Es nützt<br />
nichts, aus dem Sonderprogramm das dauernde Sonderprogramm<br />
zu machen. Man muss langfristig vor Ort daran<br />
arbeiten, dass sich an dem Problem was ändert.<br />
Diese befristeten Sonderprogramme haben immer ihre eigene<br />
Logik, schon alleine, weil sie befristet sind. Dadurch<br />
müssen sie nach jedem auslaufenden Programm wieder<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 77
Workshop<br />
Wenn Eltern in die Schule gehen<br />
Lernen, einmischen, verändern<br />
für die Zukunftschancen der Kinder<br />
Inputs:<br />
Viola Scholz-Thies und Petra Sgodda<br />
(Gemeinwesenverein Heerstraße Nord)<br />
„Erziehung macht Spaß - Erziehungsführerschein“<br />
Semih Kneip (Gangway)<br />
„Zusammen lernen, Coaching und Konfliktmanagement -<br />
Erfahrungen aus der Arbeit an einer Grundschule<br />
in Neukölln“<br />
Moderation:<br />
Theo Fontana<br />
Viola Scholz-Thies: Ich arbeite im Gemeinwesenverein<br />
Heerstraße Nord. Meine Kollegin und ich machen dort<br />
den Eltern-Trainingskurs „Erziehung macht Spaß – Der<br />
Erziehungsführerschein“. Dieser Erziehungsführerschein<br />
wurde von zwei Mitarbeitern einer psychologischen Beratungsstelle<br />
in Viersen entwickelt, die gleichzeitig auch<br />
eine Erziehungsberatungsstelle ist. Das Konzept sieht 10<br />
Termine vor, jeweils drei Stunden.<br />
Zum Beginn geht es um eine Einführung und das Kennen<br />
lernen. Bei den Inhalten geht es um Erziehung/Beziehung,<br />
um deutlich zu machen, dass die Beziehung die<br />
Grundlage für jede Erziehung ist, um Erziehungsspiele,<br />
um Entwicklungsphasen. Es ist wichtig zu wissen, was ich<br />
von meinem Kind in welchem Alter erwarten kann. Zu den<br />
Themengebieten gehören auch Strafe, Regeln, Grenzen,<br />
Konsequenzen, Kommunikation, Konflikte, Entmutigung<br />
und Ermutigung, zum Abschluss Rückmeldung, Verabredungen<br />
für die Zukunft und dann, wie gesagt, die Nachtreffen.<br />
Die Erziehungskurse sind immer ähnlich aufgebaut, aber<br />
nicht gleich. Was hier unser Schwerpunkt sein soll, das<br />
sind die Nachtreffen, um die Eltern zu aktivieren, über den<br />
Kurs hinaus aktiv zu bleiben. Bei den Nachtreffen geht es<br />
darum, einen Austausch zu haben, in einem Forum, wo ich<br />
meine Schwierigkeiten und Probleme ansprechen kann.<br />
Das ist ein Kreis mit vertrauten Menschen, denn es sind<br />
dieselben, die auch in der Kursgruppe waren. Teilweise haben<br />
wir auch verschiedene Kurse zusammengeführt, das<br />
war unproblematisch. Wir haben jeweils zwei Stunden für<br />
die Nachtreffen vorgesehen, eine Stunde soll frei gelassen<br />
werden, in der anderen Stunde wollen wir die schon bekannten<br />
Kurs-Themen vertiefen.<br />
Im Vordergrund stehen die Selbstreflektion und Selbsterfahrungen.<br />
Es wird also viel von den Eltern gefordert, sie<br />
müssen ganz viel über sich selbst nachdenken, wie sie<br />
was gegenüber ihren Kindern machen, aber auch wie sie<br />
selber verschiedene Situationen erlebt haben. Darüber<br />
kommen sie dann auf mögliche Zusammenhänge zwischen<br />
ihren eigenen früheren Erlebnissen und wie sie die<br />
an ihre eigenen Kinder weitergeben.<br />
Die Arbeitsmethoden: Kleingruppenarbeit, Vorträge, Rollenspiele,<br />
praktische Übungen, das ist jeweils bunt gemischt.<br />
Die Erziehungsstile machen wir auch alle durch,<br />
Schwerpunkt ist der demokratische Erziehungsstil. Auch<br />
da müssen die Eltern sehr viel über sich nachdenken.<br />
Ganz wichtig ist auch, dass die Eltern angeregt werden<br />
sollen, mit anderen Eltern im Austausch zu bleiben.<br />
Die Eltern haben auch Wochenaufgaben. Zu jeder Einheit<br />
gibt es einen Fragebogen, den die Eltern mitnehmen<br />
und bis zur nächsten Stunde bearbeiten. Das wird dann<br />
noch mal gemeinsam durchgegangen. Hier sehen Sie die<br />
Konfliktlösungsmöglichkeiten. Das ist ein System, anhand<br />
dessen wird das Thema Konflikt angegangen.<br />
Ich bin immer wieder erstaunt, wie offen die Eltern sind.<br />
Zum Beispiel sprechen wir am Anfang darüber, wie sie selber<br />
Erziehung erlebt haben. Das sollen sie als Symbol ma-
len oder als Bild, so wie sie es mit 7 Jahren gemalt hätten,<br />
um den Anspruch, den sie selbst an sich haben, nicht so<br />
hoch anzusetzen. Da kommen schon erschreckende Dinge<br />
zutage. Da das sehr am Anfang steht, zweite Stunde,<br />
finde ich es ganz erstaunlich dass sie das vor einer noch<br />
relativ fremden Gruppe so offen erzählen, was ihnen alles<br />
passiert ist. Ganz oft finden sich dann dazu andere<br />
Eltern mit ähnlichen eigenen Erfahrungen. So entsteht<br />
untereinander das Gefühl, dass sie nicht alleine mit ihrer<br />
Situation sind und dass die Probleme nicht nur an ihnen<br />
liegen. Dass sie nicht schlecht sind oder was nicht können,<br />
sondern dass es ein Problem gibt, das andere Leute<br />
auch haben.<br />
Theo Fontana: Woher kommt dieser Vertrauensvorschuss?<br />
Viola Scholz-Thies: Wir haben relativ kleine Gruppen,<br />
höchstens 10 Teilnehmer.<br />
Petra Sgodda: Am Anfang haben die Eltern natürlich schon<br />
eine gewisse Scheu, es bedarf eines gewissen Zuspruchs.<br />
Aber es ist so, dass die Eltern sehr engagiert sind und sich<br />
dann darauf einlassen. Wir haben auch jedes Mal ein bisschen<br />
Angst vor dieser Situation, den Eltern mitzuteilen, was<br />
wir von ihnen wollen, aber es hat bisher immer funktioniert.<br />
Das ist der Schritt rein in die Auseinandersetzung, sie setzen<br />
sich mit ihrer eigenen Erziehung auseinander, um dann<br />
eine gewisse Barriere zu überschreiten, damit sie weiter<br />
daran arbeiten können. Das erlebt man wirklich jedes Mal,<br />
dass dann am nächsten Termin, eine Woche später, gleich<br />
schon Kontakte da sind und ein Austausch untereinander,<br />
es schafft eine produktive Basis für die weiteren Themen.<br />
Viola Scholz-Thies: Es gibt auch immer leichte Irritationen<br />
beim Malen: Was soll ich denn malen? Das dauert dann<br />
ungefähr 10 Minuten, dann fangen Einzelne an und irgendwann<br />
malen sie alle.<br />
Petra Sgodda: Das gilt auch für die Rollenspiele, die wir<br />
machen. Die haben wir bewusst drin gelassen. Wir überlegen<br />
uns immer wieder, ob das wirklich genau die Methode<br />
ist, die da günstig ist. Da haben wir manchmal Bedenken,<br />
aber auch das funktioniert bisher immer. Auch für ein bildungsärmeres<br />
Publikum sind Rollenspiele durchaus geeignet,<br />
sie lassen sich gerne darauf ein.<br />
Viola Scholz-Thies: Der Kurs stellt keine schnellen Lösungen<br />
bereit. Es geht keiner aus dem Kurs mit einem<br />
Methodenpapier – wenn ich das so und so mache, dann<br />
klappt alles. Sondern es gibt eine Entwicklung. Gerade<br />
die Gesprächstechniken oder Konfliktlösungsmuster, das<br />
muss alles verinnerlicht werden und wachsen, auch in der<br />
Interaktion mit der Familie und den Kindern. Wenn ich<br />
mich anders ihnen gegenüber verhalte, dann reagieren<br />
die natürlich auch anders, sie müssen sich nur erst darauf<br />
einstellen. Das ist ein Prozess, der länger dauert. Man<br />
muss den Eltern auch immer wieder sagen, dass sie nicht<br />
von sich erwarten sollen, dass alles gleich so klappt, wie<br />
sie das hier hören oder wie es wünschenswert wäre. Sondern<br />
das ist auch Übung und sie müssen mit den Kindern<br />
und auch mit sich selbst Geduld haben.<br />
Im Anschluss haben wir einen Fragebogen ausfüllen lassen,<br />
wie sie das Ganze sehen. Wir haben hier ein paar<br />
Antworten von Eltern, die das zum größten Teil positiv beurteilen.<br />
Zum Beispiel: Ich hätte nicht gedacht bzw. wollte<br />
nicht wahrhaben, wie verheerend Inkonsequenz ist. Ich<br />
bin ruhiger und gelassener geworden.<br />
Bei den Nachtreffen haben wir auch immer wieder gefragt,<br />
was sie sich denn noch wünschen. Sie wollen etwas zusammen<br />
mit den Eltern aufbauen, dass sie eine Anlaufstelle<br />
haben, wo sie ihre eigenen Interessen und Bedürfnisse<br />
mit einbringen können. So ein Kurs mit 10 Einheiten, das<br />
ist natürlich eine sehr begrenzte Zeit, einige wünschen<br />
sich, dass er länger dauert oder noch vertieft wird.<br />
Die Wünsche waren: die besprochenen Themen zu vertiefen,<br />
weitere Übungen zu machen, noch mehr Austausch,<br />
noch mehr zu Wort zu kommen, was ja nicht immer so<br />
ausführlich möglich ist, wenn man ein bestimmtes Thema<br />
in einer begrenzten Zeit durcharbeiten muss. Dann Vorpubertät,<br />
Umgang unter Geschwistern, das waren weitere<br />
Wünsche. Unser Kurs ist konzipiert für Kinder von 0 bis<br />
12 Jahren. Pubertät und ältere Kinder, das ist noch von<br />
ganz großem Interesse, was aber nicht speziell in dem<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 79
80<br />
Workshop Wenn Eltern in die Schule gehen<br />
Wenn Eltern in die Schule ...<br />
Kurs behandelt werden kann. Der Altersunterschied zwischen<br />
den Geschwistern, Geschwisterkonstellationen, wie<br />
gehen sie miteinander um, wie sollte ich darauf eingehen?<br />
Was ist zu machen, wenn der Partner nicht mit zum Kurs<br />
kommt und belächelt, was ich mit nach Hause bringe und<br />
umsetzen will? Auch ein ganz großes Problem: wie kann<br />
man sich selbst helfen, Souveränität zu bewahren, zum<br />
Beispiel auch dem Partner gegenüber? Sie wünschen sich<br />
Verlängerungskurse, also mehrere Einheiten, wo man die<br />
Zeit vielleicht aufteilen kann in eine Stunde Nachtreffen,<br />
eine Stunde ein neues Thema. Das haben wir für die Zukunft<br />
aufgegriffen.<br />
Es wird ein extra Väter-Kurs gewünscht, weil die Mütter die<br />
Hoffnung haben, dass ein getrennter Kurs vielleicht besser<br />
von Männern angenommen wird. Sie wünschen sich<br />
einen Leitfaden für die Zukunft ihrer Kinder, also auf was<br />
man achten muss, wenn das Ende der Schule in Sicht ist.<br />
Sie wünschen sich Informationen über mehrsprachige Erziehung<br />
und die Auswirkungen davon. Wie können sie die<br />
Eigenverantwortung ihrer Kinder stärken? Wie kommen<br />
sie überhaupt<br />
noch an sie<br />
ran, wenn die<br />
in der Pubertät<br />
dicht machen?<br />
Wie erziehe<br />
ich zur Selbstständigkeit,<br />
im<br />
Haushalt und<br />
im Umgang mit<br />
Geld?<br />
Einige hätten gerne ein Nachtreffen mit kleineren Kindern<br />
zusammen, zum Kennen lernen, zum Verabreden, für gemeinsame<br />
Unternehmungen, vielleicht zum gegenseitigen<br />
Babysitten. Sie wünschen sich noch intensiveres aktives<br />
Zuhören, dieses Vier-Ohren-Modell. Manche haben auch<br />
Kinder mit ADHS und möchten dazu nähere Informationen<br />
und einen Austausch mit anderen Betroffenen. Sexualität,<br />
Aufklärung, das ist auch für die Älteren dann. Wie gehe ich<br />
mit Gewalt um? Oder auch wenn das Kind Gewalt ausübt.<br />
Drogensucht, Computer, Alkopops, alles, was so täglich zu<br />
lesen ist. Jugend- und Kindersprache, Sprachentwicklung,<br />
Ess-Störungen in alle Richtungen. Also man sieht schon,<br />
dass die Eltern vielseitig interessiert sind. Und im Prinzip<br />
möchten sie mehr, als wir ihnen im Moment anbieten<br />
konnten.<br />
Wir haben neun Kurse in den vergangenen drei Jahren<br />
absolviert. Wir dachten zuerst, dass ein Nachtreffen pro<br />
Monat reicht. Aber wir haben festgestellt, dadurch, dass<br />
da noch soviel Bedarf an Themen ist, die weiter bearbeitet<br />
werden sollen, ist das nicht ausreichend. Die Eltern wollen<br />
mehr Futter, gerade zur Pubertät, denn dazu gibt es sehr<br />
wenig. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir daran<br />
anknüpfen und ein Erziehungsnetzwerk aufbauen.<br />
Den Anfang bildet eine Gruppe von Eltern, die den Kurs<br />
abgeschlossen und weitergehendes Interesse hat. Sie haben<br />
die Möglichkeit, selber Themen einzubringen. Und es<br />
sollen Fachleute zu gewissen Themen kommen. Und es<br />
soll der Raum da sein für gegenseitigen Austausch. Das<br />
erste Treffen ist jetzt an einem Samstagvormittag, für<br />
Kinderbetreuung ist gesorgt, mit Frühstück, das ist also<br />
ein netter Rahmen, gleichzeitig wird ein Thema mit eingebracht.<br />
Das Ziel ist, dass die Gruppe sich irgendwann verselbstständigt.<br />
Ich denke, wenn bestimmte Themen abgearbeitet<br />
sind, da kann man punktuell noch in die Gruppe reinkommen,<br />
aber das Ziel ist eigentlich, dass es sich zu einer<br />
Gruppe entwickelt, die sich selber trifft und wo man die<br />
Initiative den Eltern übergeben kann. Das ist auch eine<br />
Festigung von dem, was sie im Erziehungsführerschein<br />
gelernt haben. Diese Gruppe ist für alle offen, die daran<br />
teilgenommen haben, aber auch für diejenigen, die sich<br />
informieren oder das auch machen möchten. Das soll ein<br />
niedrig schwelliges Beratungsangebot sein, um Kontakte<br />
zu knüpfen und um Schwellenängste abzubauen.<br />
Wir sind eng vernetzt mit dem Gesundheitsdienst. Die<br />
schicken uns auch viele Leute. Ich denke, das kann man<br />
mit dem Jugendamt noch ausbauen.<br />
Ein anderes großes Ziel ist, diese Gruppe zu den anderen<br />
Einrichtungen und Angeboten, die es im Stadtteil schon<br />
gibt, zu vernetzen. Zu der sozialen Beratung: es gibt ein<br />
Schulprojekt an der Schule, eine Schulbasis-Station,<br />
gleichzeitig eine Lernwerkstatt dazu, dieser Elternführerschein<br />
ist ein Teil davon, gesunde Ernährung und Bewe-
gung gehört noch dazu. Dem folgt dann die Verstetigung<br />
der Gruppe. Ziel des Netzwerkes ist es auch, die Ressourcen,<br />
die die Eltern haben, zu mobilisieren, ihre Wünsche<br />
aufzunehmen und damit ihre Verantwortlichkeiten und<br />
Kompetenz zu stärken.<br />
Die Bereitschaft zur Eigeninitiative haben schon einige<br />
signalisiert, indem sie auch mal auf andere Kinder aufpassen,<br />
Kontakte geknüpft haben. Wir haben über diesen<br />
Erziehungsführerschein schon sechs Ehrenamtliche<br />
gewonnen, die sich engagieren. Zwei sind parallel zum<br />
Erziehungsführerschein-Kurs da, um auf die Kinder der<br />
anderen aufzupassen. Die helfen bei Veranstaltungen mit,<br />
also sie sind aktiv mit eingebunden im Haus.<br />
TN: Ich bin Quartiersmanagerin hier Am Schlaatz, aber<br />
auch in anderen Gebieten in Potsdam. Wo sehen Sie selber<br />
– außer vom zeitlichen Rahmen her – die Grenzen dieses<br />
Erziehungsführerscheins? Für mich klang Ihre Darstellung<br />
ausschließlich positiv: Wenn die Eltern das machen, brauchen<br />
sie nichts anderes mehr, um das provokativ zu sagen.<br />
Zum anderen die Motivation der Eltern, da überhaupt<br />
hinzugehen? Es werden Eltern vom Gesundheitsdienst geschickt,<br />
es klang auch irgendwie nach einem finanziellen<br />
Anreiz?<br />
Petra Sgodda: Den finanziellen Anreiz gab es damals, als<br />
der Kurs entwickelt wurde. Die Entwickler hatten sich vorgestellt,<br />
dass jeder, der den Kurs absolviert, ein einmaliges<br />
Kindergeld in Höhe von damals noch 500 DM erhalten<br />
sollte. Dazu gibt es aber kein Nachfolgegesetz.<br />
TN: Ist aber immer noch beabsichtigt?<br />
Viola Scholz-Thies: Ja, aber ich weiß nicht, ob das weiter<br />
verfolgt wird. Dieser Kurs wurde von zwei Leuten<br />
aus einer Beratungsstelle konzipiert, also er hat kein so<br />
großes Forum wie zum Beispiel „Starke Eltern – starke<br />
Kinder“, was über den Kinderschutzbund läuft und dadurch<br />
einen ganz anderen Hintergrund hat. Deswegen<br />
denke ich, es wird schwierig, das umzusetzen, weil man<br />
dazu eben auch noch ein bisschen mehr Zeit und Ressourcen<br />
braucht.<br />
Natürlich hat der Erziehungsführerschein Grenzen. Es ist<br />
kein Kurs, wo die Eltern rausgehen und sagen: So, jetzt<br />
habe ich alles in der Hand, jetzt wird sich sofort alles ändern.<br />
Also in Kinderschutzfällen, wenn es brennt, kann<br />
man ihn vielleicht parallel machen. Aber er ist nicht das<br />
Allheilmittel, das in einer akuten Krise die Familie rettet.<br />
Aber Petra ist auch in der ambulanten Familienhilfe tätig<br />
und kann dazu mehr sagen.<br />
Petra Sgodda: Es kommen 12 Eltern, manchmal auch 14.<br />
Am Anfang, wenn wir die ersten zwei Einheiten machen,<br />
fallen schon einige raus und kommen dann nicht mehr.<br />
Es spricht nicht alle Eltern an, aber die, die bleiben, mit<br />
denen können wir sehr gut arbeiten.<br />
Es werden auch immer mehr Eltern vom Jugendamt geschickt,<br />
woran man sehen kann, dass dort entsprechend<br />
einiges im Argen ist. Diese Eltern haben natürlich eine andere<br />
Motivation, weil sie sowieso schon mit dem Jugendamt<br />
arbeiten. Sie wollen wirklich eine Veränderung in ihrer Erziehung<br />
erreichen, mehr Souveränität, weil sie merken, dass<br />
sie es nicht schaffen. Da können wir dann auch helfen.<br />
Natürlich ist unser Angebot mit diesen zehn Einheiten<br />
begrenzt. Frau Scholz-Thies sagte schon, dass es manchmal<br />
ganz schwierig ist, gerade Themen wie Regeln und<br />
Grenzen, oder auch Konsequenzen, in zwei Stunden<br />
reinzupacken. Oft schaffen wir das dann auch nicht. Die<br />
Kommunikation zwischen Kindern und Eltern ist ein sehr<br />
umfangreiches Thema. Wir müssen es ja auch so umsetzen,<br />
dass es praxisnah ist, also dass es in der Familie<br />
umsetzbar ist, dass sie auch wirklich etwas mit ihrem<br />
neuen Wissen anfangen können. Wir wollen das nicht nur<br />
präsentieren, wir wollen – und wir üben das auch -, dass<br />
sie wirklich etwas mitnehmen. Deswegen sind wir uns<br />
natürlich froh, wenn es erfreuliche Rückmeldungen nach<br />
einem Kurs gibt.<br />
TN: Wie wird das finanziert? Zahlen die Eltern selber?<br />
Petra Sgodda: Nein. Wir sind ja Quartiersmanagement-<br />
Gebiet, Stadtteil-Management-Gebiet, Prävention. Dieses<br />
Schulprojekt mit seinen 5 Einheiten, davon ist der Erziehungsführerschein<br />
eine Einheit. Das ist finanziert über<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 81
82<br />
Workshop Wenn Eltern in die Schule gehen<br />
Wenn Eltern in die Schule ...<br />
das Programm Soziale Stadt bis Ende <strong>2009</strong>. Wir machen<br />
zwei Kurse pro Schulhalbjahr. Wir verteilen unseren Flyer<br />
an der Schule, an der das Projekt angedockt ist. Aber<br />
wir verteilen ihn auch in allen anderen Schulen, wir haben<br />
noch eine Grundschule im Gebiet, an die Kindergärten<br />
und an den Gesundheitsdienst.<br />
TN: Kommen die Eltern freiwillig?<br />
Petra Sgodda: Zum Teil kommen Eltern freiwillig, teilweise<br />
haben sie einen festgeschriebenen Hilfeplan, aber auch<br />
diese Eltern geben dann positive Rückmeldungen. In allen<br />
Kursen insgesamt waren zwei oder drei Elternteile,<br />
die sich da nicht haben reinziehen lassen, die ihre Zeit da<br />
nur abgesessen haben. Aber die meisten, auch durch die<br />
Dynamik der Gruppe, werden doch mit reingezogen und<br />
machen gerne mit.<br />
TN: Wie sieht dieser Elternführerschein aus? Was kriegen<br />
Eltern in die Hand, was steht da drauf?<br />
TN: Mir ist etwas noch nicht so deutlich geworden: Es kann<br />
in den Kursen ja nur das entstehen, was von den Eltern<br />
selber kommt. Wie weit werden Methoden empfohlen?<br />
Oder wie erarbeiten die Eltern untereinander, wo ihre Ressourcen<br />
sind, wie entdecken sie sich selber und bringen<br />
sich dann in diesen Kurs ein?<br />
Viola Scholz-Thies: Sie bekommen ein Zertifikat ausgehändigt,<br />
wo genau draufsteht, an welchen Themen bzw.<br />
Einheiten sie teilgenommen haben. Das bekommen sie<br />
nur, wenn sie 8 x da waren. Ansonsten können wir ihnen<br />
nur die Teilnahme bescheinigen ausstellen. Das Zertifikat<br />
wird mit großem Aufwand überreicht, mit Blümchen, entsprechender<br />
Gestaltung drum herum, also das machen<br />
wir schon ein bisschen feierlicher.<br />
Petra Sgodda: Manchmal denke ich, dass wir eine ganze<br />
Menge erwarten, wenn wir darauf eingehen, was Erziehung<br />
überhaupt ist. Das verpacken wir sprachlich so, dass<br />
es auch verständlich ist. Wir erwarten, dass sich die Eltern<br />
erst mal grob mit dem Thema Erziehung auseinandersetzen.<br />
Darauf baut sich die Beziehung auf. Was dazu gehört,<br />
was die Pflichten sind, diese grundlegenden Geschichten<br />
sind der Einstieg, also das Warm-Up. Dann gehen wir zu<br />
den Erziehungsstilen über. Da geht es schon los mit Rollenspielen.<br />
Viola Scholz-Thies: Da gibt es bereits Aha-Effekte. Spätestens<br />
wenn sie sich zusammen hinsetzen und für einen<br />
bestimmten Stil eine Rolle erarbeiten mit den anderen<br />
Eltern, dann kommen Bemerkungen wie: Hm, kommt mir<br />
bekannt vor. Das bringen sie dann auch mit rein. Oder<br />
sie fragen auch nach, was wir dann aufgreifen und mit<br />
den anderen zusammen noch mal erarbeiten, überlegen,<br />
diskutieren.<br />
Petra Sgodda: Bei den Themen Regeln, Grenzen, Kommunikation<br />
oder Konflikte lassen wir die Eltern erst<br />
mal reinlaufen, wir lassen am Anfang alles offen, wir<br />
geben nichts vor. Sie sollen sich erst mal selber damit<br />
auseinandersetzen, was sie darunter verstehen,<br />
bei Regeln und bei Kommunikation ist das ganz wichtig.<br />
Dann erarbeiten wir mit ihnen schrittweise, welche<br />
Möglichkeiten es gibt beim aktiven Zuhören, es gibt ja<br />
unterschiedliche Herangehensweisen. So versuchen<br />
wir den Eltern deutlich zu machen, welches in unserem<br />
Sinne ein Weg ist, den sie beschreiten können. Der<br />
eben auch so deutlich gemacht worden ist, dass sie<br />
sich daran entlang hangeln können, weil es ein sehr<br />
kompliziertes Thema ist.<br />
Und es soll ja eben Nachhaltigkeit erreicht werden. Wir<br />
suchen immer nach aktueller Literatur, um anhand von<br />
Textausschnitten bestimmte Inhalte zu verdeutlichen.<br />
Das muss einerseits straff sein, aber trotzdem verständlich<br />
und klar. Das ist immer wieder eine Herausforderung,<br />
natürlich immer wieder auch ein Ausbau der Methoden.<br />
Der Kurs verändert sich dadurch auch stetig.<br />
TN: Mir kommt es immer noch so vor, als wenn was vorgegeben<br />
wird. Wenn Eltern was vorgegeben kriegen, können<br />
sie es ja nicht unbedingt umsetzen. Wenn es nicht aus mir<br />
selber kommt und nicht zu mir passt, nicht zu meiner Situation<br />
und zu meiner Familie, dann kann jede Vorgabe schön
sein, aber ich kann sie trotzdem nicht gebrauchen. Da ist<br />
für mich noch ein Widerspruch. Aber das kann ja auch ein<br />
Verständnisproblem sein.<br />
Petra Sgodda: Nein, wir sollten es schon auflösen. Das<br />
ist ja genau der Punkt, daran müssen wir immer wieder<br />
arbeiten, dass es den Eltern auch vermittelt wird. Durch<br />
die Gespräche entsteht die Dynamik in der Gruppe, wir ziehen<br />
uns da auch ein Stück zurück. Wenn die Gespräche<br />
stattfinden, sehen wir ja, was schon bei den Eltern angekommen<br />
ist. Das ist unterschiedlich, trotzdem ist dieser<br />
Prozess, der da in Gang gesetzt wird, schon so, dass sie<br />
voneinander lernen. Wir erkennen daraus, dass sie wissen,<br />
wohin es irgendwann gehen soll. Sie kommen nicht<br />
aus dieser Lerneinheit und wissen danach genau, wie das<br />
läuft mit den Regeln, Grenzen, Konsequenzen. Wir sagen<br />
ihnen auch immer wieder, dass sie geduldig mit sich sein<br />
sollen, dass weiterhin Fehler passieren werden. Das ist<br />
ein wichtiger Punkt, damit nicht unnötig Druck aufgebaut<br />
wird. Die Literatur können sich die Eltern jede Woche mitnehmen,<br />
damit sie das Erarbeitete noch mal gedanklich<br />
vertiefen können.<br />
Viola Scholz-Thies: Jeder bekommt für sich einen Ordner,<br />
alles was wir gemacht haben, bekommen die Eltern als<br />
Memos in die Hand, auch die Arbeitsbögen mit den Aufgaben.<br />
Sie können noch was dazuschreiben und haben jederzeit<br />
die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen und noch<br />
mal nachzugucken, wenn zu Hause noch Fragen entstehen<br />
oder wenn sie es dem Mann zeigen oder erklären wollen.<br />
Petra Sgodda: Am Ende ist es natürlich nicht sicher, was<br />
davon zu Hause umgesetzt wird. Ab und zu fragen wir<br />
nach. Deswegen gibt es die Nachtreffen, weil ganz viel<br />
noch zu klären bleibt.<br />
TN: Ich habe eine Frage zu der Heterogenität in der Gruppe.<br />
Sie haben schon angedeutet, dass vorwiegend Mütter,<br />
also Frauen, diesen Kurs wahrnehmen. Warum ist das so?<br />
Werden direkt nur Mütter über das Jugendamt angesprochen?<br />
Gibt es auch Teilnehmer aus anderen Herkunftsländern?<br />
Viola Scholz-Thies: Wir hatten in zwei Kursen mit 20 Leuten<br />
nur vier Männer und 16 Mütter. Das ist ungefähr der<br />
Durchschnitt. Wir haben auch Teilnehmer aus anderen Ländern,<br />
aber wir haben festgestellt, dass es für diejenigen, die<br />
kein gutes Deutsch<br />
sprechen, sehr<br />
schwierig ist, gerade<br />
solche Themen<br />
anzugehen. Wir<br />
haben auch immer<br />
ein oder zwei Teilnehmer<br />
dabei, die<br />
gut Deutsch verstehen,<br />
da ist das kein<br />
Problem. Für die<br />
anderen Teilnehmer ausländischer Herkunft haben wir unsere<br />
ganzen Unterlagen in Türkisch und Russisch übersetzt.<br />
Wir haben auch schon mal mit einer türkischen Übersetzerin<br />
einen Kurs gemacht. Sie hatte als Teilnehmerin den Kurs<br />
selbst schon mitgemacht, da hatten wir sie angesprochen:<br />
So kam es, dass sie dann in einem Kurs übersetzt hat.<br />
Da wurde allerdings gesagt, dass es schön wäre, türkische<br />
Trainer zu haben, weil das, was sie an Gefühlen äußern, in<br />
der Übersetzung nicht so rüber kommt. Also da ist doch<br />
eine Grenze.<br />
TN: Mich interessiert ganz grundsätzlich vom Ansatz her:<br />
warum Erziehungsführerschein und nicht Selbsthilfegruppe,<br />
die zu bestimmten Themen Veranstaltungen oder einen<br />
Austausch organisiert? Warum wird die Rolle des Führerscheins<br />
eingenommen, ich komme mit nichts und kann<br />
es hinterher?<br />
Viola Scholz-Thies: Diejenigen die das entwickelt haben, hatten<br />
den Gedanken, dass man für alles einen Führerschein<br />
braucht, nur nicht für die Erziehung. Von daher haben sie es<br />
so genannt, auch als Anreiz für die Leute, weil sie dann was<br />
in der Hand haben. Das ist ein eingetragenes Zeichen, also<br />
wir können deswegen auch den Namen nicht ändern. Genau<br />
wie „Starke Eltern – starke Kinder“, das heißt so. Wenn<br />
wir die Kurse nach dem Prinzip machen, dann müssen wir<br />
auch den Namen Erziehungsführerschein verwenden.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 83
84<br />
Workshop Wenn Eltern in die Schule gehen<br />
Wenn Eltern in die Schule ...<br />
TN: Das Denken hinter diesem Prinzip, wird das von den<br />
Eltern auch akzeptiert?<br />
Viola Scholz-Thies: Teils, teils, es gibt auch kritische<br />
Stimmen.<br />
TN: Ich finde, die Eltern gehen eher zu einem Führerschein,<br />
den kann man ja jederzeit unterbrechen, als in ein Eltern-<br />
Trainings-Camp, wie es bei „Starke Eltern – starke Kinder“<br />
heißt. Eltern-Trainingskurs ist viel negativer besetzt, als ein<br />
Elternführerschein. So habe ich das jedenfalls von den Eltern<br />
gehört. Ich muss trainieren, Eltern zu werden.<br />
Petra Sgodda: Die Idee des Führerscheins ist hergeleitet<br />
von dem Inhalt, von den Grundbausteinen für die Erziehung,<br />
was die Beziehung Eltern-Kind eben ausmacht.<br />
Die Inhalte sind die Säulen. Es dient einfach der Souveränität<br />
und der Sicherheit im Umgang mit Konfliktsituationen.<br />
Das geht ja schon bei der Kommunikation<br />
los. Da sollen wesentliche Veränderungen stattfinden.<br />
So wie die Eltern uns das schildern, können wir davon<br />
ausgehen, dass sie die Idee verstanden haben. Und<br />
weil sie noch mehr positive Veränderungen möchten, ist<br />
auch der Wunsch nach einer Vertiefung und nach mehr<br />
Stoff da.<br />
TN: Es fehlt offenbar ein Forum, bei dem sich Eltern mit<br />
Eltern auseinandersetzen können, über ganz viele Fragen.<br />
Aber es gibt doch ganz viel Literatur.<br />
Petra Sgodda: Ja, aber es geht ja auch darum, dass man<br />
ein Problem relativ schnell auf den Punkt bringen kann,<br />
gerade in der Gruppe natürlich.<br />
TN: Meine Frage ging nicht in die Richtung des Bedarfes.<br />
Natürlich haben alle Eltern einen Bedarf an Austausch<br />
und zusätzlicher Information, sondern die Frage ist, mit<br />
welchem Blickwinkel auf die Eltern geht man an diesen<br />
Kurs ran? Eltern kommen mit nichts und können hinterher<br />
was, was hinter dem Wort Führerschein steckt? Im Selbsthilfe-Ansatz<br />
steckt ja was anderes dahinter.<br />
Viola Scholz-Thies: Die Stärkung der Erziehungskompetenz,<br />
das kriegen sie als Führerschein bescheinigt.<br />
TN: Haben Sie auch Ausschlusskriterien für die Aufnahme<br />
in den Kursen?<br />
Viola Scholz-Thies: Bis jetzt noch nicht.<br />
TN: Eine Mutter, die alkoholkrank ist und alkoholisiert zu<br />
dem Termin kommt, kann daran teilnehmen? Wie verhalten<br />
Sie sich da?<br />
Viola Scholz-Thies: Wir hatten das noch nicht.<br />
TN: Die Frage wird entschieden, wenn es soweit ist.<br />
Petra Sgodda: Ich denke, wenn sie ausfallend wird, dann<br />
müssten wir sie bitten, zu gehen, und das nächste Mal<br />
nicht alkoholisiert zu kommen.<br />
TN: Machen Sie Videoarbeit, Videofeedback, in Ihrem<br />
Programm?<br />
Petra Sgodda: Nein, noch nicht.<br />
TN: Ich arbeite im Nachbarschaftsheim Mittelhof im Bereich<br />
der Familienarbeit seit einigen Jahren, habe begleitete<br />
Elterngruppen, von Eltern, die Kinder in der Pubertät<br />
haben. Das Curriculum ist nicht so festgelegt, sondern am<br />
Anfang jedes Treffens: Was ist das Thema heute Abend?<br />
Meine Erfahrung ist immer wieder, dass es natürlich Fachwissen<br />
gibt, das durch die Kursleitung vermittelt oder eingebracht<br />
wird. Aber es ist enorm, wie viel bei den Eltern<br />
an Wissen schon da ist. Das kommt dann zum Vorschein,<br />
wenn das Gespräch läuft.<br />
Das heißt, bei diesen Kursen geht es häufig hauptsächlich<br />
darum, den vorhandenen Kompetenzen der Eltern,<br />
ihrer Wahrnehmungsfähigkeit, ihrem Einfühlungsvermögen,<br />
den eigenen Erinnerungen an das, was sie selber<br />
erlebt haben, einfach nur mal einen Raum zu geben.<br />
Dann geht das schon irgendwie durch die gegenseitige<br />
Beeinflussung in eine bestimmte Richtung und wirkt für
alle sehr inspirierend. Dann ist so ein Kurs hilfreich, wenn<br />
sie merken: ah, die Fachwelt bestätigt sogar, was ich insgeheim<br />
schon länger bei mir merke. Das unterstützt sich<br />
gegenseitig.<br />
Was ich auch immer wieder feststelle, das können Sie sicher<br />
bestätigen: Erziehung macht ja heute nicht unbedingt<br />
so viel Spaß, aber in den Kursen macht sie großen Spaß.<br />
Es ist wirklich immer so, dass viel gelacht wird.<br />
TN: Ja, stimmt, bei uns auch. Und die Motivation der Eltern.<br />
Ich meine, die kommen da hin, sie wollen was lernen,<br />
sie wollen was Neues umsetzen, sie wollen sich damit auseinandersetzen.<br />
Diese Energie, die sie mitbringen, das ist<br />
schon toll.<br />
TN: Ich will noch mal auf das Thema Führerschein kommen.<br />
Für mich hat ein Führerschein immer einen theoretischen<br />
und einen praktischen Teil. Trotz Rollenspiel, gibt<br />
es auch einen praktischen Übungsteil am Kind? Theorie<br />
klar, zu Hause wird die Praxis geübt?<br />
Viola Scholz-Thies: Viele erzählen zu Beginn der Stunde,<br />
was letzte Woche war oder was sie beschäftigt. Sie schildern<br />
uns die Situationen genau und die anderen Eltern sagen<br />
etwas dazu, so werden quasi auch praktische Sachen<br />
aufgegriffen.<br />
TN: Aber direkt mit Eltern und Kindern gemeinsam in kleinen<br />
Gruppen etwas zu machen?<br />
Viola Scholz-Thies: Nein, das hatten wir jetzt noch nicht.<br />
Aber wir stehen am Anfang von der Erweiterung dieser<br />
Nachtreffen und haben jetzt Ende November das erste<br />
Treffen mit Eltern und Kindern.<br />
TN: Wenn Leute vom Jugendamt geschickt werden, ich<br />
kenne das aus den USA und zum Teil aus Holland oder<br />
aus Istanbul, da gibt es Auflagen, dass beide Eltern kommen<br />
müssen. Aber zu Ihnen kommen Mütter, also nicht<br />
die Eltern.<br />
Petra Sgodda: Als Auflage gab es das bei uns auch schon,<br />
aber es war beides, mal Anregung oder Empfehlung, aber<br />
auch Auflage. Das war unterschiedlich, je nachdem, wie<br />
die Situation in der Familie ist.<br />
TN: Und wie ist das dann angenommen worden, wenn sie<br />
den Kurs als Auflage machen mussten? Wie ist die Motivation?<br />
Viola Scholz-Thies: Wie gesagt, zwei bis drei haben<br />
das nur abgesessen, aber die anderen haben sich auf<br />
die Gruppe eingelassen. Auch, weil andere Eltern mit<br />
ähnlichen Problemen da waren, wo sie auch Ansprechpartner<br />
hatten, wo sie sich nicht als Versager vorkamen.<br />
Ich denke, das hat ihnen sehr geholfen, sich in<br />
die Gruppe einzubringen, dann war das gar nicht mehr<br />
so schlimm.<br />
Petra Sgodda: Das war oft nicht nur eine Mutter, im Gespräch<br />
hat sich herausgestellt, dass mehrere Mütter über<br />
das Jugendamt zu uns gekommen sind.<br />
TN: Wie ist das Feedback vom Jugendamt?<br />
Petra Sgodda: Direkt mit dem Jugendamt stehen wir nicht<br />
in Verbindung, eher mit den Helfern. Uns ist es wichtig,<br />
dass sie das hier Erfahrene auch zu Hause mit den Helfern<br />
durchsprechen. Das passiert dann auch. Die Rückmeldungen<br />
sind durchweg positiv, dass sie den Eindruck<br />
haben, dass sich wirklich was verändert im Miteinander<br />
mit den Kindern bzw. in der Erziehung. Da das auch Kollegen<br />
von mir sind, stehen wir im Austausch.<br />
Viola Scholz-Thies: Mit dem Jugendgesundheitsdienst stehe<br />
ich eng in Verbindung, von da kam auch schon positive<br />
Resonanz, wenn Eltern den Kurs abgeschlossen haben.<br />
TN: In unserem Mehrgenerationenhaus in Kaltenkirchen/<br />
Schleswig-Holstein haben wir auch schon experimentiert<br />
mit Schule, Elterntraining, Elternlernwerkstatt, diese<br />
ganzen Begrifflichkeiten sind aber gar nicht so wichtig. Es<br />
geht immer um die Form, es geht um den Blick darauf,<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 85
86<br />
Workshop Wenn Eltern in die Schule gehen<br />
Wenn Eltern in die Schule ...<br />
um welche Eltern es sich handelt, mit wem kann ich eine<br />
Elternlernwerkstatt machen, mit wem muss ich andere<br />
Modelle entwickeln?<br />
Was wir zurzeit machen, läuft klasse, und das im Verbund<br />
mit dem Jugendamt. Wir haben das Jugendamt dafür gewonnen,<br />
ein Modell gemeinsam zu realisieren. Sie haben<br />
das Klientel mit Erziehungsproblemen. Und wir möchten<br />
gerne, dass wir im Familienzentrum das Modell entwickeln.<br />
Darauf sind sie eingestiegen, wir machen das jetzt<br />
seit gut drei Jahren, die Gruppe selber läuft seit 1 ½ Jahren,<br />
es kommen immer mehr Neue hinzu, es geht mal jemand.<br />
Wir sind dadurch im Dialog mit dem Jugendamt und<br />
arbeiten zusammen. Und da sieht man eben auch, dass<br />
sich was tut. Das könnte auch ein Modell sein, das andere<br />
sicherlich auch umsetzen könnten.<br />
Wir werden jetzt auch eine neue Form finden für Eltern, die<br />
solche Erziehungsgespräche von sich aus machen wollen.<br />
Während bei anderen so ein lockeres Modell in keiner Weise<br />
ausreicht, da muss es anders laufen. Aber das Verknüpfen,<br />
voneinander lernen, mit unterschiedlichen Modellen,<br />
ist nur hilfreich. Also insofern – ausprobieren, experimentieren.<br />
Wenn Sie mit Ihrem Programm arbeiten, da ist das<br />
sehr genau vorgegeben, was Sie reinnehmen?<br />
Viola Scholz-Thies: Es ist nicht so fest. Die Entwicklungsphasen<br />
sind wichtig, die haben wir mit reingenommen, die<br />
waren im Original nicht in dieser Intensität drin. Speziell<br />
sind wir auch auf die Entwicklung von Jungen eingegangen,<br />
weil die sich im Vergleich mit Mädchen sehr anders<br />
verläuft. Also das sind Sachen, die können wir schon ändern.<br />
Wir stehen auch im Austausch mit den Entwicklern,<br />
also wir haben schon Möglichkeiten.<br />
Theo Fontana: Die Frage ist, wie wir an die Eltern rankommen,<br />
weil wir denken, wir müssen den Eltern was<br />
beibringen, damit es den Kindern besser geht. Im nächsten<br />
Impulsreferat geht es um das Beziehungsfeld Kinder-<br />
Schule-Eltern.<br />
Semih Kneip: In der Einladung bzw. im Programm hat sich<br />
ein Tippfehler eingeschlichen, es heißt nicht „Zusammen<br />
leben“, sondern „Zusammen lernen“. Wir nennen es in der<br />
Fachöffentlichkeit „Dialogisches Coaching und Konfliktmanagement<br />
im Bündnis“. Und in diesem Falle, von dem ich<br />
erzähle, im Bündnis von Eltern, Lehrern und Lehrerinnen,<br />
Erziehern und Erzieherinnen. Ich arbeite bei Gangway e.V.,<br />
Verein für Straßensozialarbeit, in Berlin.<br />
Das Programm, das ich vorstelle, ist ein Kind des Kronberger<br />
Kreises für Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement.<br />
Professor Dr. Reinhart Wolff ist vielleicht bekannter<br />
als der Kronberger Kreis, Vater des Kinderschutzbundes,<br />
man sagt auch der Kinderladenbewegung, hat dafür letztes<br />
Jahr das Bundesverdienstkreuz bekommen. Der hat<br />
das Dialogische kreiiert.<br />
Wir haben mit diesem Programm 14 Monate lang in Marzahn-Hellersdorf<br />
gearbeitet, dann noch mal 13 Monate in<br />
Mahlsdorf. In Mahlsdorf war es eine explosive Mischung,<br />
Eltern auf der einen Seite, Erzieher einer stationären Einrichtung<br />
auf der anderen Seite, als Teilnehmer an diesem<br />
Setting. Und die Eltern, denen die Kinder durch die Sozialarbeiter<br />
des Jugendamtes aus der Familie rausgenommen<br />
und fremd untergebracht worden sind. Sie können sich<br />
vorstellen, welche Mischung wir hatten, weil ja da auch<br />
viel aus der Geschichte und Vergangenheit der Familien<br />
hoch kam.<br />
Es geht um Dialog, um Mehrseitigkeit. Die Essenz dieses<br />
Programms ist, sich nicht zu bevormunden, weil Eltern<br />
Bürger dieses Landes sind – und zwar Bürger 1. Klasse,<br />
wie alle, und nicht 2. Klasse. Sie sind Modell erwachsener<br />
Kompetenz, ob wir das wollen oder nicht, ob wir ihnen das<br />
zutrauen oder nicht, zunächst einmal ist es so. In der Regel,<br />
in modernen Gesellschaften zumindest, haben sie das<br />
Recht, ihre Kinder zu erziehen. Das ist nicht überall so.<br />
Von daher glauben wir, müssen Eltern Erziehung erst mal<br />
so nicht lernen, in Kursen oder wo auch immer. Gleichwohl<br />
müssen aber wir alle viel dazulernen, nicht zuletzt<br />
deshalb, weil es offenbar um Systembrüche geht, denen<br />
wir ausgesetzt sind.<br />
Wir klagen oft darüber, dass wir die Eltern nicht erreichen.<br />
Die Schule ist ein System, die Familie ist ein System, und<br />
dazwischen gibt es einen Bruch. Eltern oder Familien werden<br />
durch Kollegen und Kolleginnen der Jugendämter<br />
nicht mehr erreicht. Oder möglicherweise weniger erreicht.<br />
Auch aus der Richtung gibt es Klagen. Jugendliche
in einem Alter, wo sie ins Erwerbsleben gehen müssten,<br />
kommen auf dem Arbeitsmarkt zunehmend nicht mehr an.<br />
Wir können uns hinstellen und sagen: Na ja, selber schuld,<br />
hätten sie in der Schule besser aufgepasst, dann ginge es<br />
ihnen heute besser. Aber tatsächlich sind das Systembrüche,<br />
auf die einzugehen, das wäre wirklich mühselig. Ich<br />
habe das Konzept mitgebracht oder Sie können es sich<br />
vom Verband mailen lassen, da wird etwas mehr auf die<br />
Systeme und Systembrüche eingegangen.<br />
Eine Grundschule in Berlin-Neukölln hat sich letztes Jahr<br />
an Gangway gewandt, sehr idyllisch am Teltowkanal gelegen,<br />
sehr viel Grün, mit der Bitte um dringende Hilfe, weil<br />
alles ganz schlimm ist. Wir sind dann hin, haben das Gespräch<br />
aufgenommen. Sie brauchen Sozialpädagogen,<br />
Sozialarbeiter usw., aber sie wussten nicht genau warum.<br />
Jrgendwie war da Gewalt, Kinder, die nicht richtig ticken,<br />
Eltern, die sie nicht erreichen. Wir haben ihnen angeboten,<br />
eine Bedarfsanalyse zu erstellen, indem ein Kollege<br />
von uns immer wieder und zu bestimmten Terminen an die<br />
Schule geht, in den Unterricht geht, mit Erziehern und Erzieherinnen<br />
spricht, mit Eltern redet, sich das Geschehen<br />
mit den Kindern in der Klasse ansieht, um herauszufinden,<br />
was an dieser idyllisch gelegenen Grundschule los ist.<br />
Die Schule war sehr offen dafür, das sind nicht alle Schulen,<br />
muss man sagen. Ich war dann über sieben Monate<br />
an dieser Schule, immer montags, dann auch später dienstags<br />
und mittwochs. Tatsächlich kamen wenige Eltern rein.<br />
Aber im weiteren Verlauf hat sich herausgestellt, dass es<br />
von der Schule aus eine Regel gibt. Die Eltern mussten<br />
ihre Kinder zehn vor 8 am Tor abgeben, sie sollen nicht mit<br />
rein, weil sie den Unterricht stören. Da steht nicht: Eltern<br />
sind uns willkommen. Aber es gab auch gute Sachen gab<br />
es an dieser Schule.<br />
Kinder nicht-deutscher Herkunftssprache 82 %. Aber die<br />
Schule hat eine Regel: Einladungen werden grundsätzlich<br />
in deutscher Sprache an die Familien geschickt. Das kann<br />
man so machen, muss man nicht. Und viele andere Dinge,<br />
die das Leben künstlich oder zusätzlich erschwert haben.<br />
Sie haben es sich selber schwer gemacht. Sie machen es<br />
sich immer noch schwer.<br />
Auf einer Gesamtkonferenz, wo ich mich vorgestellt hatte,<br />
die gesamte Belegschaft war da, Lehrer und Lehrerinnen,<br />
Erzieher und Erzieherinnen des Freizeitbereiches dieser<br />
Schule. Da sagten vereinzelte Lehrer zu mir: Na, ich dachte,<br />
Sie sind jetzt da und sagen uns, wer hier verhaltensgestört<br />
ist, gehen mit dem raus und reden, und ich kann mit<br />
dem Rest den Unterricht machen. Das ist schwierig, das<br />
sind ja keine dummen Menschen, sondern da ist irgendwo<br />
etwas, wo es drückt. Dann haben wir dieses Programm<br />
angeboten, dieses dialogische Coaching. Wir nennen das<br />
nicht Eltern-Coaching, sondern wir coachen uns alle, also<br />
Fachkräfte und Eltern.<br />
Wir haben den Lehrern und Lehrerinnen auch dabei geholfen,<br />
die Einladungen zu schreiben, weil sie fragten, wie sie<br />
das machen sollen. Na ja, wie sie zu den Elternabenden<br />
einladen, das ist klar, aber zum dialogischen Coaching?<br />
Das ist schon schwierig. Wie Sie wissen, arbeite ich mit<br />
Ihrem Kind als meine Schülerin, meinem Schüler. Ich bin<br />
mit Erziehungs-Bildungsaufgaben usw. betraut, und ich<br />
möchte mich weiterentwickeln, haben Sie Interesse, mich<br />
dabei zu unterstützen? Wir könnten beide vielleicht voneinander<br />
und von<br />
anderen etwas lernen.<br />
Diese Art der<br />
Ansprache ist sehr<br />
wichtig. Aber das<br />
Problem war, dass<br />
die Lehrer das<br />
Schreiben dann<br />
den Kindern einfach<br />
mit nach Hause<br />
gegeben haben<br />
und gar nicht den Dialog gesucht haben. Das hätte man<br />
machen können, noch mal nachtelefonieren oder so, haben<br />
Sie Interesse, ich habe Ihnen einen schönen Brief geschrieben<br />
und freue mich darauf, wollen Sie nicht doch?<br />
Das ist eine Haltungsfrage, die ist sehr wichtig.<br />
Jedenfalls kamen wir zusammen, hatten auch Termine<br />
vereinbart. Die Lehrer und Lehrerinnen haben gesagt, na<br />
ja, eigentlich wollen wir das nicht, aber – hm. Fünf von<br />
23 Lehrern haben sich dann bereit erklärt. ErzieherInnen<br />
waren voll dabei, die sind anders. Dann waren wir gespannt,<br />
wie viele Eltern kommen, weil die Einladung so per<br />
Schultasche mitgegangen war und es Rücklauf gab. Dann<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 87
88<br />
Workshop Wenn Eltern in die Schule gehen<br />
Wenn Eltern in die Schule ...<br />
haben die LehrerInnen gesagt, ja, aber nicht hier 12 Treffen<br />
mit jeweils 4 Stunden, das geht nicht. Ein Werkstatt-<br />
Treffen 4 Stunden. Die Zeit brauchen Sie nicht, ich sage<br />
auch gleich warum.<br />
Dann haben wir gesagt,<br />
okay, machen<br />
wir eine kleine<br />
Geschichte von 2<br />
Stunden. Wobei<br />
uns klar war, das<br />
funktioniert eigentlich<br />
nicht in 2 Stunden.<br />
12 Termine<br />
wollten sie aber<br />
nicht. Okay, dann bis zu den Sommerferien. Wir wussten<br />
dabei, dass es schon weiter gehen würde. Haben wir gedacht.<br />
Der erste Dienstag, an dem wir uns getroffen haben, immer<br />
von 17 bis 19.30 Uhr, auch eine Zeit, die nicht unbedingt<br />
leicht für Familien bzw. Eltern ist. In Marzahn haben<br />
wir uns immer von 17 bis 21 Uhr getroffen. Da haben die<br />
Eltern, die Ressourcen haben, alles organisiert. Teilweise<br />
hatten sie 8 Kinder, also keine Migranten-Familien, sondern<br />
deutsche Familien, die haben ihre 8 Kinder versorgt.<br />
Und wenn es der Partner war, der auf einmal auf die Kinder<br />
aufpassen musste, weil die Mutter gesagt hat, ich<br />
gehe dort zum Lernen.<br />
An dieser Schule aber hatten wir alles ein bisschen reduzierter,<br />
weil die Lehrer und Lehrerinnen das so wollten<br />
und nicht anders. Wir haben die Termine mit einem<br />
Seil eröffnet, das war zusammengebunden und alle sind<br />
da rein. Dann wurde das so ein bisschen hochgehoben,<br />
dann haben wir gerüttelt und geschüttelt, und gesagt,<br />
wir sitzen alle in einem Boot, das Schiff bewegt sich<br />
jetzt. Auch um symbolisch darzustellen, wir sitzen tatsächlich<br />
in einem Boot, als Bürger oder Menschen oder<br />
wie auch immer.<br />
Dann ging es traditionell bei diesen Werkstattrunden bei<br />
der Eröffnung darum: wie komme ich heute hier an? Jedes<br />
Mal die gleiche Frage: Was geht mir durch den Kopf?<br />
Was beschäftigt mich? Nach Möglichkeit sollten die Teilnehmer<br />
in einem Tandem sein, eine Lehrerin, ein Elternteil,<br />
eine Erzieherin, ein Elternteil, damit nicht die Fachkräfte<br />
überwiegen und es droht einseitig zu kippen.<br />
Beim ersten Treffen waren 5 Lehrerinnen da, 6 Erzieherinnen<br />
und 5 Eltern, später haben das dann die Eltern ein<br />
bisschen getoppt, es wurden dann mehr, warum auch immer,<br />
die Lehrer wurden weniger.<br />
Und dann so die Fragestellung: wer ist mein Partner?<br />
Dann ziehen wir uns zurück, immer zu zweit, und interviewen<br />
uns. Wie heißen Sie? Was ist Ihre Lieblingsspeise?<br />
Wie wohnen Sie? Haben Sie Kinder oder nicht? Verheiratet<br />
oder nicht? Viele Fragen. Und nach einer halben<br />
Stunde … Die Lehrerin sagte: Wat? Ne halbe Stunde?<br />
Nee, 10 Minuten. Ich sagte, wir probieren es, aber die<br />
Zeit hat einfach nicht gereicht, die halbe Stunde, weil<br />
die so viel Interesse an ihrem Gegenüber hatten und<br />
noch mehr fragen wollten. Man kommt in den Dialog,<br />
schon allein darüber.<br />
Vier Stunden klingt viel, aber die vergehen in so einer<br />
Werkstatt im Nu, eigentlich mit nur einer Pause, in der es<br />
belegte Brote gibt und Kaffee, Selter und Smalltalk, und<br />
dann wird weiter gearbeitet. In so einer Runde und immer<br />
wieder, dass man sich auch in kleinen Gruppen zurückzieht.<br />
Eine weitere Fragestellung aus einer anderen Werkstatt,<br />
das ist natürlich immer methodisch vorbereitet von uns.<br />
Also wir stellen nicht einfach so Fragen, sondern haben<br />
auch Papiere, die die Eltern bekommen: Was macht mich<br />
aus? Wer bin ich? Das ist doch eine irre Frage, da könnten<br />
wir heute noch eine Runde hier machen, was macht mich<br />
aus? Ich muss immer wieder feststellen, dass ich zu wenig<br />
darüber nachdenke, was mich ausmacht und wer ich<br />
bin. Wenn man für sich alleine darüber nachdenkt, dann<br />
braucht man sicher auch mehr als eine halbe Stunde. Und<br />
so auch in diesem Rahmen. Deshalb lieber diese 4 Stunden,<br />
die enorm wichtig sind.<br />
Aber am Ende der ersten Werkstatt haben die Lehrer und<br />
Lehrerinnen und die Erzieher und Erzieherinnen und auch<br />
die Eltern gesagt: Eigentlich ist die Zeit viel zu kurz.<br />
Eine andere Werkstatt haben wir zu dritt gemacht, weil es<br />
sinnvoll ist, mindestens zu zweit zu sein, weil man zeitweise<br />
müde wird, dann kann der andere einsteigen.
TN: Dieses Setting ist klar. Wie passt es denn, wenn ihr zu<br />
zweit oder zu dritt seid? Das, was gesagt wird, wo wird das<br />
festgehalten?<br />
Semih Kneip: Wir machen sowieso bei jeder Teambesprechung<br />
ein Erinnerungsprotokoll und machen während der<br />
Werkstatt nur Notizen, worauf wir dann auch möglicherweise<br />
drei Werkstätten später noch mal drauf zurückkommen<br />
können.<br />
TN: Also es gibt immer in der Gruppe jemand von Euch,<br />
der mitschreibt?<br />
Semih Kneip: Wir sind zu zweit und wir besprechen und<br />
schreiben und schreiben und sprechen. Wir vergleichen<br />
auch unsere Notizen. Und vor allem auch die Teilnehmer<br />
nehmen ein Blatt Papier und schreiben alles, was interessant<br />
ist, auf. Wenn man es nicht braucht, wirft man es<br />
weg. Aber vielleicht kann man es gebrauchen oder liest<br />
darin noch mal nach.<br />
Die Werkstätten werden am Ende einer jeden Sitzung<br />
von allen evaluiert. Da gibt es bestimmte Fragen, was hat<br />
mir heute besonders gut gefallen, wie empfand ich mich,<br />
ich bin an dem Thema xy interessiert, wo die Teilnehmer<br />
reinschreiben, wo sie gerne weitermachen möchten. Die<br />
werden auch ausgewertet, werden zusammengefasst.<br />
Und dann bei der nächsten Werkstatt bekommen das alle<br />
Teilnehmer. Das gibt eine dicke Mappe mit Unterlagen und<br />
mit didaktischem Material.<br />
Wir erstellen auch gemeinsam Familienornigramme, weil<br />
es sehr interessant ist zu schauen, wo komme ich eigentlich<br />
her, welche Stellung hatte ich in meiner Herkunftsfamilie?<br />
Möglicherweise erklärt sich auch daraus, warum ich<br />
heute so bin wie ich bin. Oder wir schauen uns Familienbilder<br />
an und bitten darum, dass man Fotos mitbringt. Wir<br />
fragen auch, ob Interesse besteht, dass wir uns heute hier<br />
Familienfoto anschauen. Wenn die Lehrerin ja sagt, dann<br />
wird das eingescannt und gleich per Beamer angeschaut.<br />
Da lernen wir, das Sehen zu sehen, weil man manche Dinge<br />
sehr unterschiedlich sehen kann.<br />
Wenn man fragt: Was sehen wir? Dann fangen viele Leute<br />
gleich an zu sagen, ein verängstigtes Kind und der Vater<br />
ist streng oder die Mutter wirkt streng. Wir sagen dann:<br />
Noch nicht interpretieren, einfach nur mal gucken, was<br />
sehe ich? Das kann unterschiedlich sein, anhand der Bildqualität<br />
oder der Mode kann man das Foto einer Zeit zuordnen,<br />
1930 oder die 60-er Jahre, vielleicht eine Familie,<br />
Mutter, Vater, zwei Kinder, scheint so zu sein.<br />
Und erst dann steigen wir langsam darauf ein, was wir<br />
noch sehen oder noch vermuten hinter dieser Familienaufstellung.<br />
Wir bitten am Ende auch die Person, die das<br />
Familienfoto zur Verfügung gestellt hat, zu helfen, ob die<br />
Einschätzungen falsch sind oder richtig. Eigentlich geht es<br />
darum, sich ein Bild von Familien zu machen. Wie funktionieren<br />
Familien? Wie ticken Familien? Und bei Bedarf,<br />
wenn wir erkennen, da ist großes Interesse, dann bauen<br />
wir für das nächste Mal eine sogenannte Eltern-Universität<br />
ein, wie wir das genannt haben. Da geben wir einen<br />
kleinen Input, über das familiäre System zum Beispiel und<br />
dessen Wandel.<br />
Im Kontext von Schule haben wir Module ausgearbeitet,<br />
wo wir nach der Erstbegegnung, unsere Erwartungen und<br />
Ziele formulieren, unser Selbstverständnis: also wie kann<br />
ich mich selbst im Dialog mit anderen wahrnehmen, wer<br />
bin ich, was macht mich aus, usw. Darüber kommen wir<br />
auf die Aussage: Keiner ist eine Insel. Ich und meine Umwelt.<br />
Wir haben Umweltkarten und bitten die Teilnehmer, wenn<br />
sie mögen, mitzuarbeiten: Die Familie ist in der Mitte, was<br />
gibt es noch um die Familie herum? Kinderarzt, Schule,<br />
Freizeit, usw. Im zweiten Schritt bitten wir darum, die Verbindung<br />
zum Kinderarzt aufzuzeichnen. Sie kennen das<br />
aus anderen Kontexten, gestörte Verbindungen oder tolle<br />
Verbindung. Dann kann man darüber ins Gespräch gehen.<br />
Arzt spielt bei Ihnen keine Rolle, Gesundheit schon. Immer<br />
schon gesund gewesen? Manchmal kommen so Dinge<br />
wie: tierische Angst vor dem Zahnarzt; oder: der Vater ist<br />
im Krankenhaus verstorben und seitdem gehe ich nicht<br />
mehr zum Arzt, weil ich da dieses oder jenes erlebt habe.<br />
Solche Aussagen kann man dann auf die Kinder beziehen:<br />
Das kann die eigene Geschichte sein, aber die Kinder haben<br />
möglicherweise eine andere Fürsorge verdient, usw.<br />
Ein anderes Beispiel: Eine türkische Mutter sagte, jetzt<br />
versteht sie sich mit ihrer Mutter viel besser, das war nicht<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 89
90<br />
Workshop Wenn Eltern in die Schule gehen<br />
Wenn Eltern in die Schule ...<br />
immer so. Der Vater ist vor drei Monaten gestorben und er<br />
hat wohl gesagt, dass sie sich um ihre Mutter kümmern<br />
soll. Da hat sie einen Auftrag gekriegt, gleichzeitig aber ist<br />
sie dabei, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen, weil<br />
er das alles nicht mitmacht und sagt, lass mal Mutti Mutti<br />
sein. Man kann darüber ins Gespräch kommen, über solche<br />
Aufträge, wie manchmal Eltern aus dem Grab heraus<br />
noch unsere Geschicke bestimmen. Ein weiteres Thema<br />
sind Familienwelten, Familiensysteme.<br />
Schule gestern und heute: Da versuchen wir, über Schule<br />
ins Gespräch zu kommen. Wie sieht meine eigene Schulerfahrung<br />
aus? Was ist heute in den Schulen los? Wem gehört<br />
die Schule? Was kann die Schule leisten? Was kann<br />
sie nicht leisten? Welche Veränderungsgedanken hat die<br />
Organisation Schule? Wie kann ich Schule heute lernen?<br />
Ist Schule eine lernende Organisation?<br />
Ein weiteres Modul, also eine weitere Werkstatt, könnte<br />
sein – ist es in diesem Fall auch -: Wie sehe ich meine Kinder<br />
oder Schüler? Jugend und Jugendkulturen, das ist in<br />
diesem Zusammenhang ein Thema. Was ist heute mit den<br />
Jugendlichen los? Können wir Jugendliche neu und anders<br />
verstehen, ihnen standhalten und sie auf ihrem Weg<br />
halten und orientieren?<br />
Nicht gleich<br />
Grenzen setzen,<br />
aber standhalten.<br />
Das ist eine andere<br />
Haltung, ohne dass<br />
die jetzt die richtige<br />
sein muss.<br />
Gelingende Erziehung<br />
in schwieriger<br />
Zeit. Wie kann man<br />
die heutigen Erziehungsaufgaben neu und anders verstehen?<br />
Es werden nicht mehr viele Kinder geboren in modernen<br />
Staaten, auch in der Bundesrepublik nicht. Kinder<br />
haben mittlerweile Rechte. Kinder sind Mangelware. Da<br />
verändert sich vieles.<br />
Autorität ohne Gewalt: Wie können wir Erziehungskonflikte<br />
besser verstehen und managen? Auch die Frage: Wie lernt<br />
man eigentlich Erziehung? Ich finde die Frage interessant.<br />
Wir sind ja teilweise sicherlich auch Eltern. Ich kann Ihnen<br />
für meine Person sagen, wie man es macht: Beim ersten<br />
Kind so und beim zweiten Kind vielleicht noch mal anders,<br />
um nicht zu sagen: besser. Aber auch aus der Erfahrung,<br />
wie es unsere Eltern gemacht haben. Und auch aus dem<br />
Sehen, wie es die Nachbarn oder die Geschwister machen.<br />
Salopp gesagt, so lernt man erst mal erziehen.<br />
Zum Schluss geht es natürlich um ein Netzwerk der Hilfen<br />
und Unterstützungen, also wie vernetzen wir uns?<br />
Es scheint wichtig zu sein, dass wir anfangen, Partnerschaften<br />
zu entwickeln und zu vernetzen, um nicht Einzelkämpfer<br />
zu sein, weil man so gegen die Wand fährt. In solchen<br />
Gesellschaften, wie wir sie sind, und wohin wir uns<br />
auch entwickeln, vollzieht sich eine turbokapitalistische<br />
und rasante Entwicklung. Vor 12 Jahren hätte man mit<br />
solchen Beamern seine Präsentationen nicht gemacht,<br />
sondern man hätte einen Overhead-Projektor benutzt.<br />
Oder wir telefonieren heute mobil. Diese Dinge verändern<br />
natürlich unser Leben, technisch, wissenschaftlich, es gibt<br />
kulturelle Umbrüche usw.<br />
Wir haben ein kleines Buch gemacht: „Die Stärken meines<br />
Kindes“, damit können Eltern, wenn sie mögen, auch arbeiten.<br />
Das verteilen wir zu gegebener Zeit. Also dieses<br />
Buch beginnt damit: Wenn ein Paar ein Kind bekommt,<br />
werden Mann und Frau zu Eltern. Man kann auch sagen,<br />
das Paar macht in seiner Liebe ein Kind. Aber das neu geborene<br />
Kind macht ein Paar überhaupt erst zu Eltern. Und<br />
es ist ja auch so, dass bereits der Säugling und das kleine<br />
Kind mit seinem ganzen Wesen, seinen Bewegungen, seinen<br />
Gefühlen, seiner Ausstrahlung, so wie es sich äußert<br />
und zeigt, Mutter und Vater immer wieder dazu motiviert,<br />
sich dem Kind zuzuwenden, es anzuschauen, für es zu<br />
sorgen, es anzunehmen und zu beschützen.<br />
Natürlich verlangt die Pflege und Erziehung eines Kindes<br />
einen beträchtlichen Arbeitseinsatz. Macht nicht immer<br />
Spaß, sondern es kostet auch Nerven. Kinder sind ja nicht<br />
immer nur Engel. Je mehr wir aber als Eltern entdecken<br />
und erkennen, welche großartigen Kräfte unsere Kinder<br />
haben, über welche außerordentlichen Gaben sie verfügen,<br />
fällt es uns leichter, für unsere Kinder zu sorgen und<br />
sie zu erziehen. Und es ist eine oft gemachte Erfahrung,<br />
wenn Mütter und Väter die Stärken ihrer Kinder wahrnehmen<br />
und anerkennen können, werden sie selbst zu star-
ken Eltern. Entdecken Sie darum die Stärken Ihrer Kinder<br />
und bauen Sie auf diese Weise Ihre eigenen Stärken aus.<br />
Finden Sie heraus, auf welche Stärken Ihrer Kinder Sie<br />
bauen können und wie Sie sie weiterentwickeln können.<br />
Sie können dieses Buch der Stärken Ihres Kindes ganz<br />
nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Sie können<br />
aber auch unsere Vorschläge in dieser Anleitung als Anregung<br />
und Leitlinie nehmen. Also es geht einfach darum,<br />
dass man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Als mein<br />
Kind gerade geboren war, ist mir gleich aufgefallen, was<br />
dieses Kind von Anfang an auszeichnete.<br />
TN: Ist es in andere Sprachen übersetzt worden?<br />
Semih Kneip: Nein. Es ist nichts Kommerzielles, also wir<br />
werden nicht finanziert. Gangway ist ein Verein für Straßensozialarbeit.<br />
Ich mache das in anderen Kontexten mit<br />
Kollegen, die auch durch den Kronberger Kreis ausgebildet<br />
sind. Wir haben zum Beispiel im Wedding ein Straßensozialarbeiterprojekt,<br />
da geht es aber mehr um Gemeinwesenarbeit.<br />
Da gibt es eine Bürgerinitiative, die über die<br />
Jugendlichen meckert, da gibt es eine Bürgerinitiative, die<br />
will die Migranten weg haben, usw. Da bietet es sich an,<br />
Module zu entwerfen und die Menschen in sogenannten<br />
Werkstätten zusammenzubringen. Aber so weit sind wir<br />
nicht und wir arbeiten damit noch nicht als Projekt.<br />
TN: Als Sie in die Schule gegangen sind, die Grundschule<br />
mit den vielen Migranten, die die Einladung nicht lesen<br />
können oder mit dem Text nichts anfangen können, …?<br />
Semih Kneip: Das haben wir so nicht erlebt. Ihre Frage ist<br />
sicher berechtigt, aber bei den Eltern, die da waren, haben<br />
wir nicht erlebt, dass sie es nicht hätten lesen können. Wir<br />
haben auch deutsch gesprochen. Also ich kann Türkisch,<br />
aber ich kann nicht Arabisch sprechen.<br />
Hier tauchte die Frage nach den Ausschlusskriterien auf:<br />
Bei diesem Programm haben wir keine, es sei denn, man<br />
ist hart auf Drogen oder schwer psychisch krank, dann ist<br />
dieses Setting nicht sinnvoll. Aber wenn Alkoholiker mit ihrer<br />
Flasche kommen würden, dann würde schon irgendwer<br />
was sagen.<br />
TN: Gibt es diese Art von Arbeit an der Schule weiterhin?<br />
Gibt es jetzt andere Angebote und kann ich das propagieren,<br />
gibt es noch Kapazitäten?<br />
Semih Kneip: Dies ist ein Modellprojekt. Es gibt viele interessierte<br />
Menschen, in der Regel kommen Eltern und<br />
Fachkräfte. Aber wir sind eigentlich noch nicht so weit. In<br />
Berlin gibt es drei, vier Leute, die sich bei Reinhart Wolff<br />
in der Vergangenheit diesbezüglich haben zertifizieren<br />
lassen. Sozialarbeiterische Qualifikationen sind sicherlich<br />
wichtig, erzieherische, aber hier geht es auch um Organisation,<br />
Systeme, Systemtheorie usw. Es ist noch nicht so<br />
weit, das Modell größer machen zu können.<br />
Wenn eine Schule Interesse hat, und es entsteht dann,<br />
dann sind wir gerne zur Teilnahme bereit. Die Schule, von<br />
der ich sprach, hatte dringenden Bedarf, dass da was passieren<br />
musste. Wir haben uns 8 Werkstätten lang getroffen.<br />
Vor den Sommerferien war das offiziell beendet. Alle<br />
waren euphorisch und wollten unbedingt weitermachen.<br />
Wir haben dann gesagt, dass wir uns nach den Sommerferien<br />
zu einer Ideen-Werkstatt treffen. Welche Ideen haben<br />
wir, wie können wir hier weiter arbeiten? Das wollten sie<br />
auch.<br />
Als die Schule wieder begann, hat die Direktorin gesagt,<br />
dass sie sich überlegt haben, dass das nichts bringt, weil<br />
sie dadurch nicht so groß die Eltern erreichen. Was sie<br />
verkannt haben – aus meiner Sicht -, ist, dass Veränderung<br />
durch Selbstveränderung passiert. Oder wir müssen<br />
uns vorwerfen, dass wir das dort nicht zur Genüge haben<br />
rüberbringen können. Aber nur so geht es. Wenn sich der<br />
eine Partner in seiner Haltung verändert, ändert sich auch<br />
der andere.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 91
92<br />
Workshop<br />
Schaut Euch diese Typen an<br />
„Nachbarschaftsheime, Mütter-, Familien-,<br />
Stadtteilzentren, Bürgerhäuser“ -<br />
Ansprüche, Profile, Förderprogramme<br />
Torsten Wischnewski: Wir wollen der Frage nachgehen:<br />
Was bedeuten die unterschiedlichen Einrichtungs- Typen<br />
- Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser, Stadtteilzentren?<br />
Es wird uns heute nicht so sehr darum gehen,<br />
neue Förderprogramme zu entdecken, sondern zu prüfen,<br />
wie wir methodisch arbeiten und welche Themen<br />
auf uns zukommen. Einrichtungen mit Themen der Familienarbeit<br />
existierten schon seit 50 Jahren – zumindest<br />
in Berlin – oder seit mehr als 20 Jahren in Köln oder<br />
Braunschweig, also seit langer Zeit.<br />
Wir wollen zwei praktische Beispiele aus Braunschweig<br />
und Köln geben. Dann wird Herr Löhnert etwas zu der<br />
Berliner Situation der Stadtteilzentren erläutern. Herr<br />
Hummel wird danach das Vorgetragene aufnehmen und<br />
kritisch darlegen, ob wir mit unseren Förderprogrammen<br />
und unseren verschiedenartigen Typen auch heute noch<br />
richtig liegen und was die Zukunft unter Umständen<br />
bringen kann.<br />
Inputs:<br />
Monika Döhrmann<br />
(Mehrgenerationenhaus Braunschweig)<br />
„Vom Mütterzentrum zum Mehrgenerationenhaus“<br />
Dr. Eberhard Löhnert (DPW Berlin)<br />
„Der Berliner Stadtteilzentrenvertrag“<br />
Bernd Giesecke (Bürgerschaftshaus Bocklemünd-Mengenich)<br />
„Familienzentren in Nordrhein-Westfalen“<br />
Dr. Konrad Hummel (Augsburg)<br />
„Gedanken über die Notwendigkeit,<br />
den Partikularismus zu überwinden“<br />
Moderation:<br />
Torsten Wischnewski<br />
Monika Döhrmann: Ich zeige Ihnen als erstes einen kleinen<br />
Film, der im Frühjahr 2006 für die Sendung „Hallo<br />
Niedersachsen“ vom NDR aufgenommen worden ist. Er<br />
gibt Einblick in unsere Räumlichkeiten und die Schwerpunkte<br />
unserer Arbeit.<br />
(Filmeinspielung: Mehrgenerationenhaus Braunschweig)<br />
Wir sind von einem Mütterzentrum zum Mehrgenerationenhaus<br />
geworden. Das Mütterzentrum wurde 1987<br />
gegründet. Zum 1.4.2004 haben wir den Zuschlag als<br />
ein vom Land gefördertes Mehrgenerationenhaus bekommen<br />
und sind in neue Räumlichkeiten gezogen. Der<br />
Film ist also zwei Jahre später entstanden und zeigt,<br />
dass eine ganze Menge einfach so funktioniert. Es war<br />
nicht ganz einfach, vom Mütterzentrum zum Mehrgenerationenhaus<br />
zu werden. Natürlich hatten wir Väter, die<br />
in der Elternzeit regelmäßig bei uns Besucher waren. Wir<br />
hatten auch ältere Menschen, ältere Frauen vorwiegend,<br />
bei uns im Haus, die mit ihren Töchtern oder den Enkelkindern<br />
einfach mal da waren. Schwerpunkte waren das<br />
Café, der Second-Hand-Verkauf, Kinderbetreuung und<br />
ein paar Gruppenangebote wie Meditation oder Autogenes<br />
Training, auch ein bisschen Einzelberatung. Unser<br />
Haus war aber nicht durchgängig geöffnet.<br />
Nach dem Umzug haben wir ein neues Konzept entwickelt.<br />
Das „Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser“<br />
stellt eine ganze Menge Anforderungen an die einzelnen<br />
Träger. Wir mussten in relativ kurzer Zeit ganztägige Öffnungszeiten<br />
umsetzen, die Räumlichkeiten ansprechend<br />
gestalten, ein bisschen Dienstleistung anbieten: Friseur,<br />
Fußpflege, Kosmetik. Wir haben den Mittagstisch neu
aufgenommen, um ein Angebot für die Menschen aus<br />
der Nachbarschaft, die zu uns ins Haus kommen, zu haben.<br />
Wir sollten neue Zielgruppen ansprechen, zum Beispiel<br />
verstärkt ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund,<br />
aber auch mehr Männer. Das alles zu<br />
einer Zeit, in der einige noch dem alten Mütterzentrum,<br />
den kleinen beschaulichen Räumen, nachtrauerten,<br />
während andere ganz gespannt waren auf das, was jetzt<br />
passiert.<br />
Innerhalb unseres Teams von 25 Frauen hatten wir einen<br />
ziemlichen Spannungsbogen in Bezug auf den Hintergrund<br />
und die Qualifikation. Gleichzeitig hatten wir eine Menge<br />
Aufgaben zu bewältigen. Es war relativ schwierig zu sagen,<br />
in welche Richtung wir gehen wollten. Wir haben erst mal<br />
alles aufgegriffen, alles Mögliche umgesetzt. Dann haben<br />
einige kritisiert, dass es keinen Frauenraum mehr gab, sie<br />
fanden es nicht gut, dass dann doch Männer da waren. In<br />
dem Film sah man, dass deutlich mehr Frauen das Haus<br />
besuchen als Männer, man sieht auch kaum Migranten,<br />
die sind erst später dazu gekommen, als wir uns das bewusst<br />
zur Aufgabe gemacht haben.<br />
Wir hatten intern eine Menge Auseinandersetzungen. Wir<br />
haben uns auch gefragt, wer wir jetzt eigentlich sind: Mehr<br />
so ein Müttertreffpunkt oder mehr ein Mehrgenerationenhaus?<br />
Wo wollen wir hin? Passt beides zusammen? Was<br />
wollen wir bewahren? Was wollen wir neu machen? Ich<br />
denke, dass das vielen Trägern mit diesem neuen Konzept<br />
so gegangen ist. Dann fragt man sich natürlich, warum<br />
man sich danach gestreckt hat ...<br />
Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass das Mehrgenerationenhaus<br />
wirklich eine Erweiterung unseres Konzeptes<br />
gebracht hat, weil wir jetzt ganz klar sagen: Wir<br />
sind ein Mehrgenerationenhaus, das aus der Mütterzentrumsbewegung<br />
kommt. Wir haben immer schon Hilfe zur<br />
Selbsthilfe angeboten, wir haben immer schon Nachbarschaftshilfe<br />
initiiert, damit Menschen sich kennen lernen<br />
konnten. Wir haben schon immer Netze geknüpft in den<br />
offenen Räumlichkeiten, die wir haben. Und in der Begegnung<br />
zwischen den Menschen wurden letztendlich schon<br />
Brücken zwischen den Generationen gebaut. Das ist das,<br />
was wir von dieser Mehrgenerationenhaus-Idee auch vorher<br />
schon verwirklicht hatten.<br />
Weil wir aus der Mütterzentrenzeit kommen, gibt es bei<br />
uns nach wie vor Baby-Gruppen, PEKiP-Gruppen, pädagogische<br />
Nachmittage, Kinderangebote in den Ferien,<br />
Kinderbetreuung und all diese Dinge, die rund um das<br />
Familienleben dazugehören. Wir haben allerdings kaum<br />
Jugendliche bei uns im Haus, weil unsere Räumlichkeiten<br />
es nicht hergegeben haben, eigene Räumlichkeiten für Jugendliche<br />
zu schaffen.<br />
Das ist auch schon eine alte Geschichte, so haben wir immer<br />
schon gearbeitet uns anzuhören, was die Menschen<br />
brauchen, die zu uns kommen, und dem entsprechend<br />
unser Angebot weiterentwickelt. Wir haben bei den Migrantinnen<br />
z.B. festgestellt, dass sie einen hohen Bedarf<br />
an Deutschkursen haben. Die konnten wir in Zusammenarbeit<br />
mit dem Büro für Integrationsfragen tatsächlich einrichten.<br />
Über eine Landesförderung haben wir jetzt eine<br />
Erzieherin mit einer halben Stelle, die Sprachkurse bei uns<br />
anbietet.<br />
Um das ganze große Gefüge am Laufen zu halten, müssen<br />
wir enorm viele Anträge zur Finanzierung stellen. Wir prüfen<br />
laufend, was es an Landes- und Bundesprogrammen<br />
gibt; wo kann uns ein Amt wie das Büro für Integrationsfragen<br />
das zur Verfügung stellen, was wir brauchen; oder<br />
Angebote die Jugendhilfe bei uns durchführen kann und<br />
wo wir Räumlichkeiten nutzen können, für die wir nichts<br />
bezahlen müssen. All diese Dinge sind unser tägliches<br />
Geschäft geworden und ich glaube, dass das auch nicht<br />
mehr umzukehren ist.<br />
TN: Ich habe eine Frage zu den Dienstleistungen, die Sie<br />
anbieten, wie funktioniert das denn? Welche rechtlichen<br />
Voraussetzungen gibt es da?<br />
Monika Döhrmann: Das ist recht schwierig, wir sind ja ein<br />
relativ kleiner Verein. Es gibt ein Vereinsrecht, in dem es<br />
Steuergrenzen gibt, die wir inzwischen längst überschritten<br />
haben. Wir haben am Anfang alles in eigener Trägerschaft<br />
gemacht, da darf man 17.500 Euro Einnahmen haben, die<br />
nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Diese Grenze hatten wir<br />
in ganz kurzer Zeit durch Mittagessen, Kaffee und Kuchen,<br />
Friseur, Second Hand, Kinderbetreuung usw. erreicht. Da<br />
haben wir die Frauen, die diese Angebote gemacht haben,<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 93
94<br />
Workshop Schaut Euch diese Typen an<br />
Schaut Euch diese Typen an<br />
drängen müssen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das<br />
heißt, der Second-Hand-Laden wird jetzt von einer Frau betrieben,<br />
die sich selbstständig gemacht hat. Wir machen<br />
allerdings noch Zuarbeit wie Öffentlichkeitsarbeit für sie.<br />
Dasselbe ist mit der Friseurin und der Kosmetikerin und<br />
allen anderen, die bei uns was anbieten, passiert. Vieles<br />
von dem, was vorher in unserer Trägerschaft lief, machen<br />
die Frauen jetzt alleine.<br />
TN: Für uns sind die kostenlosen Angeboten, die wir wegen<br />
der sozialen Mischung machen wollen und müssen,<br />
ein Problem. Denn natürlich haben wir den Druck, auch<br />
Einnahmen zu erzielen zu müssen mit kostenpflichtigen<br />
Angeboten. Wie gehen Sie damit um?<br />
Monika Döhrmann: Es gibt fast gar keine kostenlosen Angebote<br />
mehr. Es gibt in Braunschweig die „Tafel“, wo sich<br />
viele versorgen können. Auf die „Tafel“ sowie auch auf den<br />
kostenlosen Mittagstisch bei der Evangelischen Kirche da<br />
verweisen wir. Alle anderen Angebote, die man bei uns<br />
im Haus wahrnimmt, sind kostenpflichtig. Das Mittagessen<br />
bei uns im Haus kostet 3 Euro, das ist noch nicht so<br />
sehr hoch. Wir haben sehr viele Niedrigverdiener und viele<br />
Menschen mit sehr geringem Bildungsniveau.<br />
Bernd Giesecke: Wir gehen jetzt ein Bundesland weiter,<br />
nach Nordrhein-Westfalen, in die Familienzentren. Ich<br />
komme aus einem Bürgerzentrum, seit 1971 arbeiten wir.<br />
Die Bürgerzentren haben von der Idee her ihren Ursprung<br />
in Berlin bei den Nachbarschaftszentren. Der Stadtteil, in<br />
dem ich arbeite, Bocklemünd, liegt im Kölner Nordwesten,<br />
es ist ein sehr weit draußen gelegener Stadtteil. Der Stadtteil<br />
selber hat etwas über 10.000 Bewohner. Im direkten<br />
Umfeld des Bürger- bzw. Familienzentrums ist der Stadtteil<br />
ein Neubaugebiet aus den 60-er Jahren. Der Stadtteil,<br />
speziell in diesem Neubaugebiet, ist geprägt durch die<br />
berühmt-berüchtigten Problemlagen, worunter sich wohl<br />
jeder was vorstellen kann.<br />
Seit Anfang 2006 hat sich das Land entschieden, Familienzentren<br />
aufzubauen. Es gibt dazu eine wissenschaftliche<br />
Begleitung von Pädquis, Pädagogische Qualitätsund<br />
Informationssysteme, an der FU Berlin, mit dem Ziel,<br />
die ersten 251 Einrichtungen im Jahr 2007 zum Familienzentrum<br />
zu qualifizieren. In diesem Jahr sollte es weitere<br />
1.000 Einrichtungen dieser Art geben. Sukzessive soll<br />
dieses System soweit ausgebaut werden, dass in NRW<br />
ungefähr jede dritte Einrichtung ein zertifiziertes Familienzentrum<br />
sein wird. Nordrhein-Westfalen hat ungefähr<br />
9.700 Kindertagesstätten.<br />
Ziel so eines Familienzentrums soll sein, über die Kindertageseinrichtung<br />
Angebote zur Förderung und Unterstützung<br />
von Kindern und Familien in unterschiedlichen<br />
Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen<br />
bereitzustellen. Alles soll niedrigschwellig und alltagsnah<br />
angelegt sein und es soll der familienorientierte Ansatz<br />
praktiziert werden. Zukünftig ist „Familienzentrum NRW“<br />
also als Marke definiert.<br />
Die Qualifizierung wird in acht Feldern durchgeführt,vier<br />
Felder Leistungsbereiche, vier Felder Strukturbereiche.<br />
Die werden noch mal unterteilt, jeder Leistungsbereich<br />
noch mal in Basis- und Aufbauleistungen unterschieden.<br />
Insgesamt gehört zu dieser Qualifizierung ein Anforderungskatalog<br />
von 112 Fragen bzw. Anforderungen, die erarbeitet<br />
werden.<br />
Das ist eine enorme Datensammlung, eine enorme Informationssammlung,<br />
die von uns durchgeführt werden<br />
muss, und zwar innerhalb eines relativ knapp bemessenen<br />
Zeitraums, nämlich eines halben Jahres. Man bekommt<br />
von Pädquis auf Anfrage Unterstützung. Man wird von Pädquis<br />
auch qualifiziert, indem jemand vorbeikommt.<br />
Der Aufwand ist gewaltig: Daten zu sammeln, Flyer zu<br />
sammeln, Ordner aufzubauen. Es geht auch um Kooperationen.<br />
Es geht darum, mit Erziehungsberatungsstellen,<br />
Kinderärzten, mit den verschiedenen Therapie-Einrichtungen<br />
usw. auch Kooperationsverträge zu schließen.<br />
Die müssen auf der einen Seite standardisiert werden,<br />
auf der anderen Seite kann man aber nicht alles standardisieren.<br />
Es gibt also auch unterschiedliche Kooperationsverträge,<br />
man muss den Flyern hinterherlaufen, also<br />
man muss Nachweise sammeln, tatsächlich nahezu ohne<br />
Ende. Hinterher hat man ein Riesensammelsurium, das<br />
sind mehrere Aktenordner, an Informationen, die zur Verfügung<br />
stehen und die dann eben auch nutzbar gemacht<br />
werden sollen.
Diese Erbsenzählerei, wie ich das genannt habe, hat erst<br />
im kleineren Kreis der Einrichtungsleitung stattgefunden,<br />
hat aber dann immer größere Kreise gezogen. Das hat<br />
dazu geführt, dass auch eine viel stärkere oder eine erneute<br />
Auseinandersetzung stattfand mit dem, was in unserem<br />
Haus passiert, nicht nur in der Kindertagesstätte,<br />
sondern auch in den Bereichen drumherum. Wir haben<br />
immer gesagt, es gibt ja das Bürgerzentrum, es gibt Beratung,<br />
es gibt auch externe Dienste, die in das Bürgerzentrum<br />
kommen. Selbstkritisch muss man sagen, dass wir<br />
das im Prinzip nur als Sammelsurium hatten. Wir hätten es<br />
vorweisen können, klar, haben wir alles, aber in der Tiefe<br />
war es nicht da, weil die Kooperationen nur locker waren.<br />
Sicher kennen das viele von Ihnen, dass eine Alltagsblindheit<br />
entsteht und man Scheuklappen aufhat, weil man gar<br />
nicht mehr alles wirklich im Griff hat oder wirklich über<br />
alles informiert ist.<br />
Für uns hat diese Auseinandersetzung in allen Bereichen<br />
zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit geführt und<br />
auch zu einem schärferen Blick auf den Stadtteil, mit eben<br />
diesen unterschiedlichen Facetten, wie sie durch die Qualifizierung<br />
zum Familienzentrum gefordert sind. Seit wir ein<br />
zertifiziertes Familienzentrum sind, fließen Informationen<br />
viel schneller.<br />
Für unser Haus, also für „Die wilden Füchse“, wie unsere<br />
Kindertagesstätte heißt, ist in Bezug auf die Elternarbeit<br />
mehr erreicht worden. Wir haben engen Kontakt zu den Eltern,<br />
stellten aber dann im Nachhinein doch fest, dass das<br />
sehr einseitig war. Auf Nachfragen kam eigentlich wenig<br />
zurück, was die Eltern tatsächlich im Erziehungskontext<br />
interessiert. Bei uns gab und gibt es immer noch Elternabende,<br />
für fast 100 Kinder und 70 Eltern. Wenn dazu 5<br />
bis 7 Elternteile kommen, dann ist das viel. Daran arbeiten<br />
wir. Die Kollegen sind dazu übergegangen, im Elterncafé<br />
Eltern anzusprechen, um sie mehr einzubeziehen. Dadurch<br />
kommen jetzt mehr Rückmeldungen. Da sehe ich<br />
einen möglichen Weg..<br />
TN: Wie haben Sie es geschafft, dass die Mitarbeiter in<br />
der Kita ihr Verhalten den Eltern gegenüber verändert<br />
haben?<br />
Bernd Giesecke: Gute Frage. Ich glaube, wir haben unsere<br />
Mitarbeiter bisher noch zu wenig an einzelnen Punkten<br />
beteiligt, z.B. daran Eltern anzusprechen.<br />
TN: Kann es sein, dass die Kindergartenleiterin oder der<br />
Kindergartenleiter mit einer anderen Fragestellung in die<br />
Elternabende oder an die Bildungsaspekte gegangen ist<br />
als die Eltern selber?<br />
Bernd Giesecke: Nein,<br />
ich spreche jetzt nicht nur<br />
vom Elternabend, sondern<br />
generell von der Ansprechbarkeit<br />
der Eltern. Wir haben<br />
uns als Mitarbeiter in<br />
Gespräche reinziehen lassen,<br />
die wenig mit dem Bildungsauftrag<br />
zu tun haben,<br />
sondern um praktische<br />
Kleinigkeiten gingen. Wenn<br />
wir mal mit ihnen darüber<br />
sprechen wollten, wie z.<br />
B. ein Kind spielt, fühlten<br />
sie sich schnell bedrängt.<br />
Davon wollten sie nicht erzählen.<br />
Vielleicht wissen sie darüber selber auch nichts,<br />
weil sie sich darum nicht kümmern. .<br />
Die Auseinandersetzung hat dazu geführt, dass sich die<br />
Erzieherinnen selber mehr Gedanken drum gemacht haben<br />
und jetzt qualifizierter nachfragen. Sie lassen die Eltern<br />
nicht mehr so schnell in Ruhe.<br />
TN: Es ist doch normaler Bestandteil von Qualität in einer<br />
Kindertagesstätte, Mitarbeiter für Gespräche mit Eltern zu<br />
qualifizieren, das ist für mich Standard in der Kita-Arbeit.<br />
Wo ist der Bezug zu der neuen Struktur eines Familienzentrums?<br />
Bernd Giesecke: Weil sehr viele Einrichtungen nicht<br />
im Kontakt mit den Eltern arbeiten. In Nachbarschaftseinrichtungen<br />
gab es schon immer das Ansprechen der<br />
Menschen. Aber das ist in anderen Einrichtungen nicht so<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 95
96<br />
Workshop Schaut Euch diese Typen an<br />
Schaut Euch diese Typen an<br />
gewesen. Ich glaube, das muss ich jetzt wirklich auf uns<br />
beziehen, dass nicht jede Mitarbeiterin diese Qualifikation<br />
mitbringt. Durch diesen Zertifizierungsprozess sind wir darauf<br />
gekommen, dass wir da viel mehr machen müssen.<br />
TN: Sie sprachen von den Kooperationen, worin genau bestanden<br />
oder bestehen die? Man hat ein gemeinsames<br />
Ziel und unterschiedliche Potenziale und Ressourcen die<br />
man in die Kooperation einbringt. Ich kann mir noch nicht<br />
so richtig vorstellen, worin beispielsweise die Kooperation<br />
zwischen einer therapeutischen Einrichtung und euch bestehen<br />
kann.<br />
Bernd Giesecke: Eine ganz aktuelle Kooperation besteht<br />
mit einem Jugendhilfeträger, der auch in dem Sozialraum<br />
in Bocklemünd arbeitet. Dort wurde auch festgestellt,<br />
dass es sehr wenige offizielle Nachfragen in der Erziehungsberatung<br />
gibt. An die sind wir herangetreten und<br />
haben gesagt: ihr macht das doch schon, wir würden euch<br />
gerne als Kooperationspartner für unser Familienzentrum<br />
gewinnen, um eine Eltern-Kind-Beratung durchzuführen,<br />
die dann bei uns im Haus stattfindet.<br />
Torsten Wischnewski: Vielen Dank. Das lassen wir erst<br />
mal so stehen. Jetzt Eberhard Löhnert aus Sicht des Paritätischen.<br />
Eberhard Löhnert: Ich spreche nicht nur aus der Sicht<br />
des Paritätischen,<br />
denn man sieht<br />
ja hier die Partner<br />
des Paritätischen,<br />
die Fachverbände,<br />
den Verband für<br />
sozial-kulturelle<br />
Arbeit, SEKIS, also<br />
die Vereinigung<br />
der Selbsthilfegruppen,<br />
ABS, die<br />
Vereinigung für Seniorenprojekte, Treffpunkt Hilfsbereitschaft,<br />
die Freiwilligenagenturen usw. Das sind alles<br />
unsere Partner, als Institutionen. Wir haben natürlich<br />
auch Akteure als Partner, mit denen wir wesentliche Entwicklungen<br />
beraten: Herr Zinner, als Teil des Vorstandes<br />
des Paritätischen, Herbert Scherer zum Beispiel, die Geschäftsführer<br />
der Dachverbände. In dem Sinne ist der Paritätische<br />
zwar juristisch zuständig für das Land Berlin.<br />
Aber er kann nur gemeinsam – und das ist eines unserer<br />
Erfolgsrezepte - mit den tatkräftig mitwirkenden Verbänden<br />
und Akteuren seine Arbeit machen.<br />
Stadtteilzentren, Nachbarschaftshäuser, Selbsthilfekontaktstellen,<br />
das sind in jedem Fall Orte, wo man viele Angebote<br />
hat sich zu engagieren, wo man auch mal mit sich<br />
selber ins Reine kommen kann, sich besinnen kann, wo<br />
man andere Menschen kennen lernen kann usw. Ich persönlich<br />
finde den Begriff Stadtteilzentrum nicht so glücklich.<br />
Wohingegen der Begriff Nachbarschaftshaus für den<br />
Bürger etwas ganz Konkretes ist.<br />
Nachbarschaftshäuser haben sich ja schon 1949 im Westteil<br />
der Stadt Berlin entwickelt. Nach der Wiedervereinigung<br />
war es die Aufgabe, auch im Ostteil der Stadt eine ähnliche<br />
Struktur zu bilden, bei abnehmenden Geldmitteln. Da wir<br />
das Geld gerecht verteilen wollten, mussten wir uns auf<br />
eine Gewichtung einigen. Es gab natürlich auch im Osten<br />
unterschiedliche Typen, in denen es einen wertvollen Bestand<br />
an Erfahrungen gab, der erhalten bleiben sollte.<br />
Die Stadtteilzentrumsverträge, zur Zeit gibt es den dritten<br />
Folgevertrag mit einer Laufzeit von 2008 bis 2010, bedeuten<br />
eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Ich denke, wir<br />
sind da inzwischen auf gutem Wege. Wenn man der Politik<br />
Glauben schenken darf, sind die Stadtteilzentren in Berlin,<br />
die gesamtstädtisch gefördert werden, nicht gefährdet. Im<br />
Gegenteil, sie sind unverzichtbar für die Weiterentwicklung<br />
der Stadt. Das ist die Meinung, die gegenwärtig in<br />
allen Parteien hier in Berlin vertreten wird. Da gab es auch<br />
keine Kürzungen, obwohl Berlin ja in einer äußerst komplizierten<br />
finanziellen Situation ist.<br />
Wir fangen jetzt an, den nächsten Vertrag ab 2011 vorzubereiten,<br />
wo man eher sagt, wir brauchen noch ein bisschen<br />
mehr Geld, um dessen Umsetzung auch finanzieren<br />
zu können.<br />
Der demografische Wandel ist ein Thema. Das ist eine<br />
Herausforderung, die zu den inhaltlichen Schwerpunkten
gehört: Es war ein Glücksfall, dass die Politik entschieden<br />
hat, diejenigen Projekte der Altenarbeit, die bürgerschaftliches<br />
Engagement zum Ziel haben, in die Stadtteilzentren<br />
einzuordnen. Das hat dazu geführt, dass wir hier jede Menge<br />
an Kompetenz zu diesem Thema mit hereinbekommen<br />
haben – sowie auch eine Menge an Herausforderungen,<br />
um gemeinsam dieses Miteinander der Generationen zu<br />
gestalten.<br />
Interkulturelle Öffnung, das ist klar, Berlin ist eine interkulturelle<br />
Stadt. Eines der wichtigen Dinge, die sich bewährt<br />
haben, ist, dass man sich weiter öffnet. Das ist selbst in<br />
Berlin in den einzelnen Bezirken sehr unterschiedlich,<br />
zwischen ihnen gibt es ein riesiges Gefälle. Egal, wie sehr<br />
man sich öffnet, aber eine der Hauptmethoden, mit denen<br />
eine Öffnung erreicht wird, sind Tandem-Projekte. Das<br />
bedeutet, dass sich Initiativen von deutschen Bürgern mit<br />
Organisationen von Menschen mit ausländischer Herkunft<br />
zusammen tun, um sich gemeinsam im jeweiligen Stadtteil<br />
zu engagieren.<br />
Wo werden im nächsten Jahr die inhaltlichen Schwerpunkte<br />
der Weiterentwicklung liegen? Wir haben folgende<br />
Punkte gemeinsam beschlossen: Die Struktur nach innen<br />
soll weiter verbessert werden, die Funktionalität der Häuser<br />
soll verbessert werden. Also nicht nur für jede einzelne<br />
Zielgruppe einen Raum, das geht nun bei dieser Entwicklung<br />
nicht mehr, sondern der Gedanke von Multifunktionalität<br />
von Räumen ist inhaltlich weiter auszugestalten,<br />
um für generationsübergreifende Kulturangebote bessere<br />
Bedingungen zu schaffen.<br />
Das wäre so ein Punkt bis 2010 und noch weiter. Das<br />
Zweite betrifft die Sozialräume, heute sagt man lebensweltorientierte<br />
Räume, zu denen der Bezug enger werden<br />
soll. Da gibt es Überlegungen, die noch am Anfang sind.<br />
Es hat sich herausgestellt, dass wir ein Gesamtkonzept<br />
für die Stadt brauchen, das die bezirklichen Initiativen<br />
mit einschließt und stärkt. Dieses Gesamtkonzept wird<br />
in den nächsten 1 ½ Jahren entstehen. Wir sind schon<br />
dabei, auf diesem Gebiet zu arbeiten, gemeinsam mit<br />
den Bezirken zu schauen, wo wir zusätzliche Strukturen<br />
brauchen. Es geht nicht um Neubauten oder um mehr<br />
Geld. Sondern wir wollen vor allem die Infrastruktur<br />
nutzen, die es im Sozialraum schon gibt, also für das<br />
Gemeinwesen eine weitere Öffnung von Seniorenfreizeitstätten,<br />
Jugendfreizeitstätten, anderen Stellen der<br />
Seniorenarbeit.<br />
Ein dritter Schwerpunkt wäre die Zusammenarbeit mit<br />
Schulen. Das ist hier in Berlin besonders wichtig, weil diese<br />
Zusammenarbeit Jugendhilfe/Schule seit Jahren politisch<br />
gestärkt worden ist. Selbstkritisch will ich sagen,<br />
dass wir in diesem Bereich ziemlich weit hinten stehen,<br />
obwohl bereits eine Menge geschieht. Aber was ist die eigentliche<br />
Stärke der Jugendhilfe, die in der Schule helfen<br />
kann, und das auch tut? Da gibt es unterschiedliche mögliche<br />
Entwicklungen. Eine zum Beispiel ist: wenn es uns<br />
gelänge, die Vorteile guter Jugendhilfe als Teilhabe von<br />
Kindern und Jugendlichen am eigenen Entwicklungsprozess<br />
auch in der Schule zu verankern, würde sich die Teilhabe<br />
der Schüler in der Schule und ihr Interesse daran<br />
wesentlich verbessern. Das ist einer der Punkte, woran<br />
man arbeiten muss. der andere Punkt wäre die Öffnung<br />
der Schule insgesamt für den Sozialraum.<br />
Kreative Potenziale älterer Menschen: Da hat das Nachbarschaftsheim<br />
Schöneberg ja ein tolles Projekt aufgelegt,<br />
in Kooperation mit zur Zeit sieben Stadtteilzentren, deren<br />
Zahl noch ansteigt. In der „Werkstatt der alten Talente“,<br />
kann man auf den verschiedensten Gebieten Bürger dafür<br />
gewinnen sich zu engagieren, sich zu qualifizieren und<br />
mit anderen Bürgern auch generationsübergreifend zu arbeiten.<br />
Das zeigt, wohin die Entwicklung geht. Auch dies<br />
ist einer der Schwerpunkte.<br />
Für die Öffentlichkeitsarbeit haben wir ab nächstem Jahr<br />
ein Programm, um der Berliner Bevölkerung die Aufgaben<br />
und Möglichkeiten der Stadtteilzentren zu zeigen. Das wird<br />
von März bis Oktober gehen. In diesem Zeitraum stellen<br />
wir der Öffentlichkeit unser Programm vor.<br />
TN: Eine Ergänzung: Es werden nicht alle Nachbarschaftseinrichtungen<br />
über diesen Vertrag gefördert.<br />
TN: Im Bereich der Nachbarschaftsheime, Nachbarschaftszentren<br />
und Stadtteilzentren, hat die freie Wohlfahrtspflege<br />
ein Monopol. Sie als DPW haben für die Nachbarschaftshäuser<br />
einen Vertrag mit dem Senat. Andere Spitzenverbände<br />
haben da keinen Zugang, sehe ich das richtig?<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 97
98<br />
Workshop Schaut Euch diese Typen an<br />
Schaut Euch diese Typen an<br />
Eberhard Löhnert: Nein, das sehen Sie falsch, wenngleich<br />
es auch richtig ist. Das Falsche ist einfach, dass sich die<br />
anderen Verbände einfach zu wenig bemüht haben, Nachbarschaftseinrichtungen<br />
in Berlin zu entwickeln.<br />
Konrad Hummel: Ich will über drei Ebenen sprechen:<br />
über die praktische Ebene, eine strategisch-kommunale<br />
Ebene und über eine erfolgreiche Ländervertragsverhandlungsebene.<br />
Aus meiner<br />
Sicht sind das alles drei<br />
sehr beachtliche, positive<br />
Beispiele. Nur in Bezug auf<br />
die Eingangsfrage – Motivationen<br />
– haben wir alle, die<br />
wir überzeugt sind, dass die<br />
dargestellten Beispiele in<br />
die richtige Richtung weisen,<br />
ein ungutes Gefühl, weil diese<br />
Verfächerung bei Einrichtungen<br />
eigentlich blanker<br />
Blödsinn ist. Sie ist aber so<br />
verfestigt, dass niemand<br />
freiwillig beispielsweise ein<br />
Stadtteilzentrum oder auch<br />
ein Mütterzentrum aufgeben wird. Oder: der Paritätische<br />
verkauft nichts an die Caritas ohne Gegenleistung. Das<br />
sind alles Positionen, die nicht verrückbar sind, und trotzdem<br />
sind sie widersinnig. Von daher verstehe ich meinen<br />
Beitrag als Mischung aus Vorbereitung und Nachdenken<br />
über Ansatzpunkte für Veränderung.<br />
Wir haben verschiedene Beispiele gehört und zwar angefangen<br />
bei der ganz alten Tradition der Nachbarschaftsbewegung.<br />
Wenn man alle bisherigen Ansätze betrachtet,<br />
dann haben wir heute so etwas wie das weltliche Bekenntnis<br />
zu einer Art künstlicher Nachbarschaft. Das ist ein sozio-ökologischer<br />
Ansatz. Ich schaffe eine künstliche Nachbarschaft,<br />
so wie man eine künstliche Natur schafft.<br />
Das Zweite ist dann die ganze Tradition der Mütterzentren<br />
etc., die natürlich auch eine Geschichte hat. Sie ist in<br />
Westdeutschland ganz stark aus der völligen Kapitulation<br />
Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg entstanden.<br />
Man wollte Ganztags-Kindereinrichtungen haben, folglich<br />
hat man aus mancher „Krabbel-Babbel-Gruppe“ eine<br />
durchaus ansehnliche mittelstandsorientierte Mütterzentrums-Bewegung<br />
gemacht. Alle diese Beispiele sind Echo<br />
auf ein Stück Veränderung der Lebenswelt.<br />
Mir geht es darum, dass wir uns gelegentlich klar machen,<br />
dass sich jede Institutionalisierung aus geschichtlichen<br />
sozialen Quellen speist und nach Lösungen sucht. Bürgerzentren,<br />
Bürgerhäuser und Stadtteilzentren sind ziemlich<br />
genau in der Zeit entstanden, in der in den Großstädten<br />
Legitimationsprobleme entstanden, weil die Städte nicht<br />
mehr Heimat im klassischen Sinne waren, sondern in Kieze<br />
zerfielen. Es musste eine Art Renaturierung des Stadtteilbewusstseins<br />
passieren, weil sonst alle weggezogen<br />
wären.<br />
Dann die Entwicklung hin zu den ganzen Quartiersmanagement-Geschichten,<br />
also Soziale Stadt, Verwahrlosung von<br />
Stadtteilen, Renaturierung der Stadt. Dies alles waren Bewegungen<br />
etwa der Neubebauungen oder der Konversion,<br />
Rückentwicklung von Mietskasernen zu gemeinschaftsorientierten<br />
Wohnbauprojekten.<br />
Es ist wichtig, dass wir hier nicht nur über heruntergekommene<br />
Stadtteile reden, sondern auch über das Dilemma,<br />
wenn Stadtentwicklung eruptiv verläuft und nicht mehr,<br />
wie in Deutschland 30 Jahre lang üblich, permanent in die<br />
Höhe. Das ist ein wichtiger Punkt, denn wir alle schauen<br />
erschreckt in den Osten mit Rückbau der Städte. In anderen<br />
Ländern ist das Auf und Ab der Städte ein bisschen<br />
vertrauter, während es in Deutschland ein völlig neuer<br />
Lernprozess ist, Städte auch zurückzubauen. Entsprechend<br />
heißt so auch ein Programm. Das hat viele Folgen,<br />
nicht nur von der technischen Seite her, sondern vor allem<br />
für den Menschen.<br />
Ein weiterer wichtiger Punkt ist dann die ganze Entwicklung<br />
im Bereich der Senioren. Es gibt Seniorenbüros, Seniorentreffpunkte,<br />
die ständige Wiederkehr des Problems,<br />
dass die goldenen Herbste gar nicht so golden sind. Es besteht<br />
nach wie vor die Frage, wie man den demografischen<br />
Wandel und das Älterwerden organisiert.<br />
Und jetzt hängen zum Teil Seniorenbüros rum, die überhaupt<br />
nichts mit dem Rest der Gesellschaft zu tun haben.<br />
Auch wieder blanker Blödsinn. Gemerkt hat diesen Unsinn<br />
zunächst eine Seniorengruppe selber, nämlich dass sich
Senioren letztendlich nur gewinnen lassen, wenn auch<br />
jüngere Generation mit dabei sind. Reine Seniorenansätze<br />
sind nach meiner Überzeugung in Deutschland nicht<br />
erfolgreich, sie müssein einen intergenerativen Aspekt<br />
haben.<br />
Ein weiterer wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang<br />
die ganze Pflegeentwicklung, Sozialstations- und<br />
Pflegestützpunkte. Die Pflegestützpunkte, die jetzt auch<br />
Berlin beglücken und andere Regionen beglücken sollen,<br />
weil sie in der Pflegereform vorgesehen sind, schaffen im<br />
schlimmsten Fall wieder ein eigenes Zentrum.<br />
Und zum Schluss will ich den Bereich Schule anführen.<br />
In einigen Ländern wagt plötzlich Schule von sich aus zu<br />
behaupten, sie sei vielleicht ein Nachbarschaftszentrum.<br />
Ich sage das mit einem süffisanten Unterton, weil ich von<br />
der bayerischen Kultuspolitik geprägt bin. Die würde wahrscheinlich<br />
behaupten, dass der Stadtteil zur Schule zu<br />
gehen hat und nicht umgekehrt die Schule zur Nachbarschaft.<br />
In Gebieten, die baden-württembergisch geprägt<br />
sind, ist es so: Die Öffnung einer Schule bedeutet, dass<br />
jedermann in der Schule was tun kann. Die Reaktion von<br />
80 % des Straßenpublikums in Augsburg bei einer Kampagne<br />
vor drei Jahren war: Dann wird dort meinem Sohn<br />
der Schulranzen geklaut. Öffnung heißt: das Auto ist nicht<br />
abgeschlossen, Öffnung heißt, die Schule ist nicht gesichert.<br />
Und dann hilft uns Berlin mit so was wie der Rütli-Schule,<br />
die Diskussion heftig anzukurbeln. Mit der Folge, dass sich<br />
alle unter Maschinengewehrbefeuerung in den Schulen<br />
sehen und eine Absicherung durch Polizeidienst diskutiert<br />
wird. Das ist eine schwierige Diskussion, die ich trotzdem<br />
für ganz wichtig halte, weil ein ganz banaler Tatbestand<br />
gilt: im Unterschied zu allen anderen neun Bereichen, ist<br />
die Schule die einzige Pflichtinstitution. Das ist eine Riesenchance<br />
in einer offenen Demokratie. Das heißt also, da<br />
muss jemand hingehen. Je länger wir aber die Diskussion<br />
darüber vor uns herschieben, um so mehr zerfasert sie.<br />
Deshalb halte ich die paritätische Diskussion in Berlin zur<br />
Bürgerschule für sehr spannend.<br />
Der Staat wiederum kann auf die aufbrechenden sozialen<br />
Konflikte nicht beliebig mit Sozialstaatshilfen reagieren.<br />
Also die beste Integration für Türken kann Geld kosten so<br />
viel sie will, sie schafft mit keinem Betrag der Welt Toleranz<br />
in der Gesellschaft, weil Toleranz nicht käuflich ist.<br />
Demenz, Nachbarschaft, Solidarität im Alter, das alles ist<br />
nicht käuflich. Ich kann in 100.000 Ärzte investieren, das<br />
macht die Nachbarschaft nicht toleranter gegenüber Demenzkranken.<br />
Ich will nur andeuten, das Bewusstsein ist<br />
gestiegen, dass in den unterschiedlichen Lebensfeldern<br />
immer mehr Themen nicht mit den alten Herangehensweisen<br />
lösbar sind.<br />
Mit wertschätzender Haltung kann man einiges erreichen.<br />
Ich habe ein konkretes Beispiel aus Augsburg: Wir<br />
haben bei den Migranten festgestellt, dass bei der Drogenberatung,<br />
Suchtberatung und in vielen anderen Beratungen<br />
die Türken völlig unterrepräsentiert sind. Die Frage<br />
ist, wie können wir das ändern? Die typische Antwort<br />
eines deutschen Sozialarbeiters: Den Flyer ins Türkische<br />
übersetzen. Ich sage Ihnen: das lohnt nicht, lassen Sie<br />
es. Die Frage ist aber, wie ich in einer bestimmten Lebenswelt<br />
Multiplikatoren erreichen kann, die das Vertrauen<br />
zu der Beratungsstelle haben. Und die begreifen,<br />
dass auch der Drogenkonsum eines Mädchens aus einer<br />
türkischen Familie behandelt werden kann, wenn man<br />
es geschickt einfädelt. Wird es nicht eingefädelt, ist der<br />
Vorgang der Beratung für<br />
die Familie ein Showdown<br />
erster Ordnung, sie desavouiert<br />
die türkische Familie<br />
in Grund und Boden und<br />
man isoliert die Familie von<br />
ihrer Community. Die beste<br />
Beratungsstelle mit einem<br />
Psychologen deutscher Prägung<br />
kapiert das überhaupt<br />
nicht, weil er sagt, dass er<br />
die Methodik hat und sich<br />
die Familie vertrauensvoll<br />
an ihn wenden soll. Aber<br />
dass allein dieser Gang zur<br />
Beratungsstelle für eine türkische<br />
Familie das Ende der Integration ist, das ist eine<br />
Katastrophe. Es braucht hier Methoden, die darauf reagieren.<br />
Wenn wir diesen Irrweg der Verfächerung been-<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 99
100<br />
Workshop Schaut Euch diese Typen an<br />
Schaut Euch diese Typen an<br />
den wollen, der immer auch Reaktion auf Grenzen der<br />
Stadtplanung, Grenzen der Medizin ist, wenn wir wirklich<br />
integrieren wollen, müssen wir ein Stück weit deinstitutionalisieren.<br />
Deinstitutionalisierung heißt nicht Auflösung<br />
oder Abschaffung der Instituionen.<br />
Ich meine, dass die jeweiligen Institutionen wieder überlegen<br />
müssen, was eigentlich ihr Kerngeschäft ist, was<br />
ist die Leitidee. Da hätte ich jetzt gerne die Kollegin des<br />
Mütterzentrums kritisch gefragt: Wenn ein Mütterzentrum<br />
plötzlich immer mehr Aufgaben bekommt und sich des Armutsproblems<br />
entledigt, indem es den Besuchern sagt:<br />
Man kann bei der „Tafel“ ein kostenloses Essen bekommen,<br />
halte ich das für keine systematisch gute Lösung.<br />
Und zwar deshalb, weil das Mütterzentrum auf die Art<br />
nicht konsequent deinstitutionalisiert. Weil man sich vor<br />
der Einsicht verschließt, dass so ein Tafelessen diese Familien<br />
auf Dauer nur abhängig macht. Es lässt sie nicht<br />
selber kochen, lässt sie nicht mit dem Geld selber wirtschaften.<br />
Und es bringt auch nicht alternativ zustande,<br />
dass fünf Sozialhilfeempfänger sich zusammentun und<br />
gemeinsam kochen. Alle Formen der Selbsthilfe fallen<br />
mit solchen Hilfsangeboten weg. Wir müssen es schaffen,<br />
solche auf Dauer angelegten Standardlösungen von Problemen<br />
zu hinterfragen.<br />
Bei Schulen zum Beispiel. Wir wollen doch nicht die<br />
Schule infrage stellen, aber wir wollen die Kernfrage wieder<br />
stellen, nämlich was muss man eigentlich in dieser<br />
Gesellschaft lernen? Die entscheidenden Dinge lerne<br />
ich als Jugendlicher sowieso nicht mehr in der Schule,<br />
die lerne ich aus dem Fernsehen, aus dem Internet, von<br />
Freunden, die lerne ich überall, nur nicht in der Schule.<br />
Wie kriegen wir es also hin, dass wieder gelernt wird?<br />
Dann übernimmt Schule einen Teil, die Familie einen<br />
Teil, der Verein einen Teil, Nachbarschaft einen Teil,<br />
usw. Dann sind wir dort, wo wir konzeptionell gerne sein<br />
wollen. Ich wage zu behaupten, bei den Schulen beginnen<br />
wir die Diskussionen erst. Die Lehrer bzw. die GEW<br />
reagieren hysterisch, wenn wir sagen, dass wir Freiwillige<br />
am Unterricht beteiligen. Wir beteiligen systematisch<br />
die Bürgerschaft, und zwar Betroffene, Nachbarn und andere,<br />
die am Produktionsprozess Schule Anteil haben.<br />
Im dritten Feld, dem Pflegebereich, muss jetzt zügig die<br />
Diskussion geführt werden, nicht weitere Stützpunkte geschaffen<br />
werden. Eine wichtige Arbeitsgruppe diskutiert<br />
gerade, keine neuen Pflegestützpunkte aufzumachen,<br />
sondern die vorhandenen im Nachbarschaftsbereich<br />
zu integrieren. In den Verhandlungen haben wir einen<br />
harten Partner, der ist härter als der Staat, das sind die<br />
Kassen und Versicherungen. Die Kassen und Versicherungen<br />
wollen Einzelfallbewertungen haben. Warum<br />
nicht? Aber dann muss man über Erfolg reden. Was ist<br />
ein Erfolg? Das ist schon eine spannende Frage.<br />
Ich will deutlich machen, dass ich mit Ihnen der Meinung<br />
bin, dass wir quartiersbezogen denken müssen.<br />
Aber wenn wir nicht nur auf mittelstandsbeseelten Menschen<br />
sitzen bleiben wollen, sondern tatsächlich des<br />
Lebens ganze Vielfalt und die Eigenverantwortung und<br />
Solidarität im Blick haben, das bürgerschaftliche und<br />
zivilgesellschaftliche Denken, dann muss ich das Quartier<br />
als Mittel zum Zweck nutzen, nicht als Selbstzweck.<br />
Das Quartier ist das Mittel, um letztlich Lebensfragen zu<br />
lösen: das Ältersein, Jüngersein, miteinander klarkommen,<br />
das Leben bewältigen, auch mit Arbeitslosigkeit<br />
oder Krankheit oder sonstigem klarzukommen.<br />
Entsprechend ergeben sich hier Anforderungen, die jetzt<br />
den Rahmen sprengen, aber ich deute an: Wir müssen<br />
viel mehr über die Milieus in dieser Gesellschaft wissen,<br />
weil sich Mittelstandmilieus und Arbeitermilieus unterschiedlich<br />
verhalten. In Kaiserslautern muss ich mit der<br />
klassischen Arbeiterwohlfahrt daherkommen, die den<br />
Seniorenkreis machen, das ist die Form, die sie verstehen<br />
und akzeptieren. Wenn dort jemand nicht zum Geburtstag<br />
kommt, dann wird nachgeschaut, ob er krank<br />
ist. So beginnt deren Form von Selbsthilfe. Ein anderes<br />
Milieu geht völlig anders vor und findet sich vielleicht nur<br />
über ein Senioren-Theaterprojekt. Während eine dritte<br />
Gruppe vielleicht nur die ultimative Alten-WG fordert. Jemand<br />
anders wiederum meint, es müsse vor allem die<br />
Betreuung in der Nachbarschaft gewährleistet sein, weil<br />
da im 4. Stock die Blumen gegossen werden müssen.<br />
Wir brauchen milieuorientierte, auf Lebensfelder und<br />
Eigenverantwortung orientierte Bürgerschaftskonzepte,<br />
die zusammenpassen müssen mit den staatlichen Konzepten<br />
von Fallmanagement und Budgets. Das ist die
Aufgabe, vor der wir stehen, nicht vor der Frage der Zusammenfassung<br />
der Institutionen.<br />
Das bewusst zu organisieren, ist nichts anderes als „modern<br />
community organizing“. Eine deutsche Antwort auf<br />
Organizing: wir organisieren die Betroffenen, wir organisieren<br />
die Freiwilligen, wir organisieren die Fachkräfte. Und<br />
zwar nicht gegeneinander, sondern dass sie auf Augenhöhe<br />
bzw. als Partner miteinander kooperieren, weil sonst in<br />
allen Debatten immer nur die Fachkräfte reden. Auf Dauer<br />
schadet das auch den Fachkräften.<br />
TN: Eine Nachfrage zur Deinstitutionalisierung. Meinen<br />
Sie damit, dass wir nicht so sehr fragen sollten, wer macht<br />
was auf welche Weise, sondern erst die Frage nach dem<br />
Ziel stellen müssen?<br />
Konrad Hummel: Ja, es ist genau richtig, dass diese typisch<br />
deutsche Frage, wer macht was wann wie, nach<br />
meiner Vorstellung frühestens an vierter Stelle käme. An<br />
erster Stelle kommt die Frage: Was ist Euer Kerngeschäft?<br />
Was ist das Kerngeschäft des Mütterzentrums? Etwa die<br />
Arbeit der Stadt Braunschweig zu minimieren – oder was?<br />
Das Kerngeschäft ist Mütter zu mobilisieren, damit sie selber<br />
ihre Probleme lösen, das ist das Kerngeschäft. Jeder<br />
hat ein Kerngeschäft.<br />
Deinstitutionalisieren hat damit zu tun, dass ich präzise<br />
zurückfrage, gerade im Hinblick auf die Eigenverantwortung<br />
und Solidarität der Betroffenen. Man kann der Stadt<br />
oder wem auch immer durchaus sagen: So wie ihr euch<br />
das vorstellt, können wir es nicht lösen. Unabhängig vom<br />
Geld, auch mit mehr Geld nicht.<br />
Mit anderen Worten: Wir müssen immer wieder die Frage<br />
stellen: Um was geht es jetzt gerade? Danach erst geht es<br />
um die Frage: Sind das die richtigen Formen und Partner<br />
und Akteure? Habe ich alle Akteure dabei?<br />
Mein Lieblingsbeispiel: Sprachintegration junger Migranten.<br />
Die deutsche Antwort heißt: Mehr Geld für deutsche<br />
Lehrer, die Kinder in Deutsch unterrichten. Eigentlich<br />
Blödsinn. Wer konsequent denkt, muss zunächst die Frage<br />
nach dem Kerngeschäft der Integration junger Migrantenkinder<br />
stellen. Die muss über die Eltern laufen. Wenn<br />
ein deutscher Lehrer ein Kind beschult, während die Mutter<br />
daheim Null Deutsch spricht, dann treibt das Kind in<br />
die Situation, dass es immer besser deutsch spricht, aber<br />
daheim sich niemand dafür interessiert. Also muss ich<br />
die türkische Mutter mit auf den Weg nehmen. Typische<br />
deutsche, verfehlte Antwort: Die Volkshochschule macht<br />
Deutschkurse für türkische Mütter.<br />
Wir haben inzwischen 500 Stadtteilmütter in Augsburg<br />
mobilisiert, die die Zweisprachigkeit in verschiedenen<br />
Sprachen organisieren. Wenn aber die daraus resultierende<br />
Dynamik richtig verstanden wird, lässt das die Männer<br />
nicht kalt, das lässt die gesamte Familie nicht kalt. Es<br />
können Eifersuchtsdramen in den Familien auftauchen,<br />
weil sich die türkischen Frauen emanzipieren. Da können<br />
plötzlich auch Migranten-Männer zu Partnern werden, usw.<br />
Das wäre alles nicht zustande gekommen, wenn deutsche<br />
Lehrer die Kinder in Deutsch unterrichtet hätten.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 101
Workshop<br />
Nachttöpfe und Menschwerdung<br />
Zum Verhältnis von familiärer und „öffentlicher“ Erziehung<br />
„Von der Leyen wird immer umstrittener. (...) 500.000<br />
neue Betreuungsplätze geplant. Die siebenfache Mutter<br />
will bis zum Jahre 2013 500.000 neue Betreuungsplätze<br />
für Kinder unter 3 Jahren schaffen.und bekam dafür<br />
am Montag vom CDU-Parteipräsidium unter Führung<br />
von Angela Merkel Rückhalt. Nach der Sitzung hielt allerdings<br />
der Unmut in Teilen der Union. Die Kritiker aus<br />
dem konservativen Flügel fürchten um eins der wichtigsten<br />
Merkmale der Unionsparteien, das traditionelle<br />
Familienbild mit berufstätigem Vater und Hausfrau, die<br />
sich um die Kindererziehung kümmert. (...) Der CSU-<br />
Politiker Ramsauer sagte dem ‚Münchner Merkur‘ vom<br />
Donnerstag: ‚Viele in der Union betrachten so manche<br />
Vorstellungen der Ministerin nicht als ihre Familienpolitik.‘<br />
Der Vorschlag von der Leyens bedeute, dass die<br />
außerfamiliäre Betreuung von Kindern zum alleinigem<br />
Leitbild würde. Bayerns Landtagspräsident Alois Glück<br />
(CSU) warnte die Schwesterpartei davor, berufstätige<br />
Eltern zu bevorzugen. ‚Der Eindruck ist momentan jedenfalls<br />
mit der Politik der Bundesfamilienministerin<br />
verbunden, und das kann nicht unsere Position sein‘,<br />
bemängelte Glück im Deutschlandfunk. Die Familienpolitik<br />
dürfe nicht zur Unterabteilung der Arbeitsmarktpolitik<br />
werden.“<br />
Focus online vom 14.02.07<br />
Input:<br />
Dr. Dagmar Voelker<br />
(Ärztin für Neurologie und Psychiatrie, Leipzig)<br />
„Frühe Kindheitserfahrungen und ihr Einfluss auf die<br />
Persönlichkeitsbildung - Erkenntnisse aus einer<br />
aktuellen Studie zur Krippenerziehung in der DDR“<br />
Moderation:<br />
Petra Sperling<br />
Petra Sperling: Zum Einstieg drei Zitate, die deutlich machen,<br />
wie heiß umstritten die Fragen sind, mit denen wir<br />
uns in diesem Workshop beschäftigen wollen:<br />
Krippenkinder gehen öfter auf das Gymnasium<br />
ura. FRANKFURT, 3. März. Kinder, die eine Krippe besuchen,<br />
gehen später mit höherer Wahrscheinlichkeit auf<br />
das Gymnasium als solche, die bis zum Alter von drei Jahren<br />
zu Hause betreut wurden. Zu diesem Schluss kommt<br />
eine am Montag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-<br />
Stiftung, die die Bildungsverläufe von 1000 Kindern der<br />
Jahrgänge 1990 bis 1995 untersuchte. Der positive Effekt<br />
auf den Bildungsweg mache sich vor allem bei Kindern,<br />
deren Eltern einen Hauptschulabschluss haben,<br />
sowie bei Einwandererkindern bemerkbar. So steige die<br />
Wahrscheinlichkeit, das Gymnasium zu besuchen, für<br />
die erste Gruppe um 83 Prozent, für die zweite um 56<br />
Prozent. 16 Prozent der untersuchten Kinder besuchten<br />
eine Krippe, die meisten erst im Alter von zwei Jahren und<br />
zwei Drittel von ihnen halbtags. Von den Krippenkindern<br />
besuchte jedes zweite später das Gymnasium, von den<br />
zu Hause betreuten 36 Prozent. Weil das Lebenseinkommen<br />
eines Gymnasiasten höher als das eines schlechter<br />
Ausgebildeten sei, entstehe langfristig ein durchschnittlicher<br />
„Netto-Nutzen“ von 13 616 Euro je Kind, das eine<br />
Krippe besuche. Die Kosten eines Krippenplatzes würden<br />
so mehr als wettgemacht, argumentieren die Verfasser.<br />
Nach ihren Berechnungen hätte es zudem einen<br />
volkswirtschaftlichen Nutzen von 2,1 Milliarden Euro je<br />
Geburtsjahrgang bedeutet, wenn 35 Prozent der Kinder<br />
eines Jahrgangs eine Krippe besucht hätten. Diese Quote<br />
strebt Familienministerin von der Leyen (CDU) mit dem<br />
Ausbau der Krippenplätze an.<br />
Text: Frankfurter Allgemeine Zeitung / Sonntagszeitung vom 4.3.2008, Seite 5
Dagegen steht die These einer defizitären Entwicklung und<br />
eines höheren Kriminalitätsrisikos bei Krippenkindern:<br />
Entwicklung, höheres Kriminalitätsrisiko<br />
Aus der Rezension zu einem Buch von Wolfang de Boor<br />
„Kinderkriminalität, Chancen einer grundlegenden Prävention“<br />
„Die Urangst des Kleinkindes wird durch die ständige Nähe<br />
der primären Bezugsperson beschwichtigt. So entsteht<br />
Urvertrauen. Es ermöglicht freundliche Empfindungen<br />
gegenüber anderen Menschen, führt zu sozialen Beziehungen<br />
und verhindert brutales, aggressives Verhalten.<br />
Als kontinuierliche primäre Bezugsperson sieht de Boor<br />
idealerweise die Mutter; doch kann sie auch durch eine<br />
andere Person ersetzt werden.<br />
Die „Kinderkrippenkultur“ der früheren DDR sieht der<br />
Autor äußerst kritisch: „Frühmorgens wurden Säuglinge<br />
und Kleinkinder aus dem Schlaf gerissen, verpackt und in<br />
Säuglingsheimen oder Kinderkrippen abgeliefert. Abends<br />
holte man sie wieder ab. Aber Vater und Mutter waren<br />
erschöpft. Für die Kinder blieben nur Reste an Zeit und<br />
Kraft. Die Folgen der emotionalen Vernachlässigung - als<br />
frühkindliche Deprivation bezeichnet - wurden v. a. von Autoren<br />
aus den einstmals sozialistischen Ländern beschrieben.“<br />
De Boors Schlussfolgerung: Die Mutter leiste mit ihrem<br />
Engagement die grundlegende Kriminalprävention. Weder<br />
Krippe, noch Kindergarten, Schule oder andere öffentliche<br />
Einrichtungen seien in der Lage, die Mutter zu ersetzen.“<br />
Newsletter 10/2007 (Austrocare)<br />
Dagmar Voelker: Der ausgedruckte Titel des Workshops<br />
lautet: „ Nachttöpfe und Menschwerdung – zum Verhältnis<br />
von familiärer und öffentlicher Erziehung“ - „Frühe Kindheitserfahrungen<br />
und ihr Einfluss auf die Persönlichkeitsbildung<br />
– Erkenntnisse aus einer aktuellen Studie zur Krippenerziehung<br />
in der DDR“ – eigentlich müsste es heißen:<br />
„Was bedeutet frühe Fremdbetreuung in der Entwicklung<br />
eines Menschen“ – und was die DDR betrifft, hätten wir<br />
unserer Studie lieber den Titel gegeben: „Es war halt so“.<br />
Vielleicht lässt sich durch die Betrachtung schwieriger<br />
Fremdbetreuungsarrangements, wie sie in der DDR mit<br />
fast flächendeckender Krippenerziehung der Säuglinge<br />
und Kleinkinder , strengen Erziehungsplänen, kaum Elternbeteiligung<br />
in der Krippenerziehung, keine Eingewöhnungszeiten<br />
- praktiziert wurden, besonders viel lernen<br />
für die angestrebte Krippenpraxis der Jetztzeit. Unserer<br />
Familienministerin hat bis 2013 ein umfassendes Recht<br />
der bis dahin geborenen Kinder auf einen Krippenplatz<br />
in Aussicht gestellt. Das bedeutet die Ausbildung von ca.<br />
70 – 90000 Krippenerzieherinnen bis dahin, und bis jetzt<br />
gibt es noch keine detaillierten Vorstellungen darüber, wie<br />
diese ausgewählt und ausgebildet werden sollten, damit<br />
diese Riesenaufgabe gelingen kann.<br />
In der DDR gab es bis 1989 das dichteste Netz von Kinderkrippen<br />
in Europa. 80 % aller 0-3jährigen hatten einen<br />
Krippenplatz, es gab 7707 Einrichtungen mit 348 058<br />
Plätzen. Die Altersgrenze der Krippenaufnahme verschob<br />
sich im Lauf der Jahre seit 1950 erheblich nach oben, auch<br />
die Zahl der Wochenkrippen nahm ab 1970 ab. Seit 1976<br />
gab es das „Babyjahr“ mit bezahlter Freistellung eines Elternteils<br />
von der Arbeit, so dass ab dieser Zeit die Kinder<br />
seltener unter 1 Jahr in der Krippe aufgenommen wurden.<br />
Die Krippen unterstanden dem Gesundheitsministerium<br />
und die Mitarbeiterinnen hatten eine pflegerische oder<br />
pädagogische Ausbildung als Kinderkrankenschwester<br />
oder Krippenerzieherin.<br />
In den Haltungen zum Kind wurde dabei von einem Defizitmodell<br />
ausgegangen: Kinder sind werdende Erwachsene<br />
– alles, was sie noch nicht wissen und können, wird als<br />
Mangel verstanden. Außerdem wären Kinder grenzenlos<br />
formbar – das ist das „Tabula rasa – Modell“, sie sind leer<br />
und müssen gefüllt werden. Zuletzt ging man von einem<br />
Kollektivierungsmodell aus: Kinder haben sich ein angepasstes,<br />
rational bewusstes und gesellschaftsverpflichtendes<br />
Verhalten anzueignen. Diese Umsetzung erfolgte<br />
über ein einheitliches Erziehungsprogramm. Man war der<br />
Überzeugung, nur durch die Lenkung eines Erwachsenen<br />
kann sich ein Kind entwickeln. Deshalb sollten die Kinder<br />
auch so früh wie möglich in die Krippe aufgenommen werden,<br />
um früh mit der Prägung der Kinder zu sozialistischen<br />
Persönlichkeiten zu beginnen.<br />
2004 fanden wir sechs analytisch arbeitende Kollegen<br />
uns zusammen, um ein Forschungsprojekt zu den Folgen<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 103
104<br />
Workshop Nachttöpfe und Menschwerdung<br />
Nachttöpfe und Menschwerdung<br />
früher Trennungen von den Hauptbezugspersonen durch<br />
Krippenerziehung in der DDR zu gestalten. Diese Arbeit<br />
war etwa 2000 geplant worden und wurde von der Stiftung<br />
zur Aufarbeitung der DDR – Diktatur unterstützt. Das Thema<br />
wurde also lange bevor die Problematik früher Fremdbetreuung<br />
durch die Medien sehr kontrovers diskutiert<br />
und hoch emotional aufgeladen wurde, aufgenommen.<br />
Wir wurden sozusagen durch die Tagespolitik eingeholt,<br />
die uns auch anregte und den Blick für die Notwendigkeit<br />
der „Vergangenheitsbewältigung“ schärfte. Wir haben viel<br />
Zeit und Engagement in diese Arbeit gesteckt, die neben<br />
der Neugier des Entdeckens auch durch den unterschwelligen<br />
Wunsch, ein Stück unserer eigenen DDR - Lebensgeschichte<br />
zu bearbeiten, motiviert war.<br />
Wir waren fünf Frauen und ein Mann, vier Frauen kannten<br />
sich schon seit dem Studium und hatten eine DDR<br />
- Vergangenheit, eine westdeutsche Kollegin hatte Forschungserfahrungen<br />
und einen Außenblick für unser Vorgehen.<br />
Wir interviewten 18 Frauen und 2 Männer zu ihren<br />
Krippenerfahrungen und der anschließenden Lebensgeschichte.<br />
Die Teilnehmer waren zwischen 1968 und 75<br />
geboren und hatten selbst Kinder, die sie in Kindereinrichtungen<br />
abgegeben hatten, diese Erfahrung also auch<br />
als Eltern erlebt hatten. Wir gewannen die Interviewten<br />
teils durch Aushänge im Kindergarten, teils durch persönliche<br />
Vermittlung und machten mit ihnen ein einmaliges,<br />
mit Tonband aufgezeichnetes Interview, das später transskibiert<br />
und erst von jedem einzeln, dann in der Gruppe<br />
ausgewertet wurde. In unseren Köpfen half beim Interview<br />
ein erarbeiteter Leitfaden, die Erzählungen bestimmter<br />
Themenbereiche zu Krippenerfahrung, zu den familiären<br />
Bedingungen und der weiteren Entwicklung bis zur Elternschaft<br />
zu erfassen, während wir die Teilnehmer zunächst<br />
aufforderten, frei zu erzählen und unsere Aufmerksamkeit<br />
zwischen dem Erzähltem und den in uns ausgelösten<br />
Gefühlen hin und her ging.<br />
In der Gruppenauswertung entwickelten wir dann verschiedene<br />
Perspektiven für die Auswertung, von denen<br />
ich nur einige nennen will: Motive für die Teilnahme und<br />
die Interaktion mit dem Interviewer, die Lebensumstände<br />
der Eltern, die Gründe für die Krippenabgabe der Kinder,<br />
Auswirkungen der Trennungserfahrung auf die psychische<br />
und körperliche Gesundheit, das Erleben der Adoleszenz<br />
und der Wende, die Reaktualisierung früher Trennungserfahrungen<br />
bei der eigenen Elternschaft, der Einfluß der<br />
Krippenbetreuung auf die Erziehung der eigenen Kinder<br />
und Überlegungen zur transgenerationalen Weitergabe<br />
von Lebens- und Verhaltensmustern.<br />
Beim Anhören dieser Lebensgeschichten stieg sehr viel<br />
DDR – Atmosphäre mit ihrer Enge und Angepasstheit auf.<br />
Wir empfanden oft tiefe Trauer über die Sprachlosigkeit<br />
der frühen schmerzlichen Erfahrungen und die stillschweigende<br />
Angepasstheit der Interviewten. Wir wollten ihnen<br />
durch diese Untersuchung eine Sprache verleihen, damit<br />
diese Erfahrungen nicht ungehört verschwinden. Wir hatten<br />
selber keine Krippe besucht, als junge Eltern ebenfalls<br />
Beruf und Kinderbetreuung vereinen wollen und für unsere<br />
Kinder verschiedene, individuelle Lösungen – teils<br />
mit Krippe, teils mit anderen Ressourcen gefunden und<br />
fanden die staatlich protegierte Krippenerziehung in der<br />
DDR schon damals sehr problematisch. Von den Interviews<br />
waren wir meist sehr betroffen. Besonders dann,<br />
wenn wir spürten, dass es wenig Gefühl für die eigenen<br />
Lebensgeschichte und auch wenig Nachdenken über das<br />
eigene Leben gab. Bemerkungen, wie „Das war halt so“<br />
oder „ das hat mir doch nicht geschadet“, „das haben<br />
alle so gemacht“ kamen sehr häufig und wurden wie eine<br />
Fahne hochgehalten.<br />
Dadurch, dass eigene sprachliche Erinnerungen für die<br />
frühe Krippenzeit nicht verfügbar sind, waren wir auf unser<br />
analytisches Instrumentarium an genauem Erfassen,<br />
was zwischen Interviewer und Interviewtem passiert,<br />
angewiesen. Es war eine Situation zwischen zwei Unbekannten<br />
in verschiedenen Rollen: die eine Person war eingestimmt<br />
und aufgefordert, über ihr Leben zu erzählen,<br />
die andere hatte das im Interview Erlebte aufzunehmen,<br />
ihren Gefühle nachzuspüren, es vom eigenen Hintergrund<br />
abzugrenzen und das Aufgenommene kritisch zu verarbeiten.<br />
In dieser Szene spiegelt sich etwas vom Abgegebenwerden<br />
in eine unbekannte Situation wider, die vielleicht<br />
etwas mit dem existentiellen Erleben der Frühtrennung zu<br />
tun hat. Zum Beispiel zeigte es sich, dass die Teilnehmer,<br />
die bis zu einem Vierteljahr in die Krippe abgegeben wurden,<br />
einem höheren Grad an Anpassung und Identifikati-
on mit dem Interviewer aufwiesen als später abgegebene.<br />
Die Gegenübertragungsgefühle in der Auswertungsgruppe<br />
waren hier durchweg heftiger bei den früh abgegebenen<br />
Kindern. Es gab tiefe Berührung, Trauer und Mitgefühl,<br />
angestrengte Spannung und Unruhe bis zu Angst, auch<br />
Ärger, aber kaum Distanz. Der Trennungszeitpunkt in der<br />
Früherfahrung unserer Interviewten spielte also eine erhebliche<br />
Rolle bei der Persönlichkeitsentwicklung unserer<br />
Interviewten, die ja auch keine Eingewöhnungszeiten in die<br />
Krippen hatten und meist 8-9 Stunden dort untergebracht<br />
waren. Es ist daher anzunehmen, dass die Bewältigungsstrategien<br />
der früh abgegebenen Kinder deshalb eher zu<br />
Identifikation uns Anpassung mit den Autoritäten führten.<br />
Versorgungswünsche wurden als aussichtslos eher verborgen<br />
als bei den später abgegebenen, bei denen der<br />
latente Protest viel deutlicher war. Sie können sich vorstellen,<br />
dass sich solche Erfahrungen, die zu Haltungen in der<br />
Persönlichkeitsentwicklung führen, sehr deutlich selbst in<br />
dem kleinen Ausschnitt eines Interviews über das eigene<br />
Leben zeigen.<br />
Was ist nun herausgekommen aus unserer Studie?<br />
1) Die Ergebnisse unserer Untersuchung von Erfahrungen<br />
in den DDR – Kinderkrippen sind spezifisch und lassen<br />
sich nicht ohne weiteres auf die aktuelle Krippenbetreuung<br />
übertragen. Eine Pauschalverurteilung der DDR – Krippen<br />
wird der Realität nicht gerecht. Es gab große Krippen mit<br />
sehr unpersönlich, rigidem Umgang mit den Kindern und<br />
kleine, ländliche oder Betriebskrippen mit kleinen Gruppen<br />
und konstantem Personal, gutem Kontakt zwischen<br />
Eltern und Erzieherinnen. Hier konnten auch familiäre Defizite<br />
ausgeglichen werden ( in der DDR gab es oft sehr<br />
junge Eltern, oft ungefestigt, überfordert)<br />
2) De Eltern – Kindbeziehung und die Einstellung der Eltern<br />
zur Fremdbetreuung ist entscheidend dafür, wie sich<br />
eine frühe Fremdbetreuung in der Krippe auf das Kind<br />
auswirkt. In der DDR erfolgte die Fremdbetreuung meist<br />
aus staatlichen Vorgaben, die Familie hatte kaum Mitspracherechte,<br />
was zu großen Belastungen der Kinder und Eltern<br />
führte. Aber es gab auch gegenteilige Erfahrungen.<br />
3) Die Qualität der Beziehung zwischen Krippenerzieherin<br />
und Kind ist ebenso von Bedeutung. In den Interviews haben<br />
wir viel von vereinnamenden Zwängen gehört – Mittagsschlaf,<br />
Aufessen, nicht sprechen dürfen – es wurde<br />
deutlich, wie wichtig ausgewogene, auf die Individualität<br />
des Kindes abgestimmte, dyadische Beziehungen zwischen<br />
Erzieherin und Kind sind, die nur eine Betreuungsschlüssel<br />
von 1: 3 oder 1:4 möglich machen. Ebenso gehört<br />
eine gute und enge Elternarbeit zu dieser Qualität.<br />
4) Die meisten Interviewpartner beschrieben die Krippenerfahrung<br />
positiv, gaben ihre eigenen Kinder erst viel später,<br />
nämlich 14,5 Monate später in eine Einrichtung und<br />
zwar mit einer ausreichenden Eingewöhnungszeit. Dies<br />
geschah einerseits aus Einsicht, andererseits war es eine<br />
Anpassungsreaktion an die veränderten Verhältnisse.<br />
5) Der Zeitpunkt der Krippenaufnahme muss besonders<br />
sorgfältig bedacht werden. Dabei haben wir festgestellt,<br />
dass bei unseren Teilnehmern die sehr frühe Krippenaufnahme<br />
ein hohes gesundheitliches Risiko darstellt. Elternzeit<br />
wird meist als Beraubung an der Berufszeit angesehen,<br />
während sie aus Sicht des Kindes eine Beraubung<br />
seiner Zeit mit den Eltern darstellt.<br />
6) Die ärztliche und gesellschaftliche Fürsorge für das Kind<br />
sollte auf die Eltern – Kind –Beziehung erweitert werden.<br />
Der Zeitpunkt der Krippenaufnahme sollte sich nach den<br />
Bedürfnissen von Eltern und Kind richten und nicht nur<br />
nach äußeren Erfordernissen. Eine ausschließliche Familienbetreuung<br />
für ein Kleinkind ist auch oft nicht die Garantie<br />
für eine optimale Entwicklung. Bei einer Entscheidung<br />
für oder gegen eine Krippenbetreuung sollte immer bedacht<br />
werden, welcher individuelle Weg die Eltern – Kind<br />
– Beziehung entlastet und fördert. Hierher gehört auch die<br />
Anerkennung der Väter. In unserer Untersuchung war vor<br />
allem die Abwesenheit der Väter als zusätzlicher Risikofaktor<br />
auffällig. Es sollte also bei der Betreuungsentscheidung<br />
die Bedeutung des Vaters mitbedacht werden und<br />
nach Möglichkeiten gesucht werden, die Familienarbeit<br />
sinnvoll aufzuteilen, ohne die berufliche Entwicklung für<br />
ein Elternteil nachhaltig zu beeinträchtigen.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 105
106<br />
Workshop Nachttöpfe und Menschwerdung<br />
Nachttöpfe und Menschwerdung<br />
Was wir diskutieren sollten, sind die Fragen: Welche Werte<br />
wollen wir unseren Jüngsten weitergeben? Wie viel Individualität<br />
und wie viel Kollektiv braucht eine zukunftsfähige<br />
Gesellschaft?<br />
TN: Unsere Erfahrung als Träger einer Kindertagesstätte<br />
in Köln ist, dass Eltern, die ihre Kinder schon sehr früh in<br />
die Einrichtung geben, das meistens aus wirtschaftlichen<br />
Zwängen heraus tun. Allerdings geht es dabei meistens<br />
nicht um eine Ganztagsbetreuung von 8 bis 9 Stunden,<br />
sondern um einige Stunden, also eher halbtags. Wir legen<br />
bei der Aufnahme sehr viel Wert auf die Eingewöhnungszeit.<br />
Ein anderer Aspekt ist, dass es für diese Kinder in der<br />
Regel sehr gut ist, für ein paar Stunden auch einmal aus<br />
einer häuslichen Umgebung herauszukommen, wo man<br />
sich nicht sehr intensiv um sie kümmert.<br />
Petra Sperling: Wir dürfen nicht vergessen, dass es Anfang<br />
der 90er Jahre eine gründliche Neuorientierung in<br />
der Krippenerziehung in Ost und West gegeben hat. Die<br />
Krippen- und Kitaleitungen wurden geschult und es wurde<br />
ihnen der Situationsansatz nahe gelegt. Das heißt: auf die<br />
momentan vorhandenen Bedürfnisse des Kindes zu reagieren,<br />
statt den Tagesablauf starr durchzustrukturieren<br />
– mit Frühstück, Töpchen, Beschäftigung, also eher frei<br />
zu schauen, was liegt an. Das bedeutet auch für das Kind<br />
mehr Freiraum zur Persönlichkeitsentwicklung.<br />
TN: Ein entsprechendes Umdenken hat nicht erst in den<br />
90er Jahren stattgefunden, sondern es hat auch in der<br />
DDR schon Mitte der 80er Jahre begonnen. Das wurde<br />
zwar unterschiedlich umgesetzt, aber es hat nicht erst mit<br />
der Wende begonnen. Es gab sogar ein entsprechendes<br />
offizielles neues Erziehungsprogramm.<br />
TN: Das kann ich so nicht bestätigen. Ich selbst bin Jahrgang<br />
67, komme aus Greifswald. Ich bin selbst nicht in die<br />
Krippe gegangen und hatte deswegen erst im Jahr 2000<br />
mehr mit dem Thema zu tun, als wir uns für unsere 1999<br />
geborene älteste Tochter nach einem Betreuungsplatz umsahen,<br />
also gut 10 Jahre nach der Wende. Ich hatte den<br />
Eindruck, auf einer Zeitreise zu sein. In der ersten Kita,<br />
die wir uns ansahen, sind wir im Treppenhaus einem Plan<br />
begegnet, wo der Tag minutiös durchstrukturiert war mit<br />
Bezeichnungen wie ‚Hygienezeit’ oder so ähnlich, gruselig.<br />
Wir haben dann schließlich eine Einrichtung gefunden, die<br />
Montessori-Pädagogik machen wollte, aber auch da war<br />
es so, dass die Leitung große Schwierigkeiten hatte, den<br />
DDR-geschulten Mitarbeiterinnen die Grundlagen dieses<br />
Konzeptes zu vermitteln. Ich höre das ähnlich nach wie<br />
vor aus dem Kollegenkreis. Dieser Paradigmenwechsel ist<br />
noch nicht richtig angekommen.<br />
Dagmar Voelker: Es braucht offenbar Zeit. Bis sich das<br />
wirklich verändert, das dauert wahrscheinlich mehr als<br />
eine Generation.<br />
TN: Ich glaube, dass hier im Westen etwas ganz Wichtiges<br />
passiert war. Es gab die kritische Auseinandersetzung mit<br />
der öffentlichen Erziehung im Zusammenhang der Studentenbewegung.<br />
Und da hat es eine starke Suche nach<br />
Alternativen gegeben. Dabei wurde auch über die Landesgrenzen<br />
hinaus geguckt und u.a. die Montessori-Pädagogik<br />
entdeckt. Aber das große Erlebnis in den 70er Jahren<br />
in Berlin war Reggio/Emilia in Italien. Wir sind geradezu<br />
nach Reggio gepilgert. In Reggio/Emilia in Norditalien wurde<br />
die öffentliche Erziehung als Alternative zur kirchlichen<br />
Kleinkindpädagogik entwickelt. Ausgangspunkt war hier<br />
ein ganz anderes Menschenbild als in Kindern nur die werdenden<br />
Erwachsenen zu sehen. Kindheit wird vielmehr als<br />
eine Lebensphase mit eigener Bedeutung gesehen. Ich erinnere<br />
an einen Satz wie „Jedes Kind hat 1000 Sprachen“.<br />
Es ging nicht darum, den Kindern etwas auszutreiben,<br />
sondern sie in allem zu fördern, was in ihnen angelegt ist,<br />
alle Sinne zu entfalten und alle Fähigkeiten zu entdecken<br />
und zu entwickeln., auch schon im Krippenalter. Auf dieser<br />
Grundlage sind viele selbständige, meist kleinere Einrichtungen<br />
im Laufe der letzten 30 Jahre entstanden und haben<br />
großen Einfluss auf die Erziehungsdiskussion gehabt.<br />
TN: Ich habe heute in der U-Bahn das Gespräch zweier<br />
Kita-Erzieherinnen mit gehört, die sich über die geplante<br />
Ausweitung des Rechtsanspruches auf einen Kita-Platz<br />
unterhalten haben und dabei vor allem die Befürchtung
hatten, dass dadurch schließlich noch mehr an Arbeit<br />
und Ansprüchen auf sie zukommen würde, wo sie doch<br />
schon jetzt mit allen Anforderungen an Datenerfassung<br />
etc. extrem überfordert seien. Sie machten den Eindruck,<br />
die Kinder in ihrer Einrichtung eher als Belastung<br />
zu empfinden. Das ist bestimmt keine gute Grundlage,<br />
um denen das Gefühl zu vermitteln, geliebt und gewollt<br />
zu sein. Ich komme aus dem Westen – und wenn ich an<br />
meine eigene Kita-Erfahrung zurückdenke, erinnere ich<br />
mich daran, dass vieles ganz schrecklich war. Wenn eins<br />
der Kinder etwas angestellt hatte, mussten sich z.B. alle<br />
anderen in einer Reihe aufstellen und mussten dann SO<br />
machen – und das war im Westen, in Niedersachen. Es<br />
ist nicht alles eine Systemfrage. Im Osten wie im Westen<br />
gab es das eine und das andere, es hängt von den<br />
Menschen ab, die schließlich den Kindern gegenüber<br />
stehen.<br />
Dagmar Voelker: Kein Kind würde sich so eine Institution<br />
wie die Kinderkrippe ausdenken. Aus der Perspektive<br />
des Kindes besteht dafür kein Bedarf. Aber die Frage der<br />
Fremdbetreuung von Kindern ist keine neue Angelegenheit<br />
sondern zieht sich durch die ganze Geschichte der<br />
Menschheit hindurch. Sie hat etwas mit Notwendigkeiten<br />
der Lebensgestaltung von Erwachsenen zu tun. Die Aufgabe<br />
der Krippe besteht vor allem darin, die Trennung von<br />
den eigentlichen Bezugspersonen so gut wie möglich zu<br />
ermöglichen. Trennung bedeutet in jedem Fall Stress. Eine<br />
gute Krippe reduziert den Stress. Es geht nicht darum, keine<br />
Probleme damit zu haben, sondern sie möglichst gut<br />
zu bewältigen.<br />
Petra Sperling: Wichtig ist das Alter, in dem die Trennung<br />
stattfindet. Aus entwicklungspsychologischer Sicht lebt<br />
das Kind bis zum Alter von 3 Jahren in einer symbiotischen<br />
Beziehung zu einer primären Bezugsperson.<br />
Dagmar Voelker: Symbiose würde ich nicht sagen. Zwar<br />
ist es bei jedem Kind verschieden, aber es ist ja so, dass<br />
das Kind von Geburt an nicht ständig nur mit einer einzigen<br />
Person zu tun hat.<br />
TN: Ich finde, hier wird ein zu einseitiges Bild gezeichnet.<br />
Wenn wir an die gutbürgerlichen Schichten der Vergangenheit<br />
denken, dann ist auch da eine Element von Fremderziehung<br />
gang und gäbe, wenn die Kinder schon früh einem<br />
Kindermädchen anvertraut<br />
werden. Hat ihnen das geschadet?<br />
Wäre es nicht<br />
vielleicht eher eine Mangel,<br />
wenn ihnen nur eine einzige<br />
Bezugsperson zur Verfügung<br />
stünde, noch dazu nur<br />
eine weibliche? Ich sehe es<br />
jedenfalls als eine positive<br />
Entwicklung an, dass auch<br />
andere, nicht zuletzt die<br />
Väter, als Bezugspersonen<br />
eine Rolle zu spielen beginnen.<br />
Ebenso sehe ich es<br />
als positiv an, dass Mütter<br />
anfangen, ihren Tagesablauf<br />
so zu gestalten, dass nicht alles von der Beziehung<br />
zum Kind abhängt, sondern dass sie auch ihren eigenen<br />
Bedürfnissen nachgehen können. Das führt zu einer größeren<br />
Zufriedenheit mit der Situation und insofern auch<br />
dazu, eine bessere Mutter zu sein.<br />
TN: Es ist fraglich, ob Kreuz- und Quer-Vergleiche über die<br />
Zeiten wirklich sinnvoll sind, weil jede Situation in ihrem<br />
eigenen gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden<br />
muss. In einer konkreten Situation gibt es bessere und<br />
schlechtere aktuell realisierbare Lösungen, aber kaum die<br />
Möglichkeit zu radikalen Alternativen, die einem gänzlich<br />
anderen Kontext entstammen.<br />
Petra Sperling: Ich schlage vor, nicht die Frage nach guten<br />
oder schlechten Zeiten in den Mittelpunkt zu stellen, sondern<br />
die Frage, was machen wir daraus als Stadtteilzentren<br />
für unsere Konzepte und unsere Arbeit.<br />
TN: Wir sollten nicht nur von Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten<br />
reden, so sinnvoll das auch ist, sondern wir<br />
müssen auch die Ausgangsbedingungen mitdenken. So<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 107
108<br />
Workshop Nachttöpfe und Menschwerdung<br />
Nachttöpfe und Menschwerdung<br />
kann es nicht um einen bloßen Ausbau gehen, wenn dabei<br />
Gruppengrößen von 20 oder mehr Kindern entstehen, also<br />
Situationen, die für Kinder nicht förderlich sind. Wir erleben<br />
in Nordrhein-Westfalen gerade eine Parallelentwicklung<br />
an den Ganztagsschulen, wo aus Geld- und Personalmangel<br />
z.B. zwei Gruppen aus je 25 Kindern sich einen<br />
Raum teilen sollen – und damit eine immense qualitative<br />
Verschlechterung der Betreuungssituation gegenüber der<br />
bisherigen Horterziehung stattfindet. Eine scheinbar positive<br />
Entwicklung wie der Ausbau der Ganztagsbetreuung<br />
erweist sich in der Realität als negativ. Da verwalten wir<br />
einen Notstand und vernachlässigen die individuelle Förderung<br />
der Kinder massiv.<br />
TN: Die Frage der Betreuungsqualität spielt auch bei der<br />
Frage Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine Rolle. Ich<br />
möchte als Frau arbeiten gehen können, aber um dabei<br />
entspannt und effektiv zu sein, brauche ich zugleich das<br />
Gefühl, dass meine Kinder in der Fremdbetreuung gut<br />
aufgehoben sind. Deswegen habe ich ein Interesse daran,<br />
dass die Erzieher/innen in den Kindertagesstätten<br />
nicht gänzlich überfordert sind, weil man sich nur auf den<br />
Ausbau von Quantitäten konzentriert. In diesem Zusammenhang<br />
spielt m.E. auch die Frage der Bezahlung eine<br />
Rolle. Wenn Menschen im Erzieherberuf schlecht bezahlt<br />
werden, drückt sich darin auch eine gewisse Missachtung<br />
ihres Aufgabengebietes aus.<br />
Petra Sperling: Die geplante Schaffung von 500.000 neuen<br />
Plätzen bis 2013 bedeutet eine große Herausforderung,<br />
insbesondere wenn wir sehen, wie viele Defizite und Unterbesetzungen<br />
es in der aktuellen Situation bereits gibt.<br />
TN: Das klingt jetzt wieder so, als sei alles schlecht. Ich<br />
finde, dass sich in den letzten Jahren auch im Rahmen<br />
der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der aktuellen<br />
Finanzierungsmöglichkeiten hervorragende Betreuungseinrichtungen<br />
entwickelt haben, wobei die konkreten<br />
Veränderungsbedarfe von unten formuliert werden, von<br />
den Eltern und von den Mitarbeiter/innen. Der Bedarf an<br />
zusätzlichen Krippenplätzen wird nicht von Frau von der<br />
Leyen erfunden, er wird vielmehr von den Eltern geäußert<br />
und an uns herangetragen. Wir reagieren darauf – und<br />
sind für diese Arbeit gut aufgestellt, weil sie bei uns nicht<br />
im luftleeren Raum stattfindet, wir haben die Erfahrung<br />
mit Anschlusseinrichtungen wie Kita und Betreuungsangeboten<br />
in Kooperation mit Schulen. Eltern werden als Experten<br />
mit einbezogen und unterstützt, wenn sie sich für<br />
Verbesserungen (auch durch ehrenamtliche Mitwirkung)<br />
engagieren. Insofern sind wir Bestandteil eines großen<br />
Netzes, mit dem wir viel selbst bewegen können. Gerade<br />
deshalb brauchen wir nicht nur Forderungen an andere zu<br />
stellen, brauchen uns aber auch nichts überstülpen zu lassen,<br />
was wir nicht für richtig halten.<br />
TN: Ich bin mit diesem Beitrag nicht 100% zufrieden. Auf<br />
der einen Seite hast Du Recht: es wird viel geleistet, aber<br />
es kann bessere Arbeit geleistet werden, wenn wir mit einigen<br />
unserer Forderungen Erfolg haben. Wir dürfen nicht<br />
darauf verzichten, diese Forderungen zu formulieren. Und<br />
dabei geht es im Wesentlichen um Geld und um Qualifizierung.<br />
TN: Was wir in den Nachbarschaftshäusern an Leistung<br />
entwickelt haben, hängt nicht in erster Linie mit der Finanzierung<br />
zusammen, teilweise sogar im Gegenteil. Wir<br />
haben in den letzten Jahren erhebliche Mittelkürzungen<br />
hinnehmen müssen und haben trotzdem unsere Arbeit immer<br />
wieder verbessert.<br />
TN: Man kann die Berliner Verhältnisse nicht so verallgemeinern.<br />
Es gibt in der Bundesrepublik Regionen, wo noch<br />
sehr viel Nachholbedarf besteht.<br />
TN: Auch in Berlin ist nicht alles so toll. Ich höre aus der<br />
Praxis Berichte über den Ersatz von Fachpersonal durch<br />
Hilfskräfte, über den Einsatz von ‚Subunternehmern’ bei<br />
den Eigenbetrieben in Bereichen, in denen früher Stammpersonal<br />
beschäftigt war. Der Ausbau von Betreuungskapazitäten<br />
hat manchmal etwas Fabrikmäßiges.<br />
TN: Wir müssen die richtige Balance zwischen der Betonung<br />
dessen, was wir erreicht haben, und weitergehenden<br />
Forderungen finden. Wir sollten uns nicht wie Kinder ver-
halten, die darauf bestehen, alles zu bekommen, aber wir<br />
sollten auch klar sagen, wo die Grenzen dessen sind, was<br />
wir leisten können, wenn sich die Rahmenbedingungen<br />
nicht verbessern. Der soziale Bereich mit seinen Gutmenschen<br />
sollte sich nicht als beliebig ausbeutbar darstellen.<br />
Das ist auf Dauer kontraproduktiv. Beschäftigte in<br />
der freien Wirtschaft würden sich nicht in gleicher Weise<br />
moralisch unter Druck setzen lassen, sondern ggfs. klarere<br />
Grenzen ziehen.<br />
TN: In der ‚freien Wirtschaft’ gibt es inzwischen eine Reihe<br />
von Beschäftigungsverhältnissen, die sehr viel prekärer<br />
sind als das, was im sozialen Bereich immer noch üblich<br />
ist.<br />
TN: Zurück zur Frage des Ausbaus der Krippenbetreuung.<br />
Was ist die Haupt- und was ist die Nebenseite? Erst einmal<br />
ist es doch eine tolle Sache, dass, bezogen auf die Bundesrepublik,<br />
ein Ausbau in so gewaltigen Dimensionen (sind<br />
es nicht sogar 750.000 Plätze und nicht nur die 500.000,<br />
von denen hier immer die Rede war) ins Auge gefasst wird.<br />
Und zur Frage der Kürzungen: diese letzten Jahre, in denen<br />
die Förderung immer mehr heruntergefahren wurde,<br />
haben leider auch einen sehr positiven Effekt gehabt. Sie<br />
haben uns gezwungen, kreativer und flexibler mit der Situation<br />
umzugehen. Das ist ein erst mal unangenehmer Nebeneffekt,<br />
den ich aber eigentlich ganz toll finde. Wieder<br />
zurück zur Krippenbetreuung: was ist denn nun eigentlich<br />
das Fazit, ist die Krippenbetreuung unter dem Strich eher<br />
positiv oder eher negativ zu bewerten?<br />
Petra Sperling: Ich schlage eine differenziertere Betrachtungsweise<br />
vor. Diejenigen, die Projekte planen, haben<br />
eine andere Perspektive als die, die vor Ort anpacken müssen<br />
und den Druck ganz anders erleben. Als Arbeitgeber<br />
muss ich mir die Frage stellen, was mute ich denen zu.<br />
TN: Ich möchte die Fragestellung noch einmal von einer<br />
anderen Seite aus aufrollen. In Berlin hat es die Übertragung<br />
eines Großteils der kommunalen Kindertagesstätten<br />
an Freie Träger gegeben, mit Interessenbekundungsverfahren<br />
usw. dem vorausgegangen ist, und in solchen<br />
Kommissionen habe auch ich gesessen, dass ermittelt<br />
wurde, was kostet überhaupt ein Kindergartenplatz in<br />
Berlin, was müssen wir da für Forderungen stellen. Jahrzehntelang<br />
hatte in Berlin niemand sagen können, was<br />
so ein Kindergartenplatz kosten soll. Und dann haben<br />
wir ausgehandelt, dass die Freien Träger im Großen und<br />
Ganzen die Kosten erstattet bekommen sollten, die ein<br />
Kita-Platz in öffentlicher Trägerschaft kostet. Danach<br />
gab es dann die Ausschreibung zur Übertragung von 60<br />
Prozent der Einrichtungen in freie Trägerschaft. Es gab<br />
dann eine Menge Gegenwehr, nicht zuletzt von den Gewerkschaften,<br />
die vor allem wegen angeblich schlechterer<br />
Arbeitsbedingungen bei den Freien Trägern den<br />
Mitarbeiter/innen im öffentlichen Dienst Angst machen<br />
wollten. Wir haben demgegenüber mit den Inhalten und<br />
Rahmenbedingungen der Arbeit vor Ort geworben und<br />
dabei auch viele Mitarbeiter/innen überzeugen können.<br />
Heute kann man feststellen, dass bestimmt 95% aller<br />
Mitarbeiter/innen, die zum Freien Träger gewechselt<br />
sind, froh und glücklich<br />
mit ihrer Entscheidung<br />
sind. Das liegt vor allen<br />
an den veränderten Rahmenbedingungen<br />
und den<br />
Möglichkeiten, auf erkannte<br />
Bedarfslagen vor Ort,<br />
insbesondere auch von<br />
Eltern, angemessen und<br />
flexibel zu reagieren. Ich<br />
bin optimistisch, dass sich<br />
die Dinge, auch das, was<br />
Ursula von der Leyen angeschoben<br />
hat, weiter positiv<br />
entwickeln werden. Es geht<br />
schließlich um etwas, für<br />
das es aus Elternsicht – und insbesondere aus der Sicht<br />
von Frauen, die Familie und Beruf vereinbaren wollen,<br />
einen Bedarf gibt. Es ist doch toll, wenn wir Frauen endlich<br />
mehr Möglichkeiten bekommen, einen Beruf auszuüben,<br />
zu studieren, uns fortzubilden usw. usw. Das ist<br />
doch toll!<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 109
110<br />
Workshop Nachttöpfe und Menschwerdung<br />
TN: Es hat doch wenig Sinn, die Sache nur Schwarz oder<br />
Weiß zu sehen. Es geht doch vielmehr darum, sich auf den<br />
Boden der Tatsachen zu stellen und dann zu fragen, wie<br />
man die Krippenerziehung am Besten gestaltet.<br />
TN: Das ist mir zu unentschieden. Sind Sie nun dafür oder<br />
dagegen?<br />
TN: Für mich war die wichtigste Erkenntnis in dieser Diskussion,<br />
dass es schon immer Fremdbetreuung gegeben<br />
hat. Die Frage, ob ja oder nein, ist sinnlos. Es geht nur<br />
um das Wie. Welche Ansprüche, Wünsche und Phantasien<br />
haben wir dazu.<br />
Nachttöpfe und Menschwerdung<br />
Petra Sperling: Ich möchte zum Schluss noch einmal eine<br />
Frage an Sie richten, Frau Völker. Sie haben bei Ihren Interviews<br />
nicht nur darauf geachtet, was gesagt wurde, sondern<br />
auch Wert darauf gelegt, die Stimmung zu ergreifen<br />
und die Situation wie eine Szene zu erleben, damit auch<br />
das wahrgenommen wird, was nicht gesagt werden kann.<br />
Was haben Sie denn heute hier in diesem Sinne registriert?<br />
Dagmar Voelker: In dieser Gruppe ging es nicht nur um<br />
die Diskussion von Fachfragen, sondern auch um sehr persönliche<br />
eigene Erfahrungen. Es ist mir aufgefallen, dass<br />
es sich nicht zu einer Ost-West-Kontroverse entwickelt hat<br />
und dass Sie wieder zu Ihrem eigentlichen Thema gefunden<br />
haben, zu der Frage: was machen wir konkret in unserer<br />
Praxis.
Das Buch zum Workshop<br />
Mit Beiträgen von<br />
Agathe Israel, Ingrid Kerz-Rühling, Luise Köhler,<br />
Irene Misselwitz, Peter Vogelsänger, Dagmar Völker<br />
Krippen-Kinder in der DDR<br />
Frühe Kindheitserfahrungen und ihre Folgen für die<br />
Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit<br />
300 S., Format 20,7x 14,5 cm, Pb.,<br />
Preis: 24,90/sFr 44,-, ISBN: 978-3-86099-869-4<br />
• In ganz Deutschland wird eine Krippendiskussion<br />
geführt: Wie müssen Krippen aussehen, damit sich<br />
die Kleinkinder körperlich und psychisch gesund entwickeln,<br />
wenn es jetzt zur Regel wird, Kinder ab dem<br />
zweiten Lebensjahr außerfamiliär zu betreuen?<br />
• Das Buch vermittelt denjenigen, die in der Frühbetreuung<br />
arbeiten oder ihre Kinder in eine Krippe geben<br />
wollen, wertvolle Erkenntnisse anhand der Erfahrungen<br />
aus der DDR.<br />
• Krippen-Kinder in der DDR geht den Auswirkungen<br />
der frühen Krippenbetreuung nach. Dabei wird besonders<br />
der körperlich-seelischen Gesundheit und der Persönlichkeitsentwicklung<br />
Aufmerksamkeit geschenkt.<br />
Der spätere Einfl uss auf die eigene Elternschaft durch<br />
die Verschränkung von familiären, institutionellen und<br />
subjektiven Faktoren wird hervorgehoben.<br />
• Die Befunde dieser qualitativen Untersuchungen stellen<br />
die Autorinnen und der Autor in den Kontext aktueller<br />
entwicklungspsychologischer Erkenntnisse und<br />
psychoanalytischer Konzepte. Besonderer Wert wird<br />
auf den Bezug zu der aktuellen Betreuungsdebatte von<br />
Kleinkindern gelegt. Die Ergebnisse betonen die Qualität<br />
der Beziehungen in den Einrichtungen und messen<br />
der Bewältigung von Entwicklungsschritten der Kinder<br />
eine zentrale Bedeutung bei.<br />
Brandes & Apsel Verlag<br />
Scheidswaldstr. 22<br />
60385 Frankfurt am Main<br />
Tel. 069/272 995 17 11 Fax 069/272 995 17 10<br />
E-Mail: presse@brandes-apsel-verlag.de<br />
www.brandes-apsel-verlag.de<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 111
112<br />
Workshop<br />
Heute ratlos, morgen super?<br />
Das weite Feld der Erziehungsratgeber – Trends und Moden<br />
Kind isst nicht richtig. Das sind zum Beispiel die Themen.<br />
Die Doku-Soap habe ich ungefähr 1 ½ Jahre lang<br />
gemacht.<br />
TN: Mich interessiert das total, weil ich muss gestehen,<br />
dass ich unendlich viele Vorbehalte, ungefähr 500 oder<br />
so, habe. Wie kommt die Familie dazu? Ich finde, das hat<br />
immer was Exhibitionistisches. Was hast Du in den Familien<br />
erlebt?<br />
Inputs:<br />
Aicha Katjivena (Erzieherin, Berlin)<br />
„Als Supermama unterwegs -<br />
Erziehungstipps aus dem Fernsehapparat“<br />
Charlotte Weidenhammer<br />
(Menschenskinder, Darmstadt)<br />
und Paula Diederichs (Schreibabyambulanz)<br />
„Identität und Authentizität in der Erziehung“<br />
Moderation:<br />
Reinhilde Godulla<br />
Reinhilde Godulla: Wie hat es sich ergeben, dass Du von<br />
der Jugendarbeit bei Outreach zur Supermama wurdest?<br />
Aicha Katjivena: Ich habe gerne bei Outreach gearbeitet.<br />
Dann wurden uns ganz spontan die Finanzen gestrichen,<br />
somit war das Projekt vorbei und ich bin arbeitslos geworden.<br />
Dann wurde ich angesprochen, ob ich mir vorstellen<br />
könnte, so etwas zu machen, und sollte zu einem Interview<br />
gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Innerhalb<br />
von drei Wochen hat es sich dann ergeben, dass ich bei<br />
der ersten Familie saß.<br />
Supermama ist ein Fernsehformat, eine Doku-Soap. Das<br />
soll ein Erziehungsratgeber sein, der bei alltäglichen Problemen,<br />
die die Familien haben, helfen soll. Mein Kind<br />
putzt keine Zähne. Mein Kind geht nicht ins Bett. Mein<br />
Aicha Katjivena: Ich persönlich bin sehr antiautoritär<br />
und liberal erzogen worden. Meine Eltern sind Akademiker,<br />
mein Vater macht selber Filme, allerdings politische<br />
oder dokumentarische Filme. Für mich war es so, dass<br />
ich definitiv zu diesem Job gekommen bin, weil ich in<br />
einer Notlage war, nämlich arbeitslos. Ich brauchte einfach<br />
eine Arbeit. Die habe ich in dem Moment gekriegt,<br />
ich meine, jeder ist ein bisschen käuflich. Ich habe mich<br />
auf etwas eingelassen, von dem ich nicht wusste, was<br />
es ist. Ich hatte gar keine Vorstellung, was es bedeutet,<br />
soziale Unterstützung unter den Rahmenbedingungen<br />
einer Doku-Soap zu machen und noch bei einem Privatsender<br />
zu arbeiten.<br />
Die Erfahrungen konnte ich dann sammeln. Es ist – wie<br />
das Format schon sagt – eine Doku-Soap, da geht es um<br />
Sensation, es geht um Quoten, das ist ein rein wirtschaftlicher<br />
Geschäftszweig. Es geht nicht um Emotionen, es<br />
geht nicht um den Menschen vor der Kamera, sondern<br />
es geht darum, die Werbepausen zu füllen usw., also ein<br />
sehr gewinnorientiertes Geschäft. Die Menschen, die<br />
vor der Kamera arbeiten, zählen wenig, wir sind Protagonisten<br />
und müssen gut funktionieren. Die Eltern müssen<br />
sich also so schlecht wie möglich verhalten, die Kinder<br />
müssen so laut wie möglich sein, damit die Quote steigt.<br />
Das ist die Wahrheit.<br />
TN: Gibt es da ein Briefing, das jemand sagt, Ihr müsst<br />
heute besonders schlecht benehmen? Oder wird gesagt,<br />
macht mal wie sonst auch?<br />
Aicha Katjivena: Natürlich wird gesagt: Macht das so wie<br />
sonst auch.
TN: Die Kamera tut dann ihr eigenes.<br />
Aicha Katjivena: Ja. Es geht ganz klar darum, gute und<br />
viele laute Bilder zu bekommen, extreme Bilder, um hinterher<br />
zu zeigen, wie es dann super ist.<br />
TN: Wie war denn der Ablauf? Ich dachte, dass die Familien<br />
Schauspieler sein müssen, weil das zwischendrin so<br />
was von peinlich ist für die Familien. Sind das wirklich reale<br />
Familien?<br />
Aicha Katjivena: Das sind reale Familien und auch reale<br />
Situationen, in denen die Familien leben. Ich würde gerne<br />
diese Familie als Beispiel nehmen, weil das einfacher ist.<br />
Bei der Familie ist der Vater relativ groß und ein sehr kräftiger<br />
Typ, so wie er das Kind angefasst hat, das sah eigentlich<br />
schlimmer aus, als es war. Es wirkte sehr extrem, weil<br />
er so groß ist und sie halt so klein. In dieser Situation war<br />
es so, dass der Vater gerade von der Arbeit gekommen ist.<br />
Er wurde direkt von der Mutter mit dieser Situation konfrontiert,<br />
das war bei denen alltäglich so. Der wurde immer<br />
gezwungen, diese Situation zwischen der Mutter und den<br />
Kindern zu klären, und auch immer mit einzugreifen. Nach<br />
einem langen Arbeitstag war er oft sehr gestresst und hat<br />
dann überreagiert.<br />
Ich denke, das sieht man sehr deutlich. Aber da man das<br />
nicht weiß, da sie sehr viel zusammengeschnitten haben,<br />
alleine das Gespräch mit dem Kind dauerte 1 ½ Stunden,<br />
sie haben nur das herausgefiltert, was sie brauchen. Dasselbe<br />
bei dieser Schularbeits-Szene. Dem Kind wurden<br />
vorher Aufgaben gegeben, obwohl es gar keine Schularbeiten<br />
auf hatte, das war auch das, was sie gesagt hat,<br />
nämlich, das sind ja nur so ne Aufgaben. Das ist natürlich<br />
für sie schwierig zu verstehen, dass sie jetzt zusätzlich<br />
noch was machen soll und sich in eine Situation reinfinden<br />
muss, die nicht real ist, sondern die provoziert wurde. Sie<br />
hat natürlich dementsprechend reagiert, weil sie natürlich<br />
keine Lust darauf hatte.<br />
Ich denke, wenn man sich solche Formate anguckt, ist<br />
es wichtig, sich zu überlegen, dass die Leute, die vor der<br />
Kamera stehen, oft nicht wissen, was hinter der Kamera<br />
passiert. Es werden Situationen ganz bewusst provoziert,<br />
um eben Bilder zu bekommen. Vielleicht kann ich noch<br />
dazu sagen, dass sie nicht von mir provoziert wurden, weil<br />
ich ja auch einer von den Idioten bin, die vor der Kamera<br />
standen.<br />
TN: Bist Du da wirklich in die Familie eingezogen?<br />
Aicha Katjivena: Nein. Wir haben natürlich beide da nicht<br />
gewohnt. Man kann da ja auch nicht wohnen, also diese<br />
Familie hier, die hätte den Platz gehabt, weil sie ein<br />
großes Haus hatten, aber die meisten Familien haben<br />
nicht den Platz. Die Familien, die von dem Sender ausgewählt<br />
worden sind, sind natürlich immer sozial schwache<br />
Familien. Das ist ganz klar, weil man für das Fernsehen,<br />
für das Format, mehr reißerische Szenen bekommt, auch<br />
weil die Wohnungen enger sind, wir kommen zu viert in<br />
die Wohnungen rein, die Redakteurin, ein Kameramann,<br />
ein Tonmann und ich, wenn dann noch fünf Kinder da sind<br />
und zwei Eltern dazu, da ist auch viel Stress angesagt und<br />
die stehen auch alle sehr unter Strom, also die Eltern und<br />
auch die Kinder.<br />
Dass es in solchen Situationen eskaliert, das ist ja relativ<br />
normal. Die Eltern wollen natürlich nur das Beste von sich<br />
zeigen, denen ist überhaupt nicht bewusst, was Fernsehen<br />
bedeutet. Was es bedeutet, wenn ein Fernsehsender<br />
von einem was möchte. Ich denke, da werden auch ganz<br />
bewusst Leute geholt, denen das nicht bewusst ist.<br />
TN: Wie kommen die Familien denn dazu? Bewerben die<br />
sich?<br />
Aicha Katjivena: Die ersten Familien werden durch Zeitschrifteninserate<br />
gesucht. Sobald diese Sendung ein<br />
bisschen bekannt ist, melden die sich freiwillig, ob man<br />
es glaubt oder nicht, und zwar richtig doll. Nach der zweiten<br />
oder dritten Sendung gab es bis zu 120 Anrufe von<br />
Familien, die da Hilfe wollten. Und davon suchen sie sich<br />
natürlich die besten raus.<br />
TN: Ist bekannt, was mit den Familien danach passiert?<br />
Wenn die ganzen Nachbarn das im Fernsehen sehen. Von<br />
der Sendung Supernanny habe ich gehört, dass es so<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 113
114<br />
Workshop Heute ratlos, morgen super<br />
Heute ratlos, morgen super<br />
weit geht, dass Leute sogar umgezogen sind, weil sie<br />
den Druck nicht mehr aushalten konnten. Insofern habe<br />
ich diese 500 Zweifel von Frau Grass auch.<br />
Aicha Katjivena: Also bei dieser Familie hier, für die war<br />
das sehr gut, weil die Nachbarn immer nicht verstanden<br />
haben, was bei denen los ist. Also dieses Schreien war<br />
bei denen tagtäglich so. Vor der Sendung wurden die von<br />
den Nachbarn gemieden, die hatten sich was weiß ich vorgestellt,<br />
was die da drin machen mit denen. Durch diese<br />
Sendung bekamen sie aber einen Einblick und konnten<br />
sehen, was da wirklich los ist. In diesem Fall hat es der<br />
Familie geholfen.<br />
Ich habe auch noch E-Mail-Kontakt mit dieser Familie ganz<br />
besonders, weil das meine dritte Sendung war und wir uns<br />
in dieser Drehphase sehr lange kannten. Da habe ich auch<br />
gelernt oder gemerkt, dass ich von mir auch ein Stück geben<br />
muss, um etwas zu bekommen. Und das die Familien<br />
ausgesucht sind, das hat auch noch eine Weile gedauert,<br />
bis ich das gemerkt habe.<br />
TN: Melden sich die Familien, weil sie wirklich Hilfe wollen<br />
oder weil sie Geld dafür kriegen?<br />
Aicha Katjivena: Ich denke, beides spielt eine Rolle.<br />
Natürlich ist das Geld eine der Hauptmotivationen, aber<br />
auch, weil die wirklich davon überzeugt sind oder waren,<br />
dass sie Hilfe bekommen, und zwar schnelle Hilfe.<br />
In den ersten vier Sendungen haben die Eltern 1.500 Euro<br />
bekommen. Als die Sendung bekannt war, wurde es weniger,<br />
dann waren es unter 1.000 Euro, also 800 oder so.<br />
TN: Wie läuft das ab? Gibt es ein Vorgespräch? Bist Du<br />
dann schon dabei?<br />
Aicha Katjivena: Nein. Es gibt irgendwelche Casting-Teams,<br />
die direkt zu den Familien fahren. Vorab werden die Familien<br />
befragt, in welchen Situationen sie Probleme haben. Dann<br />
kommen die Casting-Teams und filmen die Situation, sprechen<br />
mit den Eltern. Das sind sozusagen die Vorstellungsfilme.<br />
Das ist dann auch das, was man manchmal an Anfang<br />
von den Familien sieht, welche Probleme da vorhanden sind.<br />
Diese Castingaufnahmen wurden uns gezeigt, wir waren<br />
ja zwei Supermamas, damit wir uns vorab ein Bild über<br />
die Familien machen konnten. Ich habe mir diese Bänder<br />
vielleicht für die ersten fünf Sendungen angeguckt, danach<br />
habe ich das gelassen, weil die Problematiken, die<br />
die Eltern zeigen wollen, sind ganz andere, als die, die sie<br />
wirklich haben.<br />
Wenn ich mir diese Aufnahmen vorher angeguckt habe,<br />
war ich immer sehr fokussiert auf das dargestellte Problem,<br />
nicht auf das, was wirklich in der Familie los ist. Deswegen<br />
habe ich mir das ziemlich schnell abgewöhnt.<br />
TN: Hattest Du das Gefühl, dass Du den Leuten helfen<br />
konntest?<br />
Aicha Katjivena: Hm, das ist ein ambivalentes Gefühl.<br />
Ich würde auch zum gleichen Teil Nein sagen,<br />
weil ich glaube, dass man nicht innerhalb von sechs<br />
Tagen großartig was verändern kann. Man kann vielleicht<br />
einen Gedankenanstoß geben, aber mehr kann<br />
man nicht machen. Mir persönlich war es immer ganz<br />
wichtig, den Eltern weiterführende Hilfe zu besorgen<br />
bzw. ihnen Adressen rauszusuchen, wo sie nach dem<br />
Dreh hingehen können. Das wurde am Anfang vom<br />
Fernsehsender nicht so gemacht, aber ich habe darauf<br />
bestanden, weil ich der Meinung bin, dass man nicht<br />
irgendwas beginnen kann und die Leute einfach damit<br />
stehen lassen kann.<br />
Während dieser 1 ½ Jahre hatte ich auch ein Arbeitstelefon,<br />
da konnten mich die Familien auch privat anrufen.<br />
Ich habe ja für die gearbeitet, das war in dem Bereich inclusive<br />
und das war auch mein persönlicher Wunsch. Ich<br />
dachte auch, vielleicht ist das noch von mir aus so eine<br />
Art Wiedergutmachung für diese Schmerzen, die sie letztendlich<br />
beim Betrachten ihrer eigenen Sendung vielleicht<br />
erfahren. Also ich hatte eben ein total schlechtes Gewissen,<br />
ganz oft.<br />
Ich habe diese Sendung nicht mit einem großen Selbstbewusst<br />
gedreht und gesagt, oh, ich bin so toll, ich gehe<br />
in die Familie rein, wenn ich da rausgehe, ich tolle Frau,<br />
dann sind die total gut, dann sind die perfekt. Das habe<br />
ich nicht gesagt.
TN: Hast Du mal erlebt, welche Wirkung die Sendung auf<br />
andere Familien hat? Da werden ja in kurzer Zeit einfache<br />
Lösungen angeboten, die zum Nachmachen anregen.<br />
Aicha Katjivena: Ich hatte mal eine Sendung, da ging es<br />
um Schnuller und Flasche. Da habe ich einige Tricks angewandt,<br />
die eine Kindergartengruppe dann auch ausprobiert<br />
hat, da hat die gesamte Gruppe aufgehört, Schnuller<br />
und Flasche zu nehmen. Das ist zum Beispiel was, was ich<br />
als positiv empfinde. Da hat eine Technik, die man angewandt<br />
hat, funktioniert, das ist ein schönes Feedback.<br />
Es ging einfach darum, dass jeder Mensch Phasen hat,<br />
in denen er wächst, und es Veränderungen gibt, also vom<br />
Kleinkind zum Kind, usw. Das Kind war schon drei bzw.<br />
fast vier, es ging darum, ihn aus dieser Kleinkindphase<br />
herauszuheben. Das haben wir mit einem Ritual gemacht,<br />
wo er selber die Nuckel von den Flaschen durchgeschnitten<br />
hat und auch die Schnuller weggeworfen hat. Dafür hat<br />
er eine riesengroße Tasse bekommen, das fand er ganz<br />
toll. Das haben die Eltern einfach nachgemacht mit der<br />
Kindergartengruppe und die Kinder waren dann schnullerund<br />
nuckelfrei. Das ist jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob<br />
das bei allen Familien was bewirkt hat.<br />
Aber die Techniken, die man anwendet, die kennt jeder,<br />
der mit Kindern arbeitet. Das sind ganz normale Sachen,<br />
die man in seiner Ausbildung lernt oder im Laufe der Jahre<br />
an Erfahrungen sammelt.<br />
TN: Du hast da einfach ein Stück Verantwortung übernommen,<br />
also Du hast Dich auf Mist eingelassen und das Beste<br />
draus gemacht.<br />
Aicha Katjivena: Genau.<br />
Paula Diederichs: So würde ich das sehen. Ich finde es<br />
erst mal gut, dass Du das sagst. Ich fände es gut, wenn<br />
wir wirklich mal darüber jetzt reden wollen, weil ich habe<br />
in den letzten 10 Jahren mindestens 20 Fernsehauftritte<br />
gehabt, Schrei-Babys ist ja das Thema Nummer 1, und vor<br />
allen Dingen mit den Gewaltübergriffen. Die Sender rufen<br />
dann an wir brauchen unbedingt eine Schrei-Baby-Familie,<br />
bitte liefern Sie uns die. Dann wird ausgehandelt, was<br />
kannst du machen. Letzte Woche war ich auf einem Kongress<br />
in Österreich. Da gab es eine Diskussion, wo ganz<br />
viele Leitungskräfte<br />
aus den sozialen<br />
Dienstleistungsbranchen<br />
waren,<br />
mit dem Thema:<br />
Soziale Arbeit und<br />
Fernsehen, wie<br />
können die zusammenkommen?<br />
Es<br />
sprach auch der<br />
Journalist, der mit<br />
dieser Natascha Kampusch, die jahrelang im Kellerverlies<br />
gehalten wurde, ein Exklusiv-Interview gemacht hat. Er hat<br />
berichtet, wie die Heranführung an die Presse ausgehandelt<br />
wurde. Das wurde sehr vorsichtig gemacht. Sie hatte<br />
einen Sozialarbeiter dabei, um alles abzusprechen.<br />
Die Presse ist geil, das ist ganz wichtig. Als Menschen, die<br />
mit Menschen arbeiten, müssen wir sehen, wie machen<br />
die das nur? Bei Dir finde ich gut, auch wenn Du nicht<br />
wusstest, worauf Du Dich eingelassen hast, hast Du noch<br />
sehr viel Gutes draus machen können.<br />
Das habe ich auch mit der Zeit gelernt, den Journalisten<br />
ganz klar Grenzen zu setzen. Passen Sie mal auf, unter<br />
den und den Bedingungen bin ich bereit, ansonsten<br />
nicht. Oder eben Kohle rüber, das ist irgendeine Spende.<br />
Die kommen an und machen Druck, wieso, Sie haben<br />
doch was davon. Aber wir brauchen keine Werbung,<br />
darum geht es nicht. Das ist eine Arbeit, in erster Linie<br />
bin ich in der Schweigepflicht mit den Eltern, die sind<br />
mir anvertraut. Ich mache das aus der Retrospektive,<br />
ich mache gestellte Szenen, und die Eltern werden auch<br />
nicht alles vor der Kamera sagen. Ich bin wie ein Schutz<br />
für die Eltern vor der Presse. Dann können wir rausgehen<br />
und uns kümmern, dass die Nachbarschaftsheime<br />
genannt werden, dass die Spender genannt sind und<br />
solche Sachen, weil wir da schon Überraschungen erlebt<br />
haben.<br />
Das ist ein Plädoyer dafür, vorsichtig damit umzugehen,<br />
ganz klar zu sagen, was wir wollen von denen, und dann<br />
ins Geschäft zu kommen, weil filmen tun die in jedem Fall,<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 115
116<br />
Workshop Heute ratlos, morgen super<br />
Heute ratlos, morgen super<br />
sie gehen dann einfach auf die Straße und holen sich die<br />
welche und dann werden sie verhökert. Wir können ein<br />
bisschen dazu beitragen, dass es eine seriösere Geschichte<br />
wird.<br />
Uns war es wichtig, diese ganze Symptomatik in die Presse<br />
zu bringen, also dass es diese Schrei-Babys gibt, weil das<br />
Alltag in Deutschland ist. Das gibt es nicht nur in bestimmten<br />
Schichten.<br />
Aicha Katjivena: Das ist in allen Schichten Alltag. Ich habe<br />
19 Sendungen gedreht und darunter waren auch einige<br />
aus gehobenen Schichten und Akademiker, nicht viele, ich<br />
glaube, es waren nur zwei oder drei Familien, aber die gab<br />
es auch. Die Frau hatte alle Erziehungsratgeber, alles, was<br />
man sich vorstellen kann, die war besser bestückt als Eure<br />
Bibliothek. Das war unglaublich, aber sie hat uns trotzdem<br />
gerufen.<br />
Charlotte Weidenhammer: Das ist ja auch ganz oft die<br />
Erfahrung in den Schrei-Baby-Ambulanzen, dass es nicht<br />
vorrangig Leute aus dem sozial schwachen Milieu sind,<br />
sondern ganz, ganz viel Bildungsbürgertum, Leute, die<br />
wahnsinnig viel gelesen haben, die wahnsinnig hohe Ansprüche<br />
haben. Daran scheitern sie eigentlich. Die es nie<br />
gut genug machen können. Sie meinen, keine Identität als<br />
Eltern zu haben und saugen alles an Informationen auf,<br />
aber sie können damit nicht umgehen, weil sie es nicht<br />
zuordnen können. Also die Informationen gehen rein,<br />
aber sie kommen nicht wieder raus. Für die Kinder ist das<br />
auch schrecklich, weil das, was bei den Eltern rauskommt,<br />
kommt ohne Überzeugung oder ohne emotionale Resonanz,<br />
sondern es ist ein Programm. Ein Programm ist dann<br />
schrecklich, weil es völlig rigide ist und abgespalten, oder<br />
die Kinder machen sich darüber lächerlich, weil man etwas<br />
macht, was man eigentlich gar nicht ausfüllen kann.<br />
TN: Diese Sendungen wie Supernanny oder Supermama sind<br />
natürlich auch ein Ausdruck von großer Hilflosigkeit. Viele Eltern<br />
wissen es einfach nicht, zumal diese Erziehungsratgeber<br />
nicht wirklich weiterhelfen. Mir ist aufgefallen, dass es<br />
in der letzten Zeit auch immer neue Erkenntnisse gibt, auch<br />
wissenschaftliche, die zum Teil sich völlig widersprechen.<br />
Es gibt diese berühmten Zeitfenster, was die Eltern völlig<br />
paralysiert, nun geht es aber, und wenn jetzt nicht, dann<br />
ist alles vorbei. Diese Hilflosigkeit und diese falsche oder<br />
fehlende Identität als Eltern, das ist wirklich das Hauptproblem.<br />
Ich frage mich schon in meiner Rolle als diejenige,<br />
die eben Angebote für Eltern konzipiert, wie kann ich<br />
dem begegnen? Ich möchte eben jetzt nicht diesen Trends<br />
entsprechen, sondern dahin kommen, dass die Eltern für<br />
sich wieder ein Empfinden für ihren Weg kriegen.<br />
TN: Könnte es sein, dass diese schrillen Erziehungsratgeber<br />
für manche Menschen die Wirkung haben, aha, es gibt<br />
ja möglicherweise da Hilfe für mich, und motiviert es unter<br />
Umständen dazu, tatsächlich Hilfe in den Beratungsstellen<br />
aufzusuchen? Ist das ein Effekt, den man nachvollziehen<br />
kann?<br />
Aicha Katjivena: Es gab am Anfang, als die Sendung rauskam,<br />
ein großes Aufschreien. Ich wurde auch wirklich diffamiert<br />
von tausenden von Stellen, es gab Briefe, E-Mails,<br />
der Kinderschutz hat sich auch eingeschaltet. Wir hatten<br />
Rückmeldungen von den Jugendamtsstellen, wir haben<br />
viel in Richtung Schweinfurt bzw. Bayern gedreht, die ganz<br />
klar gesagt haben, dass sie viel mehr Anrufe von Leuten<br />
bekommen, die Hilfe suchen.<br />
TN: Das kann ich nur bestätigen, ich arbeite bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle<br />
in Hohenschönhausen-Lichtenberg. Ich<br />
habe als Familienhelferin gearbeitet. Als diese ersten Supernanny-Sendungen<br />
anliefen, haben wir uns als Kolleginnen<br />
erst mal sehr geärgert, weil wir dachten, da wird<br />
den Eltern suggeriert, dass es schnelle Lösungen gibt, aber<br />
die gibt es nicht. Dann haben wir aber festgestellt, dass es<br />
Eltern gab, die sagten, dass sie früher nie eine Familienhilfe<br />
akzeptiert hätten, aber jetzt sehen sie im Fernsehen, da<br />
kommt jemand in die Familie und die helfen wirklich. Das<br />
hatte schon auch einen positiven Effekt.<br />
Es gibt ja mehrere, die Supernanny und die Supermamas,<br />
was mir gefehlt hat, dass man auch vor dem Bildschirm<br />
sagt, wie lange man jetzt tatsächlich miteinander gearbeitet<br />
hat, dass man ein bisschen was erreicht hat, aber<br />
letztendlich müssen die wirklich dranbleiben, sonst wird
es vielleicht wieder wie vorher, und ich gebe jetzt die Anlaufstellen<br />
vor Ort bekannt. Das ist ganz wichtig, dass die<br />
da dranbleiben. Das wäre auch uns wichtig gewesen, dass<br />
die Eltern, mit denen wir arbeiten, das auch hören bzw.<br />
sehen.<br />
Aicha Katjivena: Aber das war auch so. Nur das Problem<br />
war, es gab einen Abspann, da stand, dass es die und die<br />
Beratungsstellen gibt, da können die Leute sich hinwenden.<br />
Das wurde natürlich auch immer wieder mal angesprochen.<br />
Ich wollte auch noch sagen, dass wir in den Familien<br />
100 Stunden gedreht haben. Das muss man sich<br />
einfach vorstellen, in 6 Tagen bis zu 100 Stunden drehen,<br />
das sind dann einfach locker 20-Stunden-Tage. Da kann<br />
man sich vorstellen, dass die Leute total angespannt sind,<br />
man selber auch. Ich habe zum Teil nur zwei oder drei<br />
Stunden geschlafen, um am nächsten Tag wieder in die<br />
Familie zu gehen, wieder 16 Stunden durchzuhalten. Das<br />
ist definitiv zu viel. Das geht gar nicht.<br />
Zum Beispiel diese Elterngespräche, im Fernsehen wird<br />
gesagt, dass wir zwei Tage beobachten, aber es war<br />
nur ein Tag. Da konnte man sehen, dass die Eltern natürlich<br />
extrem unter Druck waren, ich komme da rein,<br />
gucke mir 5 Stunden an, was die machen, dann setze<br />
ich mich hin und sage: Also ich habe gesehen … Das ist<br />
ein totales Problem, weil ich hatte selber extreme Probleme,<br />
mich da so reinzuhängen, weil ich selber Mutter<br />
bin und ganz genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn<br />
mir einer sagen würde, mein Sohn ist jetzt so und so,<br />
ich wäre der Person ins Genick gesprungen. Da hatte<br />
ich auch richtige Probleme und auch Ängste, den Leuten<br />
zu begegnen. Mein Kameramann hat mich gehasst,<br />
weil die Elterngespräche haben bei mir drei Stunden<br />
gedauert, weil ich einfach nicht in der Lage war, mich<br />
hinzusetzen und meine Beobachtungen aufzuzählen<br />
und zu beurteilen. Ich habe immer versucht, so freundlich<br />
wie möglich das anzubringen. Am Ende von diesen<br />
urlangen Gesprächen, wo die schon teilweise gar nicht<br />
mehr wussten, was sie alles erzählt haben, habe ich alles<br />
kompakt wiederholt, dann allerdings auch mit härteren<br />
Worten, was ich in dem Gespräch selbst gar nicht<br />
gemacht habe.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 117
118<br />
Workshop Heute ratlos, morgen super<br />
Heute ratlos, morgen super<br />
Das muss man einfach auch mal verstehen. Mir haben<br />
die Eltern ganz oft extrem Leid getan. Ich mir selber<br />
auch, weil es einfach Situationen und Zustände gab, wo<br />
man dann auch<br />
nicht mehr weiß,<br />
wie man damit<br />
umgehen soll.<br />
Auch ich wurde ja<br />
ausgespielt. Wenn<br />
man reinkommt,<br />
verhalten sich die<br />
Eltern erst mal<br />
ganz anders als<br />
sie eigentlich sind,<br />
sie wollen sich so gut darstellen wie möglich. Wenn das<br />
der Redakteurin zu lange gedauert hat, dann hat sie provoziert.<br />
Solche Situationen sind ganz oft passiert.<br />
Ich habe auch eine Weile gebraucht, um zu verstehen,<br />
dass ich die Macht habe zu entscheiden, was als Nächstes<br />
in dem Film passiert. Das war mir wirklich nicht bewusst.<br />
Ich dachte, was passiert jetzt alles mit mir, was<br />
soll ich jetzt tun. Ich habe wirklich eine Weile gebraucht,<br />
um zu verstehen, dass, wenn ich etwas nicht richtig finde,<br />
dann können die das auch nicht machen, weil sie<br />
brauchen mich ja, um diese Sendung zu beenden. Das<br />
hat wirklich bestimmt 5 Sendungen gedauert, bis ich gemerkt<br />
habe, wenn ich mich weigere, dann können die<br />
nichts machen.<br />
Das habe ich dann auch schamlos ausgenutzt. Es gab<br />
mal die Situation mit einem Jungen, 10 Jahre, der ist total<br />
zusammengebrochen. Da kam das Kamerateam rein,<br />
denen habe ich die Tür ins Gesicht gedrückt und habe sie<br />
rausgeschmissen. Es gab Eltern, die mir intimste Details<br />
erzählt haben. Da ich überhaupt nicht technisch bewandert<br />
war, habe ich nicht geschnallt, dass ich noch verkabelt<br />
war, die Eltern auch. Sie baten um ein Gespräch<br />
im Nebenzimmer, um mit mir was zu besprechen. Dann<br />
haben sie oft die Tür gefilmt und das Gespräch aufgenommen.<br />
Das kriegt man ja nicht mit, gerade wenn man<br />
die Sendung dann nicht sieht. Ich hatte mir ganz selten<br />
diese Sendung selber angeguckt, also habe ich gar<br />
nicht gewusst, was die da alles gemacht haben. Das<br />
hat mir aber eine Freundin erzählt, ich hatte mir eine<br />
Kopie besorgt. Aber da war es bei mir auch vorbei.<br />
Ich habe dann meine Sendungen auch abgedreht – und<br />
das war’s. Ich wurde vor drei Wochen von RTL2 noch mal<br />
angerufen und gefragt, ob ich das noch mal machen würde.<br />
Ich konnte ganz klar Nein sagen. Ich wurde auch mit<br />
Geld gelockt – und ich konnte immer noch Nein sagen.<br />
Für mich war es wichtig, mich da abzugrenzen und irgendwann<br />
zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter.<br />
Das war eigentlich ein ganz tolles Gefühl. Auch mal zu<br />
sehen, es geht einfach gar nicht ohne mich.<br />
TN: Die haben jetzt niemanden mehr?<br />
Aicha Katjivena: Nein. Sie machen die Sendung nicht<br />
mehr, weil nach 19 Sendungen ist einfach alles, was man<br />
sich so vorstellen kann, einfach ausgelutscht. Du hast<br />
fast alles gemacht, was es so an alltäglichen Erziehungsproblemen<br />
gibt. Denn der Unterschied zwischen der Supernanny<br />
und den Supermamas ist ja, dass wir zwei wirklich<br />
alltägliche Probleme präsentiert haben, während die<br />
Supernanny in Familien dreht, wo die Konflikte zum Teil<br />
schon so extrem sind, die Kinder auch schon in Therapien<br />
sind, die arbeitet mit Ritalin, also das sind einfach ganz<br />
andere Konditionen. Die Kinder kriegen Ritalin, auch während<br />
der Drehs, also sorry, da werden die Kinder zum Arzt<br />
geschleppt und Rezepte werden verschrieben usw. Das ist<br />
einfach Fernsehen.<br />
Ich finde es wichtig, dass man sieht, dass es auch Unterschiede<br />
gibt, dass die Formate unterschiedlich sind. Wir<br />
hatten zum Beispiel, Trash-Fernsehen, einen Ganztagsdreh<br />
nach dem anderen, während Frau Saalfrank viel<br />
mehr Zeit für die einzelnen Sendungen hatte. Da konnte<br />
es auch einmal entspannt zugehen. Auch der technische<br />
Hintergrund ist anders. Es gibt bis zu 5 Kamerateams, die<br />
Kameras werden überall festgelegt, teilweise werden die<br />
Wohnungen vorher renoviert, damit die alle chic aussehen.<br />
Dann geht man da mal hoch, dann erzählt sie denen<br />
was, dann geht sie wieder runter, der Rest wird dann ohne<br />
sie gedreht. So. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, sie hat<br />
es wesentlich entspannter und kann sich natürlich auch<br />
viel besser vorbereiten.
Ich hatte einen extremen Fall: ein Kind von 7 Jahren, das<br />
einfach nicht einschlafen wollte. Ich war nachts um 1 Uhr<br />
immer noch in der Familie, weil es nicht klappte. Da bin<br />
ich an den Rand meiner Möglichkeiten und meiner Nerven<br />
gekommen und total ausgerastet. In dieser Sendung<br />
habe ich dann harsch gesagt: Du bringst jetzt dein Kind<br />
in die Badewanne und dann schläft es da. Häh? Ich hatte<br />
eine Perücke auf, die war schief, ich hatte ein Hemd<br />
an, das hing wirklich schon, die Hose rutschte, während<br />
ich dieses Kind am Arm in sein Zimmer schleifte, weil<br />
ich nicht mehr konnte. In solche Situationen kommt man<br />
dann. Mir hat das Kind einfach total Leid getan, aber ich<br />
konnte einfach nicht mehr. Ich hatte nicht die Kraft und<br />
auch nicht die Möglichkeiten, diese Redakteurin und<br />
das ganze Team aus dieser Wohnung rauszubringen,<br />
weil wenn die nicht gehen, was soll ich machen, ich sitze<br />
irgendwo in der Walachei und das Hotel ist aber 20 oder<br />
50 Kilometer entfernt.<br />
TN: Ich finde das sehr spannend, weil das ist ja eine Eltern-Symptomatik,<br />
die Du dort erlebt hast. Du bist an<br />
Deine Grenzen gekommen, hast total die Kontrolle verloren<br />
und hast reagiert, wie Du es eigentlich nie tun würdest.<br />
Das ist ja ein Schritt zurück, aber provoziert durch<br />
die Situation.<br />
Aicha Katjivena: Ich war auch ausgeliefert in dieser<br />
Situation, weil ich immer unruhiger wurde, dieses Kind<br />
hampelte und nölte. Es ging darum, dass dieses Kind<br />
nicht mehr bei der Mutter im Bett schlafen sollte, die<br />
haben zusammen in einem Bett geschlafen, unter einer<br />
Decke und mit einem Kissen. Das Kind hatte aber ein<br />
eigenes Zimmer und sollte nun dort schlafen. Und das<br />
Kind schlief nicht. Es sollte dann so tun, die Augen flackerten,<br />
das funktionierte gar nicht. Das Ende vom Lied<br />
war, dass sich das Kind in die Wanne gelegt hat, weil<br />
ich gesagt habe, dass ich nicht mehr kann. Dann sind<br />
wir aus dieser Familie rausgegangen, am nächsten Tag<br />
habe ich mich geweigert, da wieder hinzugehen. Und ich<br />
habe es auch nicht gemacht. Die mussten dann mit den<br />
Schnipseln, die wir hatten, den Film zu Ende bringen.<br />
Da war ich kurz davor aufzuhören. Aber dann habe ich<br />
auch wieder gemerkt, ich habe mir das vorgenommen<br />
und wer weiß, wer in Zukunft meinen Platz einnehmen<br />
würde. Wie Du schon gesagt hast, da habe ich eine Verantwortung<br />
übernommen, die ich eigentlich nicht tragen<br />
kann. Ich habe mich aber trotzdem bemüht, mit meinem<br />
Anspruch und mit dem, was ich gelernt habe, umzugehen,<br />
das so umzusetzen, dass ich damit auch leben kann.<br />
Das war für mich das Wichtigste, dass ich mich selber im<br />
Spiegel noch angucken kann nach diesen Sachen, okay,<br />
das war vielleicht nicht so toll, aber hey, es war okay, damit<br />
kann ich leben. Das war wahnsinnig schwer, einfach<br />
aus diesem Druck und dieser Verantwortung.<br />
Ich habe wahnsinnig viel Feedback von der schwarzen<br />
Community bekommen, was noch mal einen ganz anderen<br />
Aspekt aufwirft, nämlich dass die gesagt haben, hey,<br />
eine schwarze Frau im deutschen Fernsehen, wir haben<br />
Jahrhunderte lang den weißen Kindern den Hintern abgewischt<br />
und kein Geld dafür gekriegt. Und in Deutschland,<br />
was einfach weiß ist, als schwarze Frau im Fernsehen<br />
so was machen zu können, das hat die total gefreut,<br />
weshalb ich wahnsinnig viel Feedback gekriegt habe.<br />
Diese Sachen haben mich zum Teil auch gestärkt, damit<br />
ich in der Lage war, die nächste Sendung zu drehen. Ich<br />
hatte dadurch im Hinterkopf nicht nur meine Scham, das<br />
ich was tue, was eigentlich total schrecklich ist, wo ich<br />
auch nicht wirklich dazu stehe oder das nicht gut finde,<br />
sondern auch den Ansporn, das trotzdem zu tun und so<br />
gut wie möglich zu machen.<br />
TN: Sie haben auch noch ein Buch herausgegeben, einen<br />
Erziehungsratgeber.<br />
Aicha Katjivena: Wir haben da gar nichts geschrieben,<br />
sondern da gab es natürlich einen Ghostwriter, das ist ja<br />
klar. Da geht es auch wieder nur um Geld. Als ich am Anfang<br />
gehört habe, dass es im Rowohlt-Verlag erscheint,<br />
dachte ich, wow, seriös. Dann kam auch der Schreiber,<br />
der sehr bekannt ist, Bernhard Schön heißt er, er<br />
schreibt ganz viele Erziehungsratgeber, Kinderbücher<br />
usw., und hat über mehrere Tage, ganz lange, insgesamt<br />
bestimmt zwei Monate, mit uns geredet, über unsere Erziehungsvorstellungen<br />
usw. Das wurde dann in diesem<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 119
120<br />
Workshop Heute ratlos, morgen super<br />
Heute ratlos, morgen super<br />
Buch umgesetzt. Nur sollten wir erst Geld kriegen, wenn<br />
die Auflage von 70.000 Exemplaren verkauft ist, was natürlich<br />
nie passiert ist, deswegen haben wir auch kein<br />
Cent davon gesehen.<br />
TN: Das ist jetzt schon überall in der Grabbelkiste.<br />
Aicha Katjivena: Eigentlich war es für die Tonne.<br />
Reinhilde Godulla: Es gab ja ganz viel Kritik, in einem<br />
<strong>Rundbrief</strong>-Artikel sind einige Zitate aus Web-Blogs in diesem<br />
Zusammenhang abgedruckt worden. Aber das haben<br />
ja auch sehr viele Leute geguckt, das waren über 4 Millionen<br />
bei jeder Sendung. Die haben das ja nicht alle aus<br />
Schadenfreude geguckt.<br />
Aicha Katjivena: Ich habe niemandem erzählt, dass ich diese<br />
Sendung drehe. Mein Vater, der politische Filme dreht,<br />
und meine Mutter, die für die ZEIT schreibt, da hatte ich<br />
ganz große Probleme, denen das zu erzählen. Ganz lange<br />
habe ich das also gar keinem erzählt. Die erste Sendung<br />
kam am 20. September 2004 raus. An dem Tag habe ich<br />
dann meine Mutter angerufen, hm, ich habe da, tut mir ja<br />
so Leid, ich weiß ja, Dein Anspruch. Die hat gesagt, bist<br />
du blöd, finde ich total gut, mach doch, super. Also die hat<br />
ganz anders reagiert, als ich dachte, und ich musste auch<br />
mit meinen eigenen Schamgefühlen umgehen.<br />
TN: Diese Kinderschutzgeschichten waren sehr negativ.<br />
Leider sieht man so etwas nicht nur im Fernsehen, wir haben<br />
mehrere solche Fälle im Bekanntenkreis. Ich denke,<br />
es ist ja wahrscheinlich auch so. Von daher ist es auch<br />
positiv zu sehen, man kann die Leute darüber erreichen,<br />
so platt und reißerisch dieses Medium ist, aber es kann<br />
natürlich auch bewirken, dass sich mehr Leute trauen, bei<br />
Beratungsstellen anzurufen und nach Hilfe zu fragen.<br />
TN: Ich glaube schon, dass es tatsächlich Leute gibt, für<br />
die das ein Anstoß ist, selber was zu machen, obwohl ich<br />
auch glaube, dass die überwiegende Mehrzahl sagen<br />
wird, na, so schlimm ist es bei uns ja noch nicht, das ist<br />
ja vergleichsweise harmlos bei uns. Was ich aber – nach<br />
wie vor – unglaublich problematisch finde, das ist die Tatsache,<br />
dass diese Familien vor der Kamera sich gar nicht<br />
bewusst darüber sind, was da läuft. Da wird ihre Not total<br />
ausgenutzt. Ich frage mich: Was passiert mit diesen Familien<br />
hinterher?<br />
TN: Das ging mir auch so. Bis heute Morgen dachte ich, es<br />
ist nicht wahr, das sind Schauspieler, keine echte Familie<br />
würde sich dem aussetzen.<br />
TN: Auch wie sich die Rolle des Kindes in einer Klasse<br />
dann verändert, wenn das alle gesehen haben.<br />
Aicha Katjivena: Das war das größte Problem. Deswegen<br />
habe ich bei schwierigen Situationen die Tür zugehauen,<br />
den Kameramann rausgeschoben, weil das an<br />
die Grenzen geht. Viele Kinder wollten gar nicht gedreht<br />
werden, aber wurden gar nicht gefragt. Die meisten Familien<br />
wurden von den Müttern angemeldet. Bei einer einzigen<br />
Familie hatte der Vater angerufen, aber bei allen<br />
anderen wollten die Mütter die Hilfe haben. Ganz viele<br />
von denen wollten auch ganz konkret Hilfe von mir, weil<br />
sie sich von mir etwas Bestimmtes erhofft haben. Viele<br />
haben sich auch gemeldet und gesagt, sie würden lieber<br />
zur Supermama Miriam gehen oder zu mir. Sie sehen die<br />
Sendungen, die eine Supermama liegt einem, die andere<br />
nicht, und sie erhoffen sich natürlich Hilfe.<br />
Das größte Problem innerhalb dieser Familienstrukturen<br />
waren ganz oft die Männer, dermaßen untergebuttert waren.<br />
Ich habe denen ganz oft gesagt Wo hast Du Deine<br />
Eier? Weil die überhaupt nicht in der Lage waren, sich<br />
selber zu spüren, also auch die Identität als Mann zu haben,<br />
die Rolle innerhalb dieser Familie auch einnehmen<br />
zu können. Das ist vielen total schwer gefallen. Die sind<br />
einfach arbeiten gegangen, weil alles andere zu Hause<br />
sie so belastet, dass sie gesagt haben, da komme ich<br />
halt abends hin, ansonsten bin ich außerhalb und mache<br />
mein Ding.<br />
Ein Vater war dabei, der hat im Schichtdienst bei Daimler<br />
gearbeitet, jeder Mensch weiß, so eine Schicht geht 9<br />
Stunden, also es gibt keine 12-Stunden-Schichten, aber<br />
der war immer 12 Stunden weg. Hinterher habe ich raus-
gekriegt, der geht nachmittags nach der Arbeit erst mal<br />
ins Café, weil zu Hause Stress ist und die Frau sofort was<br />
will. Das war eigentlich bei fast allen Familien so, dass die<br />
Frauen der dominante Part waren.<br />
Bei einem Beispiel war der Mann ein unheimlicher Waschlappen,<br />
wo ich dachte, die Frau hat bestimmt einen Liebhaber.<br />
Da hattest Du einen Tagesplan, dass die Frau jeden<br />
Mittag von 16 bis 17.30 Uhr frei hat, in der Zeit ist er dann<br />
zuständig für die Kinder. Gestern dachte ich, da geht die<br />
bestimmt zu einem Lover. Und das war dann auch so.<br />
TN: Ich sehe natürlich auch ganz stark den Part, was<br />
mit den Männern, die im Fernsehen sind, aber ich sehe<br />
darüber hinaus auch diesen Zeitgeist, in dem wir glauben,<br />
wir könnten die Dinge so schnell lösen. Das hat<br />
ja eine so eine Suggestion, da kommt jemand für ein<br />
paar Tage und dann wird alles gut. Das ist ja auch oft<br />
der Anspruch, den Eltern an die Umwelt oder an sich<br />
selber haben, wenn ich das so mache, dann klappt es.<br />
Das ist für mich wirklich ein Knackpunkt, weil das ist<br />
so ein Streueffekt. Das sind 19 Familien, aber die 4<br />
Millionen Leute, die das sehen, kriegen die Botschaft,<br />
dass man es schnell lösen kann. Eigentlich zeigt ihnen<br />
mal wieder jemand, die können das, ich muss das nur<br />
richtig machen, aber sie können es nicht umsetzen, insofern<br />
ist es eine Wiederholung des Gefühls, dass sie<br />
es nicht geschafft haben, ich habe als Mutter oder Vater<br />
versagt.<br />
Aicha Katjivena: Bei diesen Drehs ist mir auch aufgefallen,<br />
dass es in Deutschland so gut wie keinen kulturellen<br />
Rückhalt gibt. Ich komme aus einer großen Familie. Aber<br />
es geht darum, nach außen zu zeigen, ich bin ganz toll, ich<br />
kann alles, ich bin eine Supermama, meine Familie läuft<br />
rund, bei mir ist alles gesund, ich habe keine Probleme<br />
mit meiner Familie oder meinem Mann, bei mir ist alles<br />
perfekt. Das ist das Wunschdenken. Das ist das Ziel, was<br />
alle erreichen wollen.<br />
Dazwischen, wenn man die Realität sieht, so wie das<br />
Leben läuft, ich habe eben kann Geld, weil wir arbeitslos<br />
sind, ich kann mir das nicht leisten, das hat extrem<br />
große Auswirkungen auf die Familien allgemein. Es gibt<br />
keinen kulturellen Hintergrund und sie haben nichts, woran<br />
sie sich richtig orientieren können. Das habe ich bei<br />
allen Familien erlebt.<br />
TN: Es wird ja suggeriert, dass es eine richtige und eine<br />
falsche Erziehung gibt. Wenn der Vater mit dem Kind alleine<br />
ist, kommt der möglicherweise recht gut damit klar.<br />
Aicha Katjivena: Eigentlich immer, das war kein Problem.<br />
TN: Manchmal ist es auch so, wenn der Vater nicht da<br />
ist und die Mutter alleine ist, dann gelten diese Regeln<br />
auch. Kinder können zweisprachig aufwachsen, Kinder<br />
können sich am Vater orientieren, sie können sich auch<br />
an der Mutter orientieren, aber wenn beide sich auf den<br />
kleinsten gemeinsamen Nenner einigen müssen, dann<br />
geht gar nichts mehr. Meine Hoffnung ist, dass diese Erziehungsberatung<br />
bringt, wenn sich die Eltern nicht reduzieren<br />
müssen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner,<br />
sondern wirklich ihre Autonomie ausleben können, dass<br />
sie authentisch werden, es zu einer wirklich persönlichen<br />
Beziehung zu den Kindern kommt.<br />
Aicha Katjivena: Du redest von Menschen, die miteinander<br />
kommunizieren, die in einer Partnerschaft leben und<br />
miteinander reden. Die Erfahrung, die ich gemacht habe,<br />
da war es genau das Gegenteil. Da haben die Beziehungsprobleme<br />
von den Eltern eine so große Rolle gespielt, das<br />
ist ja immer so, alles hat eine Auswirkung, auch auf die<br />
Kinder. Eigentlich habe ich ja Elternberatung gemacht,<br />
weil die Arbeit mit den Kindern war während dieser Drehs<br />
immer der kleinste Teil. Erst mal musst du ja diese familiären<br />
Probleme aufarbeiten bzw. aufdecken, damit du<br />
überhaupt was machen kannst.<br />
TN: Im Gegenteil. Ich möchte gerne, dass die Eltern an<br />
dieser Stelle nicht kommunizieren, sondern dass sie ein<br />
Stück getrennt sich mit diesem Kind konfrontieren. Dass<br />
die Eltern nicht miteinander kommunizieren können, das<br />
ist ein ganz anderes Thema. Das hat natürlich in der Paarberatung<br />
dann eine hohe Bedeutung, aber nicht unbedingt<br />
in der Kindererziehung.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 121
122<br />
Workshop Heute ratlos, morgen super<br />
Ich gehe soweit und sage, ein Kind braucht keine sich vertragenden<br />
Eltern, sondern ein Kind braucht einen Vater<br />
und eine Mutter. Wenn das beides da ist, dann geht es<br />
einem Kind gut.<br />
Aicha Katjivena: Ich habe Dich auf jeden Fall verstanden.<br />
Aber wenn die Eltern zusammen sind und sich nur streiten<br />
und es permanent Stress gibt, wie soll sich dann das Kind<br />
verhalten? Es liebt beide Eltern, es will beiden Eltern genügen,<br />
es will von beiden Eltern die Aufmerksamkeit, aber<br />
wie kann das Kind das bekommen, wenn die beiden sich<br />
ständig bekriegen? Das ist doch total schwierig. Die tun<br />
ja dann nur so, als ob, miteinander, obwohl es gar nicht<br />
so ist.<br />
Heute ratlos, morgen super<br />
Paula Diederichs: Ich sehe es nicht so, dass die einzelnen<br />
Elternteile autonom sind. Das geht nicht. Es gibt da<br />
ein Bindungskonstrukt. Sie müssen zwar beide auch eine<br />
eigene Beziehung zu den Kindern aufbauen, aber das ist<br />
nicht völlig unabhängig von der des Partners / der Partnerin.<br />
Ich sehe ein großes Problem im Verlust von etwas,<br />
das wir intuitive Elternschaft nennen. Wie gehen Leute<br />
heute an Elternschaft ran? Sie lesen Bücher, am besten<br />
sich widersprechende, Ratgeber oder wissenschaftliche<br />
Abhandlungen. Damit machen sie sich selbst total kirre.<br />
Sie verlieren ihre Intuition. Das kann nicht gut gehen. Diese<br />
Eltern müssen erst mal wieder eine Beziehung zu sich<br />
selbst aufbauen. Sie müssen sich spüren: Wer bin ich als<br />
Mama, wer bin ich als Papa? Was hier nachwirkt, ist diese<br />
Nachkriegsgeschichte, die mal als vaterlose Gesellschaft<br />
beschrieben worden ist.<br />
TN: Ihr heißt „Supermama“. Das suggeriert, dass Kindererziehung<br />
eigentlich Mamas Sache ist.<br />
Paula Diederichs: Diese Aggressionsgeschichten haben<br />
für mich als Therapeutin eindeutig etwas damit zu<br />
tun, dass der Vater nicht anwesend ist. Vielleicht hält er<br />
das Kind, aber er ist nicht wirklich da. Er ist vielleicht die<br />
Pappnase der Mutter, die die Regie führt. Aber ich habe<br />
da inzwischen auch Hoffnung. Es gibt junge Väter, die da<br />
einfach ran wollen und sagen, ich will am Erziehungspro-
zess beteiligt werden. Es gibt die traditionellen Väter, die<br />
arbeiten gehen und sagen Mach du mal zuhause, dann<br />
gibt es die, die keinen Plan haben und dann gibt es die,<br />
die sich richtig beteiligen wollen und jetzt auch in dieser<br />
frühkindlichen Zeit.<br />
TN: Wir stellen ja schon seit langem fest, dass die traditionelle<br />
Großfamilie bei uns in Deutschland ja gar nicht mehr<br />
existiert, wenn es hoch kommt, haben wir Kleinfamilien.<br />
Das heißt, dass ein Heer von jungen Leuten herangewachsen<br />
ist oder heranwächst, die keine Geschwister haben,<br />
die auch keine Beziehung zu Cousinen und Cousins haben.<br />
Es ist nicht ausgeschlossen, dass junge Menschen<br />
Eltern werden, die noch nie ein Baby im Arm hatten. Woran<br />
sollen die sich orientieren?<br />
Ich sehe es am eigenen Beispiel, eine Tochter, 18 Jahre<br />
alt, sagt, Mama, wenn ich mal Mutter werde, ich muss vorher<br />
irgendwo ein Praktikum machen, ich weiß gar nicht,<br />
wie ich damit umgehen soll. Da hilft es auch nicht zu lesen.<br />
Da fehlt einfach was. Wie gehen wir damit um?<br />
Charlotte Weidenhammer: Ja, aber auch die Außenwelt<br />
versucht uns immer durch die Ratgeber vorzugaukeln, wir<br />
können da eine Abkürzung nehmen, wir können uns ein<br />
bisschen was anlesen, dann wissen wir, wie es geht und<br />
dann machen wir es. Eigentlich ist ja die Geschichte der<br />
frühen Kindheit eine Geschichte von Bindung und Anbindung.<br />
Um das leisten zu können, müssen wir eigentlich<br />
in Kontakt treten mit unserer eigenen Bindungserfahrung<br />
und Bindungsgeschichte. Wie war das bei uns? War es<br />
gut, war es nicht gut? Wie haben wir uns gefühlt?<br />
Und das Kind, das wird uns damit konfrontieren, mit unserer<br />
eigenen Bindungsgeschichte, mit unserem Konstrukt,<br />
wie es in uns ist. Die ganzen Ratgeber tun ja so, als<br />
müssten wir das nicht. Wir wissen jetzt wie es geht, wir<br />
können einfach loslegen, aber, was diese Geburt in uns<br />
auslöst oder wenn das Kind nicht schlafen will, das wird<br />
da nicht mit in Bezug gesetzt.<br />
Ich glaube, das ist dieser Zeitgeist, jetzt machen wir das<br />
mal schnell, alles schnell, das Problem wird gelöst, Programm,<br />
und fertig. Diese eigentliche Konfrontation, die<br />
versuchen wir zu umgehen. Ich glaube, dass jeder Mensch<br />
diese Liebe für ein Kind hat. Es ist auch nicht selbstverständlich<br />
zu einer jungen Frau zu sagen, es ist da, du<br />
musst es nur irgendwie rausholen, sondern es kommt wie<br />
eine Direktive von oben: so wird’s gemacht, so wird’s gemacht<br />
– und jeder sagt es noch dazu anders, es gibt also<br />
20 Möglichkeiten, es falsch zu machen. Der Selbstbezug<br />
wird nicht hergestellt:, also z.B.will ich, dass das Kind bei<br />
mir im Bett schläft oder habe ich da überhaupt keinen<br />
Bock drauf, will ich es stillen oder finde ich das doof, egal,<br />
aus welchem Grund? Es gibt immer hohe abstrakte Ansprüche,<br />
manchmal noch durch Wissenschaft untermauert,<br />
aber es wird völlig ausgeblendet, was ich selbst will,<br />
wie finde ich mich als Frau, wie möchte ich mein Leben<br />
gestalten, möchte ich arbeiten gehen usw.<br />
TN: Ich habe vier Kinder, alle ziemlich weit auseinander.<br />
Es war wirklich jedes Mal anders, das erste Kind durfte<br />
nur auf dem Rücken liegen, das zweite sollte nur auf dem<br />
Bauch liegen, aber eigentlich kannte ich mich doch jetzt<br />
aus, ich müsste doch wissen, wie es geht. Nach neuesten<br />
Wissenschaften, jetzt doch nicht. Als lies bitte mal dieses<br />
Buch „Jedes Kind kann schlafen lernen“ - aber genau das<br />
habe ich nicht ausgehalten, ich habe mein Kind nicht<br />
schreien lassen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ja,<br />
dann bin ich eben mit dem Kind ins Bettchen, bis es 5<br />
ist oder 6 oder 7, ja, aber das passt. Das hat sich dann<br />
von ganz alleine gelöst, ich habe mir keinen Stress damit<br />
gemacht.<br />
Aicha Katjivena: Das ist doch auch okay.<br />
TN: Ich habe einen Vortrag über Familien gehört, da kam<br />
auch durch, was für eine autoritäre und hierarchische Welt<br />
das war, und diese Intuition, dafür gab es gar kein Wort. Wenn<br />
ich mich erinnere, wie früher gesprochen wurde, da hat man<br />
gar nicht über Gefühle gesprochen, so wie man auch nicht<br />
in der Ich-Form geredet hat, sondern man hat man gesagt,<br />
statt ich, oder sollte man nicht. Für Intuition gibt es im Deutschen<br />
auch kein Wort. Wenn ich an meine Oma denke, die<br />
hat sich für den Profi im Umgang mit Babys gehalten, man<br />
hat sie auch gerufen, wenn ein Baby geboren wurde. Sie hat<br />
die Babys gehalten, das sah ganz komisch aus.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 123
124<br />
Workshop Heute ratlos, morgen super<br />
Heute ratlos, morgen super<br />
Da war nichts von dieser Intuition zu spüren, sondern sie<br />
war einfach eine, die gut gelernt hatte, was diese Schwestern<br />
früher gesagt hatten, die ins Haus kamen, wenn ein<br />
Kind kam. Das waren keine Hebammen, sondern katholische<br />
Schwestern. Die haben gesagt, wenn ein Kind<br />
schreit, dann weiten sich die Lungen, das ist gut. Ein Kind<br />
muss alle vier Stunden gefüttert werden. Und das Kind<br />
wurde mit einem Abstand gehalten, da kam überhaupt<br />
kein Kontakt zustande. Dann hat sie mit der Flasche gefüttert,<br />
Stillen hat man zum Glück in den 60-er Jahren abgeschafft,<br />
dieses lästige Gedöns, weil die Hebamme sagte,<br />
man muss das Kind öfter anlegen, weil sonst die Milch<br />
weg geht. Das Ziel war ja – alle vier Stunden.<br />
Und so wurde den Frauen über Jahrzehnte die Intuition<br />
auch ausgetrieben bis zum Anschlag. Das, was ich jetzt in<br />
den PEKiP-Gruppen in Hohenschönhausen vor mir habe,<br />
ist das Ergebnis dessen. In der DDR wurde es auch noch<br />
ein bisschen länger fortgeführt als im Westen, 120 Jahre<br />
länger, es gab so ein paar Nischen, ja, alle vier Stunden,<br />
durchschlafen, Töpfchen, das war genau das, was meine<br />
Oma auch gesagt hat.<br />
TN: Es war staatlich, es war viel verstaatlicht. Es gab sogar<br />
Kindergärten, wo die Kinder die ganze Woche hingehen<br />
konnten und die Eltern ihr Kind nur am Wochenende bekamen.<br />
TN: Da war ich auch, ein Wochenheim.<br />
TN: Das Thema dieser Tagung ist ja „Familien unter Generalverdacht<br />
oder Heiligenschein“. Was mir selber, ich<br />
habe auch zwei Kinder, auffällt, ist die Geschichte mit<br />
dem Generalverdacht. Ich habe für mich gemerkt, wenn<br />
ich alleine mit meinen Kindern im Kontakt bin, ist das<br />
alles easy. Aber es kommen von außen Anforderungen,<br />
Schule, Kita und es wird immer heftiger, also das heißt, in<br />
den Moment, wo ich spüre, ich habe als Mutter auch eine<br />
Aufgabe für die Gesellschaft, ich habe bitte-schön so ein<br />
Kind zu produzieren, das keinen Ärger macht und wehe<br />
wenn, das macht mir als Mutter tierischen Stress. Es ist<br />
gar nicht Stress im Umgang mit meinem Kind an sich, aber<br />
diese Erwartungen, deswegen finde ich auch den Titel dieser<br />
Tagung gut. Diese Unsicherheit, die auch eine Rolle<br />
spielt, auch die Intuition, die nicht mehr so da ist, aber die<br />
Erwartungen, die an die Familien gestellt werden, was die<br />
alles machen müssen, dass das Kind, was da rauskommt,<br />
ganz bestimmte Kriterien erfüllen muss, um in dieser Gesellschaft<br />
on top zu sein. Das ist der Stress. Der fängt mit<br />
der Schwangerschaft an.<br />
Charlotte Weidenhammer: Dieses Buch „Jedes Kind kann<br />
schlafen lernen“ ist sehr plakativ, das ist ja wie die Aussage,<br />
dass jedes Kind Abitur machen kann. Die müssen<br />
ja alle toll sein. Dieser Stressfaktor hat natürlich indirekt<br />
auch etwas mit dem Verlust von Traditionen zu tun. Wir<br />
haben nicht mehr die Großfamilien mit fünf Kindern, wo<br />
eines vielleicht den Hauptschulabschluss macht, egal,<br />
eines macht vielleicht das Abitur. Heute müssen alle unbedingt<br />
perfekt sein. Sie dürfen auch nicht hibbelig sein,<br />
das ist ja auch ein ganz großes Problem. Das ist ja nicht<br />
nur für die Eltern eine Herausforderung, sondern auch für<br />
die Kinder, in was für einer Glocke die groß werden, um<br />
zu funktionieren. Und wirklich auch die Schwierigkeit, sich<br />
dem zu verweigern, das ist vielleicht das falsche Wort, sich<br />
dem entgegenzustellen und zu sagen, mein Kind ist eben<br />
hibbelig und es kriegt trotzdem kein Ritalin – oder es ist so<br />
und so und es darf auch sein. Das ist natürlich wahnsinnig<br />
schwierig.<br />
Reinhilde Godulla: Torsten ist seit 6 Monaten Familienhelfer.<br />
Ist da der Fokus nur auf das Kind oder auch auf Mutter<br />
oder Vater?<br />
TN: Wie der Begriff Familienhelfer schon sagt, der Fokus<br />
liegt auf der Familie. Es gab lange Zeit eine Trennung zwischen<br />
Einzelfallhilfe und Familienhilfe, ich glaube, das gibt<br />
es in Berlin nicht mehr. Das heißt jetzt direkt Familienhilfe.<br />
Es gibt in der Behindertenhilfe noch den Einzelfallhelfer.<br />
Wenn man merkt, die Familie lässt den Helfer nicht so zu,<br />
dann verkauft man es auch als Einzelfallhilfe für das Kind,<br />
weil die Eltern so rüberkommen, mein Kind macht keine<br />
Hausaufgaben, schreit viel, kann nicht schlafen, was auch<br />
immer. Der Fokus liegt auf dem Kind. Sie haben alles versucht,<br />
sie haben Ratgeber gelesen usw. Wie auch schon
festgestellt wurde, ist es eigentlich so, dass die Eltern so<br />
belastet sind oder in ihrer Beziehung nicht klar kommen,<br />
dass die Kinder auffällig werden.<br />
Man muss mit den Eltern was machen, aber wenn die<br />
Eltern es nicht zulassen, weil es in ihren Augen an dem<br />
Kind liegt, was sollen wir denn besprechen, weil mein Kind<br />
macht ja keine Hausaufgaben. Wenn die Einsicht nicht da<br />
ist, dann wird das als Hilfe für das Kind verkauft, aber der<br />
Fokus ist schon auf der ganzen Familie.<br />
TN: Wie ist es bei Dir? Hast Du Eltern, die empfänglich sind<br />
oder machst Du auch erst mal den Weg über das Kind?<br />
TN: Man kommt über das Kind erst mal leichter in die<br />
Familie. Es ist auch ganz wichtig, da eine Beziehung zu<br />
dem Kind aufzubauen, weil dann die Kinder eigentlich ein<br />
Stück weit alleine sind in der Familie. Die kriegen immer<br />
alles ab, die werden angeschrieen, bei denen klappt irgendwie<br />
alles nicht, sie haben wenig Selbstwertgefühl und<br />
wenig Selbstbewusstsein, wo sollen sie das auch herkriegen,<br />
wenn sie immer das Gefühl haben, sie machen alles<br />
falsch? Da muss man einen Kontakt herstellen und eine<br />
Bindung eingehen, das ist ganz wichtig.<br />
Paula Diederichs: Zu diesem Perfektionismus: Wir haben<br />
1-Frau-Familien oder 1-Mann-Familien, die allein erziehend<br />
sind, oder eben Patchwork-Familien. Das birgt natürlich<br />
ein unheimliches Potenzial für Aggressionen oder<br />
Auseinandersetzungen. Ich reise viel herum und kriege<br />
mit, dieser Mutter-Perfektionismus spielt sich jeden Tag<br />
an den Supermarktkassen ab. Da sagt ja keiner, ich helfe<br />
Ihnen, ich nehme Ihnen das Kind mal ab, gehen Sie mal<br />
einkaufen, wie ich das teilweise in Italien oder Portugal<br />
erlebt habe. Du gehst in ein Restaurant essen, der Kellner<br />
sagt, ich passe auf das Kind auf, das nichts passiert,<br />
essen Sie mal in Ruhe. Das passiert in Deutschland? Da<br />
fliegst du aus der Kneipe raus. Oder die Mutter mit dem<br />
Kinderwagen, die in Berlin vor der defekten Rolltreppe<br />
steht und um Hilfe fragt, bekommt mit mehr Schnauze als<br />
Herz vorgehalten Das hättest du dir vorher überlegen sollen.<br />
Das sind die Nettigkeiten, die dir hier passieren. Da<br />
wird der Mutter ganz klar die Verantwortung zugewiesen<br />
und vermittelt, du hast die Verantwortung für das Kind und<br />
du kannst auf der emotionalen Ebene keinerlei Hilfe von<br />
deinen Mitmenschen erwarten.<br />
Von den Müttern wird erwartet, dass sie gute Kinder produzieren,<br />
aber die Verwirrung von der Fachseite ist unglaublich<br />
heftig und wird hier in Deutschland fast kriegerisch geführt.<br />
Es gibt jetzt zum Beispiel einen Feldzug von einem<br />
S c h l a f f o r s c h e r<br />
aus Dresden, der<br />
rausgekriegt hat,<br />
dass die Kinder<br />
auf dem Rücken<br />
liegen müssen, die<br />
dürfen nicht im Elternbett<br />
schlafen,<br />
die kriegen einen<br />
Schlafsack an, maximal<br />
noch einen<br />
Nuckel, die sollen platt auf dem Rücken gebettet liegen.<br />
Der predigt das so, alle Wissenschaftler sagen, der hat<br />
Recht, alle Kinder müssen so gebettet werden. Wenn du<br />
das nicht tust, dann riskierst du, dass dein Kind am plötzlichen<br />
Kindstod stirbt. Willst du das?<br />
In Baden-Württemberg hat die Gesundheitsministerin jetzt<br />
angeordnet, dass Sicherheit vorgeht und dem plötzlichen<br />
Kindstod zu Leibe gerückt werden muss und hat deshalb<br />
alle Hebammen des Bundeslandes angewiesen, den Eltern<br />
beizubiegen, ihre Kinder so zu betten. Die ziehen vor den<br />
Kadi, wenn die Hebamme das nicht weitergibt. Der Verlust<br />
von Intuition wird vom Staat oder von der Wissenschaft<br />
teilweise so verordnet. Ich meine, das widerspricht aller<br />
Bindungsforschung, aber dieser Krieg tobt hier. Den gibt<br />
es beim Thema Stillen oder beim Thema Impfen. Wenn<br />
eine Mutter kommt und wissen will, ob sie ihr Kind impfen<br />
lassen soll oder nicht, dann stehen auf dem Podium<br />
die Impfgegner und die Impfbefürworter und beschimpfen<br />
sich gegenseitig, du Mörder. Dabei will die Mutter nur Hilfe<br />
haben, aber es spitzt sich hier ganz schön zu.<br />
Charlotte Weidenhammer: Die Eltern werden doch gar<br />
nicht ernst genommen. Die Ärzte und Kinderkrankenschwestern<br />
denken alle, och, das kann ich, ich weiß doch,<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 125
126<br />
Workshop Heute ratlos, morgen super<br />
Heute ratlos, morgen super<br />
wie es geht, wenn ein Kind schreit, dann muss man ein<br />
paar Tipps geben und das Problem hat sich erledigt. Nach<br />
dem Motto, wenn du uns nicht glaubst, dann bist du selber<br />
schuld.<br />
Ich erlebe ganz viel, dass die Ärzte dann eben sagen, das<br />
geht nicht so weiter, Sie müssen mal dieses Programm machen,<br />
„Jedes Kind kann schlafen lernen“, hier haben Sie<br />
das Buch, tschüss. Oder selbst Schreibabyambulanzen: du<br />
kriegst einen Termin in zwei Wochen, dann kriegst du eine<br />
Stunde, wo man das besprechen kann und kannst dann<br />
mit drei oder vier Blätter mit Tipps nach Hause gehen.<br />
TN: Mir wurde gesagt: Sie haben ein Schreikind, viel Spaß<br />
zu Hause.<br />
Charlotte Weidenhammer: Was nach meiner Erfahrung<br />
wirklich sehr viel hilft, wenn man mit den Eltern erst mal<br />
rausfindet, wo eigentlich ihrs ist und das dauert vielleicht<br />
eine Weile. Es gibt natürlich auch Eltern, die das erst mal<br />
gar nicht haben, also die so wenig Vorbilder in ihrem eigenen<br />
Leben hatten, wo sie sagen, das hat sich gut angefühlt,<br />
dass ihnen so ein Skript fehlt. Es fehlt ihnen so<br />
eine Art innerer roter Faden, wie sie das machen wollen.<br />
Da finde ich es spannend, dass die Eltern, wenn sie zu mir<br />
kommen, eine ganze Weile sehr gerne sofort ihr Kind abgeben.<br />
Sie geben es ab und wollen, dass ich es halte, und<br />
gucken einfach nur zu, was da eigentlich passiert.<br />
Dann installiert es sich sehr schnell, einfach über diese<br />
Erfahrung, ja, das geht, ich kann mir das auch – wie<br />
das Kinder auch machen – über Nachahmung abgucken,<br />
das rieselt irgendwie in mich rein, was ich auch eine tolle<br />
Erfahrung finde, weil es relativ schnell geht. Eigentlich<br />
haben die Eltern ja ihre Vorstellungen, aber sie sind irgendwie<br />
verschüttet gegangen. Es braucht eigentlich nur<br />
eine Weile Zeit und eine Akzeptanz auch davon und keine<br />
Beurteilung von ihrem Tun, bis die da langsam mit nach<br />
draußen kommen und auch ein Stück Authentizität wieder<br />
finden. Eine Freundin sagt, dass das Kind unbedingt im<br />
Bett schlafen muss, weil das sonst schlecht ist, aber eigentlich<br />
will ich viel lieber meine Ruhe haben, sonst kann<br />
ich gar nicht schlafen. Es kann auch umgekehrt sein, dass<br />
die Schwiegermutter sagt, wie, bei dir im Bett, das geht ja<br />
gar nicht, und die Mutter ganz glücklich ist, wenn sie das<br />
Kind zu sich holen darf. Damit ist eigentlich jeder Ratgeber<br />
ad absurdum geführt bis zu einem gewissen Grad, weil<br />
die Sache und die Leute unterschiedlich sind.<br />
TN: So wenig wie es genormte Babys gibt, gibt es die Wahrheit,<br />
wie man Babys erzieht, deswegen denke ich, es konkretisiert<br />
sich darauf, Eltern wirklich in ihrer Intuition zu<br />
stärken, in ihrer Autonomie. Eltern brauchen natürlich in<br />
manchen Situationen professionelle Berater, aber was sie<br />
noch mehr brauchen, das ist tatsächlich ein Familiennetz,<br />
also dass Eltern sich auf der Peer-Ebene austauschen und<br />
spüren, dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt, unterschiedliche<br />
Erziehungsstile und unterschiedliche Wege.<br />
Sie müssen mitkriegen, dass sie nicht die große Wahrheit<br />
von den Professionellen, wenn ich deren Tipps umsetze,<br />
ist alles in Ordnung, sondern sie müssen darin gestärkt<br />
werden, damit sie auch Mut haben, etwas auszuprobieren<br />
und entsprechend ihrer Intuition zu leben. Ich glaube, das<br />
kriegen sie doch mehr, wenn sie sich mit anderen Familien<br />
austauschen.<br />
Aicha Katjivena: Es ist auch okay, wenn es nicht funktioniert,<br />
so wie es auch okay ist, nicht perfekt zu sein.<br />
TN: Das ist genau der Punkt, um den es eigentlich geht.<br />
Wie sieht es denn in Wirklichkeit aus? Wo sind denn diese<br />
Eltern? Wie begegnen ihnen die Fachleute im Familienzentrum,<br />
im Kindergarten? Von da wird ja das System anders<br />
bedient. Wer sagt ihnen denn: hört auf Euren Bauch?<br />
Wir reden bei uns nicht von Intuition, wir sagen Bauch.<br />
Bauch, da komme ich eher mit klar. Das ist doch ein Lösungsansatz.<br />
Ich finde es unheimlich wichtig, dass sich die<br />
Fachkräfte, die den Erstkontakt mit den Eltern haben, in<br />
der Spielgruppe und im Kindergarten, sich mit dem Bauch<br />
beschäftigen.<br />
Diese Verantwortung wahrzunehmen und entsprechend<br />
zu überlegen, was entwickeln wir, und nicht auf diesen<br />
Formalisierungszug aufzuspringen. Auch wir haben Elterntraining<br />
gehabt, haben aber alles wieder runtergefahren,<br />
weil das ganz anders laufen muss. Und dafür finde<br />
ich leider kein passendes Programm, was mir mein
Leben und meine Arbeit erleichtern würde, sondern unsere<br />
KollegInnen sind alle gefordert, auf den Bauch zu<br />
achten und die Angebote neu zu entwickeln. Es reicht<br />
nicht aus, das nur festzustellen, sondern es muss Auswirkungen<br />
haben und Informationen müssen zu denjenigen<br />
gelangen, die mit den Kindern in den Familien<br />
arbeiten, bis nach oben, in die Schulen rein. Das ist ein<br />
ganz langer Prozess.<br />
Der hat leider auch mit Geld zu tun, mit Druck, mit Wirtschaftlichkeit,<br />
das weiß ich. Ich leite seit 12 Jahren Eltern-Kind-Gruppen,<br />
die kommen im Alter von 18 Monaten<br />
an, wir haben schon runtergeschraubt, weil die Kinder ja<br />
immer früher in die Krippen gebracht werden oder in die<br />
Kitas. Zwei Stunden einmal pro Woche. Das ist nicht nur<br />
Singen, Spielen, Tralala, sondern wenn wir gemeinsam<br />
frühstücken, ergibt sich immer ein Gespräch, jede Mutter<br />
beteiligt sich, ob es um Erziehung geht. Wir haben immer<br />
ein Thema, was richtig heiß diskutiert wird. Manchmal<br />
frage ich selber nach, du hattest Schwierigkeit mit dem<br />
Schlafen, was machst du jetzt? Dann kommen alle anderen<br />
und sagen was, da bildet sich ganz viel. Bei denen<br />
kann man auch wunderbar sagen, einmal im Monat gibt<br />
es einen Elternabend, da könnt ihr noch mal tiefer in ein<br />
Thema einsteigen, vielleicht auch mal ohne Kinder. Das<br />
ist der Weg, den wir gehen.<br />
TN: Das Problem, was ich sehe, weil ich auch mit Kostenträgern<br />
zu tun, ist immer das Kreisjugendamt. Das<br />
Kreisjugendamt in Schleswig-Holstein leidet unter dem<br />
enormen Kostendruck, der da ist. Das heißt, wir gehen<br />
rein in die Ausschüsse und melden an, dass wir mehr<br />
Geld brauchen. Damit provozieren wir die Reaktion<br />
der Politik, dass sie Lösungen haben wollen, wie alles<br />
schneller und kostengünstiger geht. Das ist doch auch<br />
die Realität. Geld regiert die Welt, es geht auch darum.<br />
Insofern haben auch die Jugendämter ein großes Problem,<br />
Erfolg darzulegen, und zum Beispiel unsere Elternlernwerkstatt<br />
wird vom Jugendamt finanziert. Doch<br />
nicht, weil die uns gut finden, sondern weil sie sagen,<br />
das ist doch mal was ganz Konkretes und da können wir<br />
Ergebnisse erwarten.<br />
Charlotte Weidenhammer: Ich möchte etwas über die Entwicklung<br />
in Darmstadt berichten. Wir haben vor zwei Jahren<br />
unser Haus „Menschenskinder – Werkstatt für Familienkultur“<br />
ins Leben gerufen. Wir waren uns dabei dessen<br />
bewusst, dass wir uns einem Tabuthema annähern. Die<br />
Eltern wollen perfekt sein und nicht gerne zugeben, dass<br />
dass manches nicht so gut läuft. Mir war wichtig, dass wir<br />
einen Ort finden, wo Krise und Alltag sich mischen und wo<br />
ganz klar gemacht wird, das ist hier zusammen und das<br />
gehört auch zusammen. Das ist ungewöhnlich, weil sonst<br />
die Krise und die Normalität wenig Berührung miteinander<br />
haben. Für mich war das ein großes Experiment, weil<br />
ich vorher praktisch als Untermieter mit den Schreibabys<br />
in einer anderen Praxis tätig war.<br />
Dann kam dieses Haus, es ist eigentlich sehr klein, unten<br />
ist ein großer Gemeinschaftsraum, dann geht es nach<br />
oben, oben ist der Bewegungsraum, wo praktisch diese<br />
Praxis ist. Am Anfang war es extrem, da kam eine dickere<br />
Tür, aber unten ist praktisch ein offener Bereich, wo<br />
an drei Tagen in der Woche einfach Familien mit ihren<br />
Kindern kommen, gleichzeitig hatte ich oben die Schrei-<br />
Babys. Das hat sich als ganz toll erwiesen, weil das befruchtet<br />
sich total, also sowohl die Leute, die unter Isolation<br />
leiden, kommen und sehen andere Eltern, die da sind,<br />
und auch die unten sitzen, hören zwangsläufig, was da<br />
oben passiert. Da ist eine ganz große Offenheit in kürzester<br />
Zeit entstanden, die ich als ganz wertvoll empfinde.<br />
Parallel hat die Stadt uns zwei Jahre lang ignoriert, es gibt<br />
keinen Bedarf, man braucht und will uns nicht, vor allem<br />
die Städtische Familienbildungsstätte hat da ganz viel<br />
uns Gegenwind gegeben, weil wir ein Konkurrenzunternehmen<br />
mit einer Seele waren, was bei ihnen schon lange<br />
verloren gegangen war. Im Sommer gab es einen Fall, wo<br />
Zwillinge geschüttelt wurden in Darmstadt, was durch die<br />
Presse ging. Es erschien dann ein Artikel über die Schrei-<br />
Baby-Ambulanz, wo ein Redakteur sehr gut recherchiert<br />
hat, in dem Fall also überhaupt nicht reißerisch und auch<br />
sehr fundiert. Er hatte auch eine Mutter interviewt, die<br />
sich da sehr offenbart hat. Und interessanterweise war<br />
gerade eine Woche vorher der Sozialdezernent bei uns<br />
gewesen und hatte uns wieder einmal gesagt, es gäbe<br />
keinen Bedarf und er brauche uns nicht, auch für die<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 127
128<br />
Workshop Heute ratlos, morgen super<br />
Heute ratlos, morgen super<br />
Schreibaby-Ambulanz gäbe es keinen Bedarf. Schließlich<br />
gibt es eine Anlaufstelle für drogensüchtige Mütter und für<br />
Teenager-Schwangere, das reicht aus.<br />
Dann erschien dieser Artikel und dieser Redakteur hatte<br />
auch in der Stadt angerufen und gefragt, was es denn<br />
als städtisches Angebot für Eltern, die nicht mehr weiter<br />
wissen, gibt. Er bekam wieder zur Antwort, drogensüchtige<br />
Mütter und Teenager. Er hat das dann auch so ganz<br />
nüchtern in dem Artikel geschrieben. Daraufhin habe ich<br />
Anrufe bekommen von ganz entrüsteten Eltern, dass das<br />
Angebot nicht reicht. Plötzlich haben die gemerkt, keine<br />
Ahnung, was passiert ist, aber der Wind drehte sich. Plötzlich<br />
pushen sie mich wie verrückt und schreiben mich auf<br />
alle Fahnen drauf. Die Stadt Darmstadt und die Schrei-<br />
Ambulanz fand ich schon drei Mal in der Zeitung, bevor<br />
ich wirklich mit denen in Verhandlung getreten war. Ich<br />
muss ganz doll aufpassen, dass die mich nicht da verheizen.<br />
Im Prinzip ist es wieder eine Modeerscheinung,<br />
auf einmal ist die frühe Kindheit wichtig, wir haben die<br />
Bindung entdeckt, das ist auch eine Gefahr. Auch ist die<br />
Frage für mich, was mache ich daraus und wie gehe ich<br />
damit um?<br />
Ich denke, es ist sowieso etwas, was gerade im Kommen<br />
ist, also diese frühe Zeit als Präventionsfeld zu entdecken,<br />
wo es dann auch Gelder gibt. Letzte Woche war ich<br />
auf dieser Präventionskonferenz, die haben sich ganz<br />
schnell viele Projekte gesucht, die da teilhaben sollten.<br />
Es gibt ein Projekt, was sie jetzt starten, frühe Hilfen. Was<br />
ich als fast gruselig erlebe, ist die Konkurrenz, die auch<br />
ganz schnell entsteht, dass sich die ganzen Träger um<br />
den lächerlich kleinen Topf streiten. Das sind ungefähr<br />
30 Träger, die das unbedingt machen wollen, aber das<br />
sind alles Jugendhilfen, die noch nie mit früher Kindheit<br />
was zu tun gehabt haben. Die suchen sich sofort raus,<br />
ja, dann machen wir diesen A-Kurs und diesen B-Kurs ...,<br />
aber sie haben eigentlich keine Ahnung, was ich höchst<br />
bedenklich finde. Aber was ist eigentlich mit den Eltern<br />
oder den Kindern?<br />
Paula Diederichs: Ich wollte noch sagen, wie wir die Familienbegleitung<br />
machen, das sind ja nicht nur Schrei-Babys,<br />
sondern die sind bis 3 Jahren. Das haben wir von der Stiftung<br />
erlaubt bekommen, also von den Geldgebern, dass<br />
wir diese Begleitung machen können, wie wir die begleiten,<br />
das ist wirklich Bauch, Intuition, auf dem Weg zu sich<br />
selbst, damit sie sich wieder finden. Ich erlebe das als unglaublich<br />
bereichernd. Ich war früher auch Erzieherin und<br />
Sozialarbeiterin. Wie schön es ist, die einzubinden, das<br />
passiert wirklich in allen Nachbarschaftsheimen, wo wir<br />
sind, das ist ganz toll. Und die Türkinnen haben wir in der<br />
Osloer Straße auch gekriegt. Parallel zu dem Tag, wo die<br />
Schrei-Babys nicht da waren, hat ein türkisches Frauenfrühstück<br />
stattgefunden, also es hat vier Jahre gebraucht,<br />
bis die Kontakt hatten, bis sie wirklich gekommen sind,<br />
aber mit der Einrichtung des Frühstücks hat es plötzlich<br />
geschnackelt.<br />
Die Art und Weise, wie in den Nachbarschaftsheimen miteinander<br />
umgegangen wird, das finde ich ganz toll. Ich<br />
habe mich auch bewusst dafür entschieden, da zu bleiben,<br />
statt die anderen Angebote, ins Krankenhaus zu gehen,<br />
anzunehmen. Es ist zwar gut, dass es das in Krankenhäusern<br />
auch gibt, aber ich bleibe in dem Rahmen, weil es<br />
vom Anspruch her zusammenpasst.<br />
TN: Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja um<br />
eine Haltung. Und die Haltung ist nicht an einen Ort gebunden.<br />
Das kann in Schulen und Kitas genauso stattfinden.<br />
Damit sind wir wieder beim Netzethema. Das<br />
funktioniert ja nur, wenn es nicht exklusiv an einen Ort<br />
gebunden ist sondern sich allgemein als Haltung verbreitet.<br />
Aicha Katjivena: Für alle, die im sozialen Bereich arbeiten<br />
oder mit Menschen zu tun haben, ist es natürlich wahnsinnig<br />
wichtig, selbstreflektiert genug zu sein, um zu sehen,<br />
was für eine Haltung habe ich, was möchte ich gerne<br />
vermitteln. Man muss auch schauen, ob das abzukoppeln<br />
ist von dem, was der Träger für eine Konzeption hat oder<br />
welches Leitbild er hat. Manchmal gibt es eine bestimmte<br />
Konzeption, nach der du arbeiten musst, das ist meine<br />
Haltung bzw. Vereinbarung mit dem, was der Träger vermitteln<br />
will.<br />
Ich würde auch gerne noch was zum Berliner Bildungsprogramm<br />
sagen, weil das arbeitet eben mit dem Bauch.
Es geht darum, dass Erzieher auch noch mal merken, von<br />
dieser Rolle wegzukommen, immer zu moderieren und zu<br />
sagen, ich habe 20 Jahre lang Erfahrung, ich habe dies<br />
und das gemacht, von da wegzukommen und zu gucken,<br />
was kriege ich von den Kindern? Auch mal zu gucken, wo<br />
leben die Kinder und mit deren sozialem Umfeld, mit den<br />
Lebensumständen, in denen sie sich befinden, mit arbeiten<br />
zu können und das mit einzubeziehen, zum Beispiel<br />
auch in meinem Bild über diese Familie. Man muss wertschätzend<br />
genug sein, um nicht meine Sicht der Dinge<br />
oder meine pädagogischen Ansätze denen überzustülpen,<br />
sondern zu überlegen, wie ich sie stärken kann. In<br />
der Familienhilfe ist es wahnsinnig wichtig, die Kinder, die<br />
mit ihren Eltern allein gelassen werden, zu stärken, um<br />
ihnen Möglichkeiten zu geben, in ihrer Familie zu überleben,<br />
ohne dass sie daran zerbrechen. Das ist ein wichtiger<br />
Aspekt, mit den eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen<br />
zu arbeiten. So ist es auch wichtig zu gucken, was das<br />
mit mir macht, wer ich bin und was kann ich geben oder<br />
was will ich.<br />
TN: Die Erfahrung sagt ja, dass es sich wieder umkehrt.<br />
Zu DDR-Zeiten waren Hausbesuche ja ganz normal, Beratungen<br />
ganz normal, also immer im Kontext mit der Familie.<br />
So wie man eine Wohnung betritt, hat man ja ein<br />
anderes Bild von dieser Familie. Da soll man ja wieder<br />
hin. Ich finde es auch ganz wichtig, dass bestimmte Dinge<br />
in der Zeit der Kita mit Eltern noch viel besser funktionieren,<br />
weil man automatisch ins Gespräch kommt, weil<br />
die Eltern die Kinder selber abgeben. Da ist eine Beziehung<br />
einfacher als in der Schule und je älter die Kinder<br />
werden, desto schwieriger wird es ja, an sie heranzukommen.<br />
In die Schule werden Eltern nur gebeten, wenn Auffälligkeiten<br />
sind, was schade ist, denn man sollte positiv<br />
denken und an die Ressourcen anknüpfen, die bei dem<br />
Kind und in der Familie da sind. Ich finde, das haben wir<br />
vernachlässigt. Wir sollten den Weg wieder gehen, damit<br />
wir immer diesen gemeinsamen Blick von Familie schaffen<br />
können. Wenn die Familie zu klein wird, dann müssen<br />
wir gucken, wie wir sie ergänzen können durch andere<br />
Menschen.<br />
Reinhilde Godulla: Allgemein bei Elternabenden ist das<br />
mittlerweile sehr wenig. Ich habe von 1984 bis 1990 im<br />
Kinderschülerladen gearbeitet, da war eine intensive<br />
Auseinandersetzung, es wurde alles besprochen. Heute<br />
unterrichte ich zukünftige Erzieher/innen im Pestalozzi-<br />
Fröbel-Haus in ihrem Praktikumssemester und bin einigermaßen<br />
erschüttert, dass es Elternarbeit in den einzelnen<br />
Einrichtungen so gut wie gar nicht mehr zu geben<br />
scheint oder einmal alle zwei Monate. Dieser Klassiker,<br />
wie er für mich immer selbstverständlich war, ist nicht<br />
mehr oft vorhanden. Oder einfach die Möglichkeiten für<br />
die Eltern, sich auszutauschen, das ist relativ selten geworden.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 129
130<br />
Workshop<br />
Workshop<br />
Pass-genau?<br />
Familienbilder und Rollenklischees im<br />
interkulturellen Kontext<br />
Inputs:<br />
Dr. Haci-Halil Uslucan:<br />
„Familienrollen und Erziehungsstile bei Migranten<br />
aus der Türkei“<br />
Haroun Sweis (Radio Multikulti und Outreach Berlin)<br />
„Medienverhalten arabischer Familien in Deutschland“<br />
Petra Kindermann und Svetlana Krabel<br />
(NBH Prinzenallee)<br />
„Unterstützung von Familien aus Ex-Jugoslawien -<br />
rund um die Schule“<br />
Moderation:<br />
Herbert Scherer<br />
Haci-Halil Uslucan: Erziehung scheint gegenwärtig schwieriger<br />
denn je geworden zu sein. Populärwissenschaftliche<br />
Werke, die einen Erziehungsnotstand feststellen, erfreuen<br />
sich einer großen Beliebtheit. Einig ist man sich darüber,<br />
dass in den letzten Jahrzehnten ein grundlegender Wandel<br />
in den Erziehungsvorstellungen stattgefunden hat, der mit<br />
gesellschaftlichen Veränderungsprozessen einherging. Immer<br />
seltener bildet die so genannte „Normalbiographie“,<br />
die gewöhnlich über den Arbeitsmarkt geregelt wird, für<br />
Jugendliche das Leitbild. Allgemein stehen heute Jugendliche<br />
sowohl unter gesteigerten Entscheidungsoptionen<br />
und zugleich auch unter höherem Entscheidungsdruck.<br />
Jugendliche können und müssen heute mehr entscheiden<br />
denn je; d.h. aber auch, dass sich ihnen neue Chancen<br />
und neue Risiken eröffnen. Dieser Anstieg von Gestaltungsmöglichkeiten<br />
bedeutet zugleich, dass einerseits<br />
Jugendliche selbst immer mehr zu Entscheidungsträgern<br />
werden und andererseits die Kriterien für Entscheidungen<br />
immer subjektiver und offener werden, weil ein Rückgriff<br />
auf traditionale Vorgaben mehr und mehr an Verbindlichkeiten<br />
einbüßt.<br />
Von diesen Prozessen sind Migranten und deren Kinder<br />
oft deutlich stärker betroffen als Einheimische. Die<br />
Grundanforderungen, eine Balance zwischen dem Eigenem<br />
und dem Fremden zu halten, sind für ausländische<br />
Familien und Kinder wesentlich höher als für Einheimische.<br />
Für sie gilt: Zuviel Wandel und Aufgeben des Eigenen<br />
führt zu Chaos, zu wenig Wandel zu Rigidität. Sie<br />
müssen einerseits über die Differenz zum Anderen, eigene<br />
Identität bewahren, andererseits aber auch, sich<br />
um Partizipation kümmern, das Fremde übernehmen.<br />
Integration nach innen und Öffnung nach außen stellen<br />
sich als notwendige, aber teilweise widersprüchliche<br />
Anforderungen dar. Diese Belastungen können zu Streß<br />
und Verunsicherung führen. Kinder aus Migrantenfamilien<br />
müssen insbesondere in der Jugendphase nicht nur<br />
die allgemeine Entwicklungsaufgabe bestehen, eine angemessene<br />
Identität und ein kohärentes Selbst zu entwickeln,<br />
sondern sich, anders als ihre deutschen Altersgenossen,<br />
auch noch mit der Frage der Zugehörigkeit zu<br />
einer Minderheit auseinander setzen und dementsprechend<br />
eine „ethnische Identität“ ausbilden. Diese ethnische<br />
Kategorisierung ist ein relevantes Merkmal in der<br />
Sozialisation von Migrantenkindern, weil dadurch über<br />
Zeiten und Generationen hinweg die symbolische Stabilität<br />
der Eigengruppe garantiert wird.<br />
Was im Einzelnen für Kinder und Jugendliche gilt, ist nicht<br />
minder für die gesamte Familie relevant; denn bei einer<br />
familialen Migration sind die Familienmitglieder gezwungen,<br />
zusätzlich zur alltäglichen Gestaltung des Familienlebens,<br />
ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern, zu ändern<br />
und umzuorganisieren. In dem Maße jedoch, indem eine<br />
Akkulturation, d.h. ein allmählicher Erwerb der Standards<br />
der Aufnahmekultur erfolgt, findet in der Regel auch eine
Entfernung von den Werten der Herkunftskultur statt; dieser<br />
Widerspruch, sich einerseits in die Mehrheitsgesellschaft<br />
zu integrieren, andererseits aber auch kulturelle<br />
Wurzeln nicht ganz aufzugeben, gestaltet sich insbesondere<br />
im erzieherischen Kontext als spannungsgeladen.<br />
Denn besonders Kinder, die sich - aufgrund ihrer schulischen<br />
Sozialisation im Einwanderungsland - vermutlich<br />
rascher und intensiver als ihre Eltern an die Kultur des<br />
Einwanderungslandes akkulturieren, verlieren dadurch<br />
gleichzeitig ihre sozialisatorischen Bindungen an ihre<br />
Herkunftskultur.<br />
Die intensivere Akkulturation der Kinder führt dazu, dass<br />
Eltern merken, dass die Kinder sich ihnen entfremden.<br />
Aus ihrer Sicht fühlen sie sich genötigt, die Kinder stärker<br />
an ihre eigene Kultur zu binden - bei uns macht man<br />
das aber so, mach das nicht wie die Deutschen. Diese<br />
verstärkte Disziplinierung der Kinder und die Erinnerung<br />
an eigenkulturelle Verhaltensweisen können zu stärkeren<br />
Spannungen führen.<br />
Ich will Ihnen noch zwei, drei Daten aus unserer Stichprobe<br />
darlegen. Wir haben nach den Bildungshintergründen<br />
der Eltern gefragt, das Ergebnis ist nicht nur für diese<br />
Stichprobe gültig, sondern mit einigen anderen Studien,<br />
die ich mit türkischen Familien durchgeführt habe, fast<br />
abbildungsgleich. Wir haben hier 3 bzw. 4 % Deutsche,<br />
die gar keinen Abschluss angegeben haben, 10 bis 12 %<br />
türkische Familien, die überhaupt keinen Abschluss hatten,<br />
und rund 35 % türkische Mütter, die nur einen Grundschulabschluss<br />
haben.<br />
Hierzu muss man wissen, dass in der Türkei bis 1998<br />
nur eine 5-jährige Schulpflicht bestand, erst seit 1998,<br />
also seit knapp 10 Jahren, gibt es eine 8-jährige Schulpflicht.<br />
Der größte Teil der klassischen Arbeitsmigranten, wie<br />
jetzt meiner Elterngeneration, die in den 60-er und 70-<br />
er Jahren gekommen sind, haben eine Grundschulbildung<br />
als höchsten Bildungsabschluss. Das heißt, das<br />
sollte uns noch mal zum Denken Anlass geben: was wir<br />
manchmal fordern, wenn wir sagen, die Eltern unterstützen<br />
ihre Kinder zu wenig oder sind zu wenig beteiligt<br />
an deren Bildungslaufbahn. Wie kann eine Mutter, die<br />
selbst nur eine Grundschulbildung hat, mit dem Kind<br />
in der 7. Klasse sitzen und für Mathe oder für Deutsch<br />
lernen? Das wird oft von Sozialpädagogen oder Lehrern<br />
schnell gesagt, hier, die kümmern sich zu wenig, aber<br />
der Bildungshintergrund ist ein Aspekt, den wir mit berücksichtigen<br />
müssen.<br />
Während bei den Vätern vielfach über das Militär noch so<br />
was wie eine elementare Nachsozialisation erfolgt, wenn<br />
sie in den Dörfern wenig oder keine kontinuierliche Schule<br />
hatten, entfällt bei den Frauen zum Teil auch das, da hat<br />
manche zwar eine 5-jährige Grundschule, die aber eventuell<br />
nicht kontinuierlich durchgeführt wurde.<br />
Wir haben vier verschiedene Erziehungsstile abgefragt.<br />
Man stellt fest, dass die türkischen Mütter strenger sind<br />
als die deutschen Mütter. Auf einer Skala von 1 bis 5 ist<br />
der Wert von 1,74 noch ein relativ moderater Wert. Die Unterstützung<br />
durch die türkische Mutter ist etwas geringer,<br />
aber sehr groß sind die Unterschiede bei der Disziplin. Türkische<br />
Mütter wie Väter erwarten stark ein diszipliniertes<br />
Verhalten von ihren Kindern. Das heißt, nach außen soll<br />
das eigene Verhalten und das Verhalten des Kindes ordentlich<br />
und artig sein, den Eltern keinen Ärger machen,<br />
den Besuch artig begrüßen, die Hierarchie einhalten, das<br />
waren wichtige Aspekte für die Eltern.<br />
Wir haben die Jugendlichen selber gefragt, wie sie die elterliche<br />
Erziehung wahrnehmen. Dort stellt man fest, dass<br />
die stärksten Unterschiede bei der Verhaltensdisziplin liegen.<br />
Türkische Jugendliche haben berichtet, dass ihre Eltern<br />
von ihnen ein artiges, ordentliches, diszipliniertes Verhalten<br />
erwarten. Auch hier, die Strenge der Mütter wurde<br />
höher wahrgenommen, die Unterstützung etwas geringer.<br />
Und das ist für alle Eltern jetzt ein Schlag ins Gesicht, wenn<br />
sie die Unterstützungswahrnehmung der Jugendlichen, der<br />
türkischen wie der deutschen, und die Unterstützungsleistung,<br />
die Eltern meinen zu geben, sehen. Eltern meinen,<br />
ihre Kinder deutlich stärker zu unterstützen, als das, was<br />
bei den Jugendlichen ankommt. Das ist bei deutschen und<br />
türkischen Familien gleich.<br />
Wenn man hier jetzt grob zusammenfasst, könnte man<br />
sagen, türkische Familien erziehen dysfunktional. Die<br />
Strenge ist höher ausgeprägt, die Unterstützung ist geringer<br />
ausgeprägt, es gibt eine stärkere Inkonsistenz, d.h.<br />
Unberechenbarkeit. ABER: wir haben bei den Bildungs-<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 131
132<br />
Workshop Pass-genau?<br />
Pass-ganau?<br />
hintergründen gesehen, dass sie sehr asymmetrisch,<br />
sehr schief, waren. Wir haben einen Großteil türkischer<br />
Eltern, die nur eine Grundschulbildung haben, auf der<br />
anderen Seite hatten wir bei den deutschen Vätern 50<br />
% mit Abitur.<br />
Eigentlich sind generell Vergleiche zwischen Deutschen<br />
und Migranten soziologisch nicht korrekt, auch nicht der<br />
Vergleich türkische Jugendliche versus deutsche Jugendliche<br />
im Bereich Jugendgewalt, wie es häufig gemacht<br />
wird. Korrekter wäre der Vergleich deutsche Unterschicht<br />
versus türkische Migranten, denn der größte Teil der türkischen<br />
Familien – das ist meine Hypothese - ist aus der<br />
Unterschicht. Wir haben hier den Vergleich einer Gesamtgesellschaft<br />
mit einer spezifischen Population. Vor diesem<br />
Hintergrund haben wir gefragt: wenn wir die Bildungshintergründe<br />
vergleichen, wie sieht es dann aus?<br />
Wir haben uns die Gruppe angeguckt, die die Hauptschule<br />
als höchsten Bildungshintergrund hat und dann deutsche<br />
Eltern mit Hauptschule und türkische Eltern mit Hauptschule<br />
verglichen. Was sagen die Daten jetzt? Bis auf den<br />
Aspekt der Verhaltensdisziplin, der war sehr robust, also<br />
auch da haben türkische Eltern mehr Disziplin gefordert,<br />
aber in den anderen Dimensionen hat sich das nämlich<br />
umgekehrt. Das heißt, türkische Mütter mit Hauptschule<br />
haben mit weniger Strenge erzogen als deutsche Mütter<br />
mit Hauptschule. Die Unterstützungsleistung der türkischen<br />
Mütter war höher und sie waren konsistenter.<br />
Einen ähnlichen Befund haben wir bei den Vätern. Wenn<br />
man das salopp zusammenfasst, haben türkische Eltern<br />
mit Hauptschulabschluss besser erzogen als deutsche Eltern<br />
mit Hauptschulabschluss.<br />
Eine Erklärung, die wir uns versuchsweise zurechtgelegt<br />
haben, warum das so ist: Gerade wenn Sie bedenken, dass<br />
ein Großteil türkischer Eltern nur fünf Jahre Schulbildung<br />
hat, ein kleiner Teil vielleicht acht Jahre, dann sind zehn<br />
Jahre Schulbildung für türkische Eltern im Vergleich zu<br />
der Referenzgruppe, zu den anderen Türken, schon eine<br />
hohe Bildung. Sie sind bildungsaufsteigend und deutlich<br />
offener in Richtung moderner Orientierung der Erziehung,<br />
während Hauptschule für deutsche Eltern, deren Referenzgruppe<br />
andere deutsche Eltern sind, Bildungsverlierer<br />
sind. Das ist der klassische Unterschied.<br />
Wenn man die Bildungshintergründe parallelisiert, verkehren<br />
sich die Unterschiede. Deshalb müssen wir unsere<br />
Klischees auch dahin gehend revidieren, dass wir prüfen,<br />
ob wir hier angemessene Gruppen vergleichen. Das was<br />
wir vielfach bei Migranten sehen und schnell kulturalisieren,<br />
würden wir in der deutschen Unterschicht sogar in<br />
krasseren Formen sehen. Einige Studien zeigen, dass bei<br />
gleicher Ausgangslage, bei der gleichen Einkommenslage,<br />
Kinder in muslimischen Familien besser versorgt sind,<br />
was die Grundversorgung wie saubere Kleidung, warmes<br />
Essen angeht, als die gleiche soziale Schicht in deutschen<br />
Familien.<br />
Das zeigen auch die Daten: 54 % der türkischen Familien<br />
haben ein Haushaltseinkommen, das zu den untersten<br />
10 % gehört. Dieser Satz ist bei deutschen Familien 7<br />
%. 48 % aller deutschen Familien, aber nur 20 % aller<br />
türkischen Familien haben ein mittleres Haushaltseinkommen.<br />
Also die Armutskonstellation ist wichtig, wenn<br />
wir Familien und deren Erziehungsziele vergleichen wollen,<br />
Migrantenfamilien sind deutlich stärker von Armut<br />
betroffen. Und arme Kinder haben, das zeigen Berechnungen,<br />
ein doppelt so großes Desintegrationsrisiko<br />
wie Kinder in Durchschnittseinkommens-Familien. Das<br />
bedeutet, dass Schullandheimfahrten nicht gewährt<br />
werden, dass angesagte Kleidung nicht gekauft werden<br />
kann, weil sie von Armut deutlich stärker betroffen sind.<br />
Die Auswirkungen von Armut in Bezug auf die Integration<br />
– sind bei armen Kindern doppelt so stark wie bei<br />
Kindern in Familien mit Durchschnittseinkommen in Migrantenhaushalten.<br />
Ein weiteres entwicklungspsychologisches Risiko ist die<br />
hohe Kinderzahl. Die Forschung zeigt, dass bei mehr als<br />
drei Geschwistern die Gefahr besteht, auch wenn der Altersabstand<br />
der Geschwister sehr eng ist, dass ältere<br />
Kinder übersozialisiert werden. Wenn eine Familie ein<br />
3-jähriges, 5-jähriges und ein 1-jähriges Kind hat, dann<br />
ist man geneigt, das 5-jährige Kind als älter und reifer zu<br />
betrachten. Das 1-jährige Kind quäkt mehr und fordert<br />
mehr ein, während das 3-jährige Kind und das 5-jährige<br />
Kind als reifer betrachtet werden. Wäre nur ein Kind da,<br />
käme der 5-Jährige voll auf seine kindlichen Kosten. Die<br />
Gefahr ist in Migrantenfamilien deutlich stärker, weil
dort Familienbildung und Familienwerte relativ schnell<br />
und zügig abgehakt sind. Im Alter von 20 bis 35 ist man<br />
Familie und die Kinder sind dicht beieinander.<br />
Studien zeigen, dass 24 % der deutschen 8-9-jährigen Kinder<br />
Altersabstände zu Geschwistern von unter zwei Jahren<br />
haben, bei Migrantenkindern waren es insgesamt 80 %,<br />
die dicht benachbart auf die Welt kamen. Mit Blick auf die<br />
Adoleszenz zeigt sich, dass bei Kindern, die nahe beieinander<br />
sind, die Adoleszenz spannungsreicher ist, die 14-<br />
bis 16-Jährigen dort haben einfach stärkere Konfliktfelder,<br />
als wenn der Geschwisterabstand größer ist.<br />
TN: Gibt es Erfahrungswerte über die Gewalterfahrungen<br />
von Kindern und Jugendlichen? Erleben türkische Familien<br />
ihre reale Situation als arm, was ja faktisch nach<br />
den Einkommensverhältnissen die Untersuchung gezeigt<br />
hat?<br />
Haci-Halil Uslucan: Zur ersten Frage: Das wäre ein Fachvortrag<br />
für sich, weil unsere Studien nämlich genau<br />
dieser Frage nachgehen, Erziehung und Gewalt. Wir haben<br />
sowohl in Berlin, vorher in Magdeburg, als auch in<br />
der Türkei Studien zu dem Thema Erziehung und Gewalt<br />
durchgeführt. Was sich interessanterweise zeigt, auch<br />
die Gewalttaten, ähnlich bei der Erziehung: wenn man<br />
einfach deutsche und türkische Jugendliche generell vergleicht,<br />
sind türkische Jugendliche deutlich stärker gewaltbelastet.<br />
Wenn man aber wiederum Jugendliche in<br />
Hauptschulen betrachtet, hatten türkische Jugendliche<br />
immer noch höhere Werte, aber das war statistisch nicht<br />
bedeutsam, weil wir sehr viel mehr türkische Jugendliche<br />
als deutsche auf Hauptschulen haben.<br />
Die Gewalttaten in Hauptschulen sind generell höher als in<br />
Gymnasien. Da unterscheiden sich Türken von Deutschen,<br />
was die aktive Gewalttat betrifft, nicht groß. Wo es aber in<br />
der Tat große Unterschiede gibt, das ist die Akzeptanz von<br />
Gewalt, Akzeptanz von Männlichkeitsideologien, dass sich<br />
ein Mann zur Not mit Gewalt wehren muss, dass es richtig<br />
ist, dem anderen zu zeigen, wo es langgeht, wenn der über<br />
die Stränge schlägt. Also solche gewalttätigen Ideologien,<br />
da war die Akzeptanz bei türkischen Jugendlichen (?) deutlich<br />
stärker.<br />
Was die häusliche Gewalt betrifft: Wir haben auch die Eltern<br />
nach eigenen Gewalterfahrungen durch ihre Eltern<br />
gefragt, also quasi über drei Generationen hinweg. Es hat<br />
sich gezeigt, dass mütterliche Integration ein ganz wichtiger<br />
Aspekt war, ob die von den Müttern in ihrer eigenen<br />
Kindheit erfahrenen Gewalt weitergegeben wird oder<br />
nicht. Mütter, die gut integriert waren, haben viel weniger<br />
Gewalt weitergegeben. Eine Studie, die wir in der Türkei<br />
durchgeführt und mit einer ostdeutschen Stichprobe verglichen<br />
haben, hat gezeigt, dass die Jugendlichen in der<br />
Türkei zwar höhere Werte von Familiengewalt angegeben<br />
haben, also dass ihre Eltern sie stärker diszipliniert haben,<br />
zugleich aber das Klima in der Familie besser eingeschätzt<br />
haben als die ostdeutschen Jugendlichen. Das bedeutet:<br />
herrscht in deutschen Familien Gewalt vor, ist die<br />
Eltern-Kind-Beziehung deutlich stärker belastet. Während<br />
Gewalt in einigen türkischen Familien Teil des Erziehungsauftrages<br />
der Eltern zu sein scheint. Gewalttätiges Verhalten<br />
der Eltern produziert dort nicht unbedingt ein Gefühl,<br />
dass man sich abgelehnt oder entwertet fühlt, sondern die<br />
Eltern erziehen eben.<br />
TN: Es ging um die Reaktion der Eltern auf auffälliges Verhalten.<br />
Der Jugendliche wird von der Polizei nach Hause<br />
gebracht, er ist bei Dealerei oder Hehlerei erwischt worden,<br />
wie ist die Reaktion der Eltern türkischer oder deutscher<br />
Herkunft?<br />
Haci-Halil Uslucan: Einzelfälle haben wir nicht abgefragt,<br />
aber aus meiner Erfahrung ist die Reaktion schon mal geschlechtsspezifisch,<br />
bei Jungen anders als bei Mädchen.<br />
Bei Mädchen wäre die Reaktion deutlich stärker und intervenierender.<br />
Bei den Jungen könnte man noch mal differenzieren,<br />
ob es ein Teil der jugendlichen Sozialisation ist,<br />
z.B. bei einer Prügelei, wo man sagen könnte, er probiert<br />
sich als Mann aus. Diebstahl, Drogen, da ist die Reaktion<br />
der Eltern zum Teil sehr massiv, also auch ihrerseits mehr<br />
mit Gewalt verbunden, was die Gewalt von Jugendlichen<br />
natürlich noch verstärkt.<br />
Noch zur Frage der Armut. Ich glaube, die ist nicht eindeutig<br />
zu beantworten. Ein Teil der Eltern sagt: Trotz Sozialhilfe<br />
leben wir hier in Deutschland besser, weil in irgendeiner<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 133
134<br />
Workshop Pass-genau?<br />
Pass-ganau?<br />
Weise die Grundversorgung abgesichert ist. Andererseits<br />
kenne ich aus dem türkischen Kontext auch viele Eltern,<br />
die sich jetzt – nach langjähriger Arbeitslosigkeit – fragen,<br />
ob es sich lohnt in Deutschland zu bleiben, nur um<br />
am Leben zu bleiben, und die dann auch zurückkehren.<br />
Wenn sie hier keine Perspektive haben, gehen sie auch<br />
zurück, weil irgendwie durchs Leben kommen sie auch in<br />
der Türkei. Aber das ist sehr stark herkunftsbedingt, aus<br />
welchen Konstellationen sie kommen, sind sie Flüchtlinge,<br />
können sie überhaupt zurück, welche Perspektiven haben<br />
sie, wenn sie zurückgehen?<br />
TN: Gibt es Untersuchungen oder Erkenntnisse darüber,<br />
welche Rolle bei der Integration das Internet spielt, also<br />
die selbstverständliche Nutzung, Zugang eines Bildungsmittels<br />
für Pubertierende, aber auch für Eltern?<br />
Haci-Halil Uslucan: Wir haben das so nicht gefragt. Ich<br />
glaube, es gibt eine Studie an der Uni Potsdam, über das<br />
Mediennutzungsverhalten von Migranten, 2000/2001,<br />
Fernsehen, Internet. Die wurde auch mit türkischen Migranten<br />
durchgeführt. Aus meiner eigenen Erfahrung kann<br />
ich sagen, dass da die Haltung der Eltern sehr gespalten<br />
ist. Einerseits weil sie aus ihrer Sicht nicht kompetent genug<br />
sind, die Kinder sich also alles angucken und runterladen,<br />
wovon die Eltern meinen, es sei wichtig für die Schule.<br />
Aber sie können nicht kontrollieren, was ihre Kinder<br />
anschauen, auf welche Seiten sie gehen. Sie sind nicht in<br />
der Lage, Filter einzubauen.<br />
Was in der türkischen Community die Runde macht - vielleicht<br />
ist es in der arabischen Community ähnlich - dass<br />
sehr viele Mädchen aus stark behüteten und konservativen<br />
Elternhäusern über Internet-Foren irgendwelche Bekanntschaften<br />
machen und dann ausreißen. Die Eltern fallen<br />
dann aus allen Wolken, weil sie ihre Töchter stark behütet<br />
haben aufwachsen lassen: statt was für die Schule zu machen,<br />
haben sie Bekanntschaften im Internet gemacht und<br />
waren dann weg. Das sind zwar Einzelberichte, aber das ist<br />
die andere Seite der Internetnutzung. Die Eltern sind vielfach<br />
medial nicht kompetent genug, um der Internetnutzung<br />
Grenzen zu setzen oder sie zu kontrollieren. Das wird<br />
wahrscheinlich bei den deutschen Eltern genauso sein.<br />
TN: Ich denke auch, dass Eltern-Kind-Beziehungen sich<br />
verschoben haben. Der Vater fühlt sich reduziert auf<br />
nichts, überhaupt die Eltern. Die Jugendlichen sind den<br />
Eltern gegenüber, was Internet und Zugang angeht, natürlich<br />
weitaus überlegen. Diese Überlegenheit spielt in Konflikten<br />
eine große Rolle.<br />
Haci-Halil Uslucan: Das ist ein kritischer Punkt in der Erziehung.<br />
Die Kinder werden zu Eltern ihrer Eltern. Sie müssen<br />
sie in diese Gesellschaft hineinsozialisieren. Da kehrt<br />
sich genau diese traditionelle Form der Hierarchie, dass<br />
Kinder nach oben gucken zu ihren Eltern, plötzlich um.<br />
Was erfahren die Kinder? Sie erfahren, dass ihre Eltern<br />
Angst haben bzw. sie erleben sie als ohnmächtig. Nicht die<br />
Mutti zeigt, wo es langgeht, sondern man muss der Mutter<br />
zeigen, wo es langgeht. Und sie sind dann als Eltern ihrerseits<br />
nicht mehr souverän, sondern abhängig – bis zur<br />
Erpressung. Wenn ich abhängig bin, dann kann ich nicht<br />
mehr souverän erziehen.<br />
Das ist eine starke Überforderung für die Kinder. Sie kommen<br />
manchmal mit 11 oder 12 in einen problematischen<br />
Kontext, wenn Kinder zum Beispiel Übersetzerdienste<br />
beim Frauenarzt machen müssen. Das betrifft einmal die<br />
Schamgrenze der Eltern, aber gleichzeitig sind sie abhängig<br />
und hilflos. Das sind Aspekte, die die Erziehung noch<br />
erschweren.<br />
TN: Sie sagten, Sie haben eine empirische Studie fürs Bundesministerium<br />
gemacht. Ist die irgendwie zugänglich?<br />
Haci-Halil Uslucan: Sie haben Teile davon veröffentlicht,<br />
die im Internet zugänglich sind. Ich habe selbst in einigen<br />
Fachzeitschriften veröffentlicht.<br />
Haroun Sweis: Bevor ich auf das Medienverhalten der<br />
arabischen Welt eingehe, möchte ich darauf hinweisen,<br />
dass man die arabische Welt und islamische Welt nicht<br />
verwechseln sollte. Wenn ich jetzt von Arabern spreche,<br />
dann meine ich Menschen aus den 22 arabischen Staaten,<br />
die in der Arabischen Liga sind – und sonst nichts. Die<br />
islamische Welt ist anders als die arabische Welt. Es sind<br />
nicht alle Araber Moslems, sondern in bestimmten ara-
ischen Ländern, wie im Libanon, da sind 50 % Christen<br />
und 50 % Moslems, bei den Palästinensern sind zwischen<br />
10 und 15 % Christen, in Tunesien zum Beispiel gibt es<br />
eine größere Gruppe von Juden. Soweit als Einstieg.<br />
Man schätzt die Zahl der Araber in Berlin zwischen 40.000<br />
und 60.000. Diese Zahlen sind unterschiedlich zu lesen.<br />
Dazu zählen auch die staatenlosen Palästinenser bzw.<br />
Menschen, die einen ungeklärten Aufenthaltsstatus haben<br />
oder Menschen, die staatenlos sind oder die gar nicht<br />
arabisch sprechen. Wenn man diese alle nicht dazu zählt,<br />
ergibt sich eine kleinere Zahl.<br />
Es gibt vier Gruppen von Arabern in Deutschland bzw. in<br />
Berlin. Früher waren es drei Gruppen, seitdem Berlin die<br />
Hauptstadt ist, ist eine Gruppe dazugekommen. Mit der<br />
fange ich an, das ist die Gruppe der Botschafter bzw. die<br />
Angehörigen der Botschaften in Berlin. 22 arabische Staaten<br />
sind mit 22 Botschaften vertreten, dazu 22 Familien<br />
und Mitarbeiter. Die haben kaum Kontakte zu den Arabern<br />
in der Stadt, außer bei einem Empfang, aber da werden<br />
nur spezielle Leute eingeladen.<br />
Die zweite Gruppe, die von Anfang an in Deutschland war,<br />
das sind die Studenten und Intellektuellen. Die Ersten<br />
sind direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen, in<br />
den 50-er und 60-er Jahren. Diese Gruppe hatte bis zum<br />
Anfang der 90-er Jahre auch kaum Kontakte zu anderen<br />
Arabern in der Stadt oder in Deutschland. Die sind meistens<br />
mit Deutschen verheiratet, meistens sind männliche<br />
Studenten gekommen, haben Kinder, die Kinder sprechen<br />
kaum oder gar nicht Arabisch. Viele von denen lassen sich<br />
auch scheiden und heiraten eine neue Frau aus dem arabischen<br />
Milieu, das entstanden ist.<br />
Die dritte Gruppe ist die Gruppe, die damals, Anfang der<br />
70-er Jahre, als Vertragsarbeiter gekommen sind. Das<br />
sind meistens Tunesier, Marokkaner und Algerier. Diese<br />
Gruppe ist in Berlin sehr wenig vertreten, aber in Nordrhein-Westfalen,<br />
im Süden, wo die Autoindustrie ist, sind<br />
ziemlich viele aus Tunesien, auch in der Gastronomie, das<br />
ist eine große Gruppe.<br />
Die vierte Gruppe sind die Asylbewerber, die während<br />
des Libanon-Kriegs in Massen nach Deutschland gekommen<br />
sind. Damals über Ost-Berlin, weil man für Ost-Berlin<br />
kein Visum brauchte, sie sind über die Friedrichstraße in<br />
West-Berlin gelandet. Das ist die größte Gruppe. Das sind<br />
Libanesen, Palästinenser und ein Teil Kurden aus dem<br />
Libanon, von denen viele ursprünglich eigentlich aus der<br />
Türkei stammen, die sich hier aber als Libanesen ausgegeben<br />
haben. Man hat gehört, dass sie erwischt wurden und<br />
man sie in die Türkei abschieben wollte oder abgeschoben<br />
hat, obwohl die Kinder noch nie in der Türkei waren.<br />
Das sind die vier Gruppen, die früher nichts miteinander<br />
zu tun hatten. In den letzten Jahren gibt es untereinander<br />
Kontakte, aber – das ist das Verhalten der Araber<br />
– was das Fernsehen, Internet und Zeitungen betrifft,<br />
diese Menschen, die aus dem Libanon gekommen sind,<br />
also hier in Berlin sind das ca. 40.000 Asylbewerber, sind<br />
im Allgemeinen alle Analphabeten. Die Älteren sind ohne<br />
Schule aufgewachsen, viele Palästinenser sind im Flüchtlingslager<br />
aufgewachsen und haben auch keine Schulbildung.<br />
Es gibt dort das System der Grundschule bis zur 6.<br />
Klasse, aber im Allgemeinen ist kaum einer in die Schule<br />
gegangen, weil sie arbeiten mussten, um die Familie zu<br />
ernähren.<br />
Dann kommen wir auf die Zahl der Kinder. 6 Kinder, das<br />
ist nichts, im Allgemeinen sind es zwischen 10 und 15 Kinder.<br />
Ich bin nicht selbst im Flüchtlingslager aufgewachsen,<br />
aber ich bin in eine Schule in Jordanien gegangen, eine<br />
Unesco-Schule. Wir waren 14 Kinder.<br />
Diese Menschen haben in der Regel keine Ausbildung. Sie<br />
kamen nach Deutschland und haben versucht, hier Fuß zu<br />
fassen. Wenn man sich an die alten Gesetze in Deutschland<br />
aus den 70-er und 80-er Jahren erinnert, die Eltern<br />
mussten damals nicht zur Schule gehen und Deutsch lernen,<br />
auch die Kinder mussten nicht zur Schule gehen. So<br />
entstanden diese Generationen, die wir hier auf der Straße<br />
erleben. Die Leute sprechen deutsch, weil sie es auf<br />
der Straße gelernt haben, aber sie haben Schulbildung,<br />
manche können weder deutsch noch arabisch.<br />
Anfang der 80-er Jahre kamen für diese Menschen die<br />
sogenannten arabischen Fernsehsatelliten. Das erste Programm<br />
hieß Al Dschasira, was jeder mittlerweile kennt,<br />
der Vorreiter war ein BBC-Sender Arabic Service Fernsehen.<br />
Das wurde auch über Satellit ausgestrahlt, aber das<br />
hat kaum einer angeschaut. Das war eine Zusammenarbeit<br />
zwischen der BBC London und Saudi-Arabien, aber<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 135
136<br />
Workshop Pass-genau?<br />
Pass-ganau?<br />
ich glaube, die lief nur ein halbes Jahr. Al Dschasira war<br />
für die Araber war das etwas Besonderes. Zum ersten Mal<br />
hört man 24 Stunden Nachrichten, und zwar die Nachrichten,<br />
die man vorher nie gesehen oder gehört hatte,<br />
Live-Schaltungen, alles mögliche. Nach meiner Information<br />
sind es mittlerweile zwischen 400 und 600 arabische<br />
Fernsehsender, die auch in Berlin und weltweit zu empfangen<br />
sind.<br />
Vom Inhalt her: Es gibt keinen einzigen arabischen Sender,<br />
der unabhängig ist. Al Dschasira wird niemals einen<br />
negativen Bericht über Katar senden. Alles andere wird<br />
gesendet, aber über das Land, von dem die Finanzierung<br />
kommt, wird nichts laut, außer natürlich was gut ist. Die<br />
anderen Nachrichtensender sind ähnlich. In Saudi-Arabien<br />
gibt es Al Arabia mittlerweile, das ist auch bekannt, Al<br />
Manar von Hisbollah, Hamas hat inzwischen vier Sender,<br />
einer der bekanntesten ist Al Aksa. Das sind die Nachrichtensender.<br />
Dann kommt die Unterhaltung. Die meisten<br />
Sender sind Unterhaltungssender. Es gibt Sender,<br />
die 24 Stunden senden, Hokuspokus, Telefonnummern<br />
von Frauen, Heiratsanzeigen, aber auch Musik, MTV gibt<br />
es mittlerweile auch in Arabisch. Aber die Unterhaltungssender<br />
werden am meisten eingeschaltet. In den letzten<br />
Jahren laufen auch in Berlin pausenlos die Sender. Ich bin<br />
noch nie in eine Wohnung gekommen, wo der Fernseher<br />
aus war und ich habe noch nie eine arabische Familie gesehen,<br />
die ein deutsches Programm eingeschaltet hatte,<br />
niemals. Bei den Intellektuellen guckt mal die Ehefrau,<br />
weil die Kinder kein Arabisch sprechen, aber bei diesen<br />
Familien läuft das Fernsehen Tag und Nacht. Bei den Männern<br />
ist es meistens Al Aksa. Mittlerweile gibt es auch zwei<br />
voll amerikanisch finanzierte Sattelitenfernsehprogramme<br />
aus dem Irak.<br />
TN: Was ist mit Sportübertragungen?<br />
Haroun Sweis: Es gibt auf Arabisch sechs oder sieben<br />
Sportkanäle, ich habe sie noch nie angeguckt.<br />
TN: Ich meine, ob sie hiesige Sportarten angucken, Fußball-Europameisterschaft?<br />
Haroun Sweis: Doch, solche Ereignisse wie die Weltmeisterschaft,<br />
obwohl viele auch die arabischen Sender einschalten,<br />
weil die das dort umsonst senden. Mein Sohn<br />
ist 12, der guckt sehr viel Sport im deutschen Programm,<br />
aber er weiß, wo Sport in den arabischen Sendern ausgestrahlt<br />
wird, weil die auch Spiele wie Hamburg gegen<br />
Bremen live senden. Insofern brauchen sie es nicht live im<br />
deutschen Fernsehen anzuschauen.<br />
Das Verhalten von Frauen und Männern, was die Medien<br />
betrifft: Im Allgemeinen gucken Männer und Jungens diese<br />
Nachrichtensender, Frauen sehen mehr die Serien.<br />
Mittlerweile sind die türkischen Fernsehserien sehr bekannt,<br />
und zwar dadurch, dass viele Männer und Frauen<br />
sich scheiden lassen wollen. In einer türkischen Serie hat<br />
die Frau die Macht, sich scheiden lassen, weil es offiziell<br />
erlaubt ist, sich über Handy scheiden zu lassen.<br />
Noch wichtiger sind aber die Nachrichten. Das ist eigentlich,<br />
was wichtig für uns in Deutschland oder in Berlin<br />
ist. Es gibt Sender wie 24 Stunden, in denen nicht nur<br />
gezeigt wird, dass jemand den anderen geschlagen hat<br />
oder jemand gestritten hat. Sondern es wird detailliert<br />
gezeigt, wie Menschen mit dem Messer geschlachtet<br />
werden, wie einem lebendigen Menschen mit der Bohrmaschine<br />
in den Kopf Löcher gebohrt werden. Also ich<br />
habe diesen Sender mittlerweile gelöscht, weil ich das<br />
nicht sehen konnte. Das war 24 Stunden. Viele Jugendliche<br />
schauen sich diesen Sender an. Aber auch im<br />
normalen Programm wird Brutalität gezeigt. Da gibt es<br />
vielleicht nicht diese Bilder mit der Bohrmaschine, aber<br />
zumindest die Leichenteile.<br />
Vorgestern war ein israelischer Angriff auf Gaza, bei dem<br />
6 Menschen umgekommen sind. Die Leute wollten, dass<br />
Hamas und 24-Stunden die ganzen Leichen zeigen. Viele<br />
Jugendliche bzw. deren Eltern gucken sich das an. Mit<br />
diesen Bildern gehen die Kinder am nächsten Tag in die<br />
Schule.<br />
Das ist ihr Medienverhalten. Was in den deutschen Medien<br />
gezeigt wird, wissen die Älteren gar nicht. Sie kontrollieren<br />
gar nicht mehr, weil sie Analphabeten sind und<br />
die Kinder zu Hause das anschauen was sie wollen. Wenn<br />
sie überhaupt zu Hause sind, denn bei der Kinderanzahl<br />
werden die Kinder meistens auf die Straße geschickt, da-
mit die Eltern ihre Ruhe haben oder die Mutter mit ihren<br />
Freundinnen Kaffee trinken kann. Es werden auch oft kleine<br />
Kinder auf die Straße geschickt, um in der 2-, 3- oder<br />
4-Zimmer-Wohnung Ruhe zu haben.<br />
Zu dem Thema, dass die Leute kein deutsches Programm<br />
sehen - ich habe mal einen Versuch gemacht: jeder kennt<br />
die Moderatorin Eva Herman. Über sie wurde im Fernsehen<br />
eine kleine Geschichte zeigt. Diese Frau ist mittlerweile<br />
in der arabischen Welt bekannter als Merkel. Bei jedem<br />
Anruf aus dem Ausland fragen mich die Leute, ob ich diese<br />
Frau kenne. Das zeigt, dass die Leute das arabische Programm<br />
sehen und kein deutsches Programm.<br />
Ich habe noch ein Beispiel: Wir waren damals in der Rütli-<br />
Schule, waren zufällig in der Sonnenallee und dort kam<br />
jemand zu mir und machte mich an, dass ich bei Radio<br />
Multikulti falsche Nachrichten verbreite, indem ich erzählt<br />
habe, dass die Rütli-Schule zu ist bzw. die Polizei vor der<br />
Tür steht, weil das nicht stimmen würde, weil sein Sohn in<br />
diese Schule geht. Ich sagte, aber die Schule ist zu und die<br />
Polizei ist da. Ach, meinte er, komm, arabische Nachrichten<br />
sind wohl immer falsch. Plötzlich ruft der Sohn an. Da<br />
musste der zugeben, dass er gar nicht in der Schule war,<br />
sondern mit Freunden woanders war. Also auch von der<br />
Seite haben die nicht mitgekriegt, dass die Schule überhaupt<br />
geschlossen ist, obwohl die Medien darüber berichtet<br />
haben. Auf der anderen Seite, es gibt für die Araber<br />
in der Stadt oder in Deutschland keine Möglichkeit, Nachrichten<br />
in Arabisch zu lesen oder zu hören, außer bei den<br />
arabischen Sendern, die wenig über Deutschland berichten.<br />
In Berlin oder in Deutschland gibt es keine einzige arabische<br />
Zeitung. Es gibt zwei oder drei Anzeigenzeitungen,<br />
aber darin sind keine Artikel zu lesen. Radio Multikulti gibt<br />
es auch nur noch bis Ende des Jahres, danach gibt es das<br />
auch nicht mehr.<br />
Von der deutschen Behörde gibt es auch arabisches Radio<br />
und Fernsehen, aber das ist eher ins Ausland gerichtet,<br />
die bringen kaum Nachrichten über Deutschland oder das<br />
Verhalten der Araber.<br />
Was das Internet betrifft, die Araber, die Arabisch lesen<br />
und schreiben können, lesen mehr arabisches Internet als<br />
deutsches Internet, weil sie kaum Deutsch gelernt haben,<br />
seit sie damals vor 20 oder 30 Jahren hierher gekommen<br />
sind. Im Internet gibt es eine Reihe von Organisationen<br />
mit eigenen Auftritten. Die werden gelesen und auch interaktiv<br />
benutzt. Die Kommentare, die man da lesen kann,<br />
besonders aus Berlin, sind meistens erschreckend, weil<br />
die kommentieren als würden sie nicht in Deutschland leben,<br />
sondern in dem jeweiligen Land. Was sie hier in 20<br />
oder 30 Jahren erlebt haben, spielt anscheinend keine<br />
Rolle. Ähnlich ist das bei den Fernsehsendern, bei denen<br />
die Menschen anrufen können. Es sind sehr viele Anrufe<br />
aus Deutschland dabei und besonders aus Berlin. Mittlerweile<br />
kenne ich fast alle mit Namen, die da anrufen, aber<br />
ich kenne viele auch persönlich. Und die sprechen, denke<br />
ich, genau das Gegenteil von dem, was sie in Deutschland<br />
oder in Berlin sagen, wenn man sie in der Öffentlichkeit,<br />
also auf Veranstaltungen sieht oder hört, sind die anders,<br />
als wenn man die im Fernsehen arabisch hört. Das ist wie<br />
eine Identitätsspaltung. Das ist wie eine, also politisch gesehen<br />
sind die anders, gesellschaftlich sind die anders,<br />
lehnen vieles ab, werfen den Deutschen vor, keine Moral<br />
zu haben und ihre Kinder vernichten zu wollen. Sie wollen<br />
ihre Kinder nicht kaputtmachen lassen, deswegen isolieren<br />
sie sich in ihren Wohnvierteln an der Sonnenallee in<br />
Neukölln, Kreuzberg oder Wedding oder in Kreuzberg. Und<br />
sie leben so sehr in ihrer Welt, dass sie mittlerweile an<br />
der Sonnenallee nicht mehr in Euro bezahlen sondern in<br />
Lira. Sie wissen, wie teuer 1 Kilo Tomaten im Libanon ist,<br />
aber nicht, was es bei Karstadt oder in einem deutschen<br />
Land kostet.<br />
TN:: Ich arbeite im Wedding, da ist es anders, viel gemischter<br />
und überhaupt nicht so stringent. In unserem<br />
Nachbarschaftshaus sind sehr viele arabische Familien,<br />
die nicht zu den Intellektuellen von der Unis gehören,<br />
sondern die eigentlich in den Wohnhäusern drumherum<br />
wohnen, sehr viele kommen aus den Flüchtlingslagern<br />
im Libanon oder Palästinenser sind über den Libanon bis<br />
hierher geflüchtet, wo zum Beispiel der Bildungsstand, die<br />
Voraussetzungen, völlig unterschiedlich sind. Es gibt gut<br />
ausgebildete Frauen, zum Beispiel aus dem Irak, auch Palästinenserinnen.<br />
Haroun Sweis: Aber die kriegen keine Arbeit.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 137
138<br />
Workshop Pass-genau?<br />
Pass-ganau?<br />
TN: Ja, keine Arbeit, aber sie können lesen, schreiben,<br />
haben zum Teil auch gute Ausbildungen, aber<br />
arbeiten hier immer unterhalb ihrer Ausbildung. Sie<br />
haben den Hintergrund und das Interesse, ihre Kinder<br />
z.B. bei Hausaufgaben zu unterstützen. Es gibt auch<br />
Frauen, die sehr gut Deutsch können, gerade aus den<br />
muslimischen Kreisen. Ich habe da total andere Erfahrungen.<br />
Haroun Sweis: Natürlich gibt es viele gut ausgebildete Palästinenser,<br />
von denen habe ich nicht geredet. Das sind<br />
die, die auch wollen, dass ihre Kinder vielleicht deutsches<br />
Fernseh-Programm gucken. Ich habe von der Gruppe geredet,<br />
die wirklich nichts anderes tun als zu arbeiten oder<br />
sie kriegen Hartz-IV.<br />
TN: Das sind aber nicht die Intellektuellen.<br />
Haroun Sweis: Nein, nein. Die haben aber woanders<br />
studiert. Aber das ist eine Minderheit. Selbst wenn die<br />
Jugendlichen bzw. Kinder von ihnen im Jugendtreff ein<br />
deutsches Programm sehen, zu Hause sehen sie arabische<br />
Programme.<br />
TN: Das ist widersprüchlich, aber diese Einordnung fand<br />
ich jetzt nicht so passend.<br />
Haroun Sweis: Zum Beispiel kenne ich Leute, die haben<br />
im Libanon studiert, viele Frauen vor allem, Biologie und<br />
so was, die sind seit 10 oder 15 Jahren hier und haben<br />
noch nie in dem Beruf gearbeitet. Aber die haben Kinder<br />
und die Kinder sind sehr gut, weil die Eltern mit den Kindern<br />
auch arabisch sprechen, also sie erklären Dinge auf<br />
Arabisch. Aber das sind Ausnahmen, die dort als Lehrer<br />
oder Mediziner ausgebildet sind. Wobei zum Beispiel bei<br />
Medizinern die Zeugnisse hier nicht anerkannt werden,<br />
so müssen sie als 1-Euro-Jobber arbeiten, aber trotzdem<br />
sind sie gut ausgebildet.<br />
Das ist eine Gruppe für sich alleine, die versucht auch viel<br />
in der Stadt zu machen, die sind zum Beispiel im Wedding<br />
besonders stark vertreten.<br />
TN: Aber die Mehrheit kommt aus dem Libanon, aus dem<br />
Flüchtlingslager, die haben ein anderes Leben. Ich sehe<br />
auch den Unterschied zwischen den Leuten aus Syrien<br />
oder dem Iran oder Jordanien, das ist jeweils eine andere<br />
Kultur.<br />
Haroun Sweis: Die meisten Palästinenser sind aus dem Libanon.<br />
Sie durften aber dort nicht arbeiten, denn im Libanon<br />
sind für Palästinenser 94 Berufe verboten. Das heißt,<br />
jemand, der dort gelernt hat oder einen Uni-Abschluss<br />
gemacht hat, hat nur im Flüchtlingslager eine Arbeitserlaubnis.<br />
Auch als Mediziner, obwohl im Libanon Mediziner<br />
gesucht werden. Im Flüchtlingslager gibt es einen einzigen<br />
Arbeitgeber, das ist die UNRA (United Nations Relief and<br />
Rehabilitation Administration).<br />
Und was das Internet betrifft, da gibt es mittlerweile Jugendliche,<br />
die auch auf deutsche Seiten gehen, die lesen<br />
und schreiben können. Da gibt es plötzlich ganz andere<br />
Verhaltensnormen, Männer und Frauen chatten miteinander,<br />
verabreden sich für den nächsten Tag über SMS, ohne<br />
dass der Vater gefragt wird usw. Das ist ein sehr konfliktträchtiges<br />
Feld.<br />
Herbert Scherer: Das Ganze interessiert uns wegen der<br />
Frage, wie wir damit umgehen. Im Augenblick kriegen wir<br />
Einblicke, aber die Praxis-Dimension fehlt noch. Bevor wir<br />
uns der Frage zuwenden, wie wir mit diesen teilweise neuen<br />
Erkenntnissen umgehen, hören wir noch einen dritten<br />
Einblick und zwar in Bereiche, die ganz besonders schwierig<br />
sind. Jugoslawien ist ja ein Land, das es nicht mehr gibt,<br />
und Bürgerkriege haben die ehemalige Republik abgelöst.<br />
Die Menschen aus Ex-Jugoslawien sind zum Teil hierher<br />
gekommen und bringen noch recht frische traumatisierende<br />
Erfahrungen mit. Es gibt eine Gruppe, die verstärkt<br />
– auch in Berlin – auftaucht und mit der es besondere<br />
kulturelle Kommunikationsprobleme zu geben scheint,<br />
die Roma aus Jugoslawien, ich weiß nicht, ob sie auch<br />
aus anderen Ländern kommen. Das Nachbarschaftshaus<br />
Prinzenallee, heute integriert in die Osloer Straße, hat seit<br />
einigen Jahren Erfahrungen mit dieser Gruppe, die im Soldiner<br />
Kiez besonders präsent ist, aber auch in anderen<br />
Stadtteilen Berlins.
Petra Kindermann: Vor vier Jahren haben wir ein Integrations-Projekt<br />
angefangen. Vor einem Jahr wurde das<br />
abgeschlossen und wir haben es ein bisschen umgewandelt<br />
in einen Treffpunkt. Der Treffpunkt nennt sich B.I.S.I.,<br />
Beratung, Information, Selbsthilfe und Integration. Das ist<br />
eine Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten aus dem<br />
Berliner Soldiner Kiez.<br />
Unser Thema heute sind die Roma-Familien, die meine<br />
Kollegin Svetlana Krabel betreut, zusammen mit dem Kollegen<br />
Petrovic, der heute leider nicht da ist, selber Roma<br />
und Schul-Mediator, der diese Ausbildung hier bei der RAA<br />
gemacht hat.<br />
Unsere Arbeit ist sehr auf Schulen bezogen. Wir unterstützen<br />
Familien in ihrem Kontakt und Dialog mit Schulen,<br />
aber auch mit Behörden und geben Unterstützung in ganz<br />
allgemeinen sozialen Problemen, die die Familien haben.<br />
Die Schwerpunkte in der Arbeit mit den Schulen liegen<br />
zum einen in der Teilnahme an Elternabenden oder Elternversammlungen,<br />
bei denen wir bei Bedarf sowohl sprachlich<br />
als auch vermittelnd auf Gespräche oder eventuelle<br />
Auseinandersetzungen einwirken.<br />
Zum anderen melden sich Schulen aber auch bei uns, die<br />
Einzelgespräche suchen oder um sich auf konkrete Hilfekonferenzen<br />
für einen Schüler vorzubereiten, mit dem es<br />
Probleme gibt. Da werden wir dann eingeladen. Es melden<br />
sich aber auch Kitas und Schulen bei uns, die uns als Vermittler<br />
nutzen, um Kontakt zu den Familien zu bekommen,<br />
die auf Anfragen der Schulen oder Kitas nicht reagiert haben.<br />
Im Laufe des Projekts wird immer deutlicher, dass diese<br />
Hilfen von den Eltern, besonders von den Müttern, immer<br />
gerne angenommen wurden, und diese Hilfe auch dann<br />
die Grundlage war, um das Gespräch mit den Schulen aufzunehmen.<br />
In den letzten zwei Jahren haben wir starken Zulauf von<br />
Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. So waren im<br />
letzten Projektjahr ungefähr 45 % der Hilfesuchenden aus<br />
Ex-Jugoslawien, ca. 30 % türkische und 25 % arabische<br />
Familien.<br />
Die Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien, die zu uns<br />
kommen, sind zu 80 % bosnischer Herkunft, sehr häufig<br />
mit Roma-Migrationshintergrund, und zu 20 % Kosovo-<br />
Albaner und Makedonier. Der Bedarf an Beratung und<br />
Unterstützung bei Roma- Familien ist sehr groß und die<br />
Schule ist häufig ein Konfliktfeld.<br />
Was sind die geschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergründe<br />
für die Schulproblematik vieler Roma-Familien?<br />
Nach unterschiedlichen Schätzungen leben zwischen 8<br />
bis 10 Millionen Sinti und Roma auf diesem Kontinent,<br />
rund drei Viertel in den Ländern Mittel-, Ost- und Südosteuropas.<br />
Dabei steht „Sinti“ für die mitteleuropäischen<br />
Gruppen und „Roma“ als Sammelname für Gruppen überwiegend<br />
südosteuropäischer Länder. Damit sind sie die<br />
größte ethnische Minderheit. Die Menschen sind so verschieden<br />
wie ihre Herkunftsländer und ihre individuellen<br />
Lebensgeschichten. Gemeinsam ist ihnen, dass sie als sogenannte<br />
„Zigeuner“ (Roma und Sinti) seit Jahrhunderten<br />
verfolgt und im besten Fall in allen Ländern nur geduldet<br />
sind. Eine halbe Million Sinti und Roma wurden im Zweiten<br />
Weltkrieg in den Konzentrationslagern ermordet. Das nur<br />
als Hintergrund der Probleme.<br />
Mit dem Zusammenwachsen Europas seit 1989 waren erneut<br />
die Roma die größten Verlierer dieser Entwicklung.<br />
Sie wurden überall zum Sündenbock für negative Entwicklungen.<br />
An vielen Orten brach offener Hass aus. Während<br />
der Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien<br />
gerieten Roma zwischen die Fronten, die beteiligten Parteien<br />
rekrutierten unter Gewaltanwendung in den Roma-<br />
Dörfern Soldaten. Überall wurden Roma an den untersten<br />
Rand der Gesellschaft gedrängt. Der Europarat hat auf diese<br />
Entwicklung 1993 mit einer Resolution hingewiesen,<br />
in der Roma/Sinti als „Echte europäische Minderheit“ anerkannt<br />
sind.<br />
Der offene Hass, von dem ich sprach, da erinnern sich<br />
bestimmt viele an die Roma, die durch Brandstiftung an<br />
den Wohnwagen vertrieben wurden. Dann gab es eine Geschichte<br />
in Italien, nach einem Mord an einer Italienerin<br />
durch einen rumänischen Roma sollten erst alle rumänischen<br />
Roma abgeschoben werden.<br />
In Deutschland leben etwa 70.000 Sinti und Roma – aus<br />
ihrer Geschichte heraus - mit deutschem Pass. Ungeachtet<br />
ihrer 600-jährigen Geschichte in Deutschland und ihrer<br />
Anerkennung als nationale Minderheit werden Sinti und<br />
Roma zum überwiegenden Teil als Ausländer wahrgenom-<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 139
140<br />
Workshop Pass-genau?<br />
Pass-ganau?<br />
men. Bis heute hat diese Gruppe keine gesellschaftliche<br />
Lobby zur Unterstützung ihrer Kämpfe gefunden. Und<br />
erst durch die Selbstorganisation der Roma und Sinti<br />
Ende der 70-er Jahre begannen diese Strukturen aufzubrechen.<br />
Es leben etwa 50.000 Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien<br />
seit mehr als 15 Jahren hier und ihre Kinder sind<br />
zum Teil hier geboren. Das ist die Gruppe, mit der meine<br />
Kollegin am stärksten zusammenarbeitet. Bis 2005 waren<br />
etwa zwei Drittel der Familien lediglich geduldet. Sie<br />
mussten jederzeit mit ihrer Abschiebung rechnen. Für<br />
sie galten nach Gesetzeslage in der Flüchtlingspolitik<br />
eingeschränkte Rechte. Sie durften in der Regel nicht<br />
arbeiten, erhielten nur 70 Prozent des Sozialhilfesatzes,<br />
hatten keinen Anspruch auf Kindergeld oder Erziehungsgeld.<br />
Sie hatten auch kein Anrecht auf die Teilnahme an<br />
Sprach- und Integrationskursen. Eine Ausbildung oder<br />
auch das Führen eines Gewerbes war verboten. Besonders<br />
schwer war es für Flüchtlingskinder, die mit ihren<br />
Familien jahrelang in sogenannten Übergangsheimen<br />
untergebracht waren. Für die Kinder galt nur der freiwillige<br />
Schulbesuch, das heißt, es bestand für sie keine<br />
Schulpflicht und sie hatten sogar kein Anrecht zur<br />
Schule zu gehen. Es hing vor allem von den Kommunen<br />
und Initiativen ab, wie stark die Einschränkungen für die<br />
Flüchtlinge waren und welche Förderung sie erfuhren.<br />
Für die Roma-Familien bedeutete das damalige Ausländergesetz<br />
eine Verlängerung der Erfahrungen, die sie schon<br />
z.B. in Bosnien gemacht hatten. Roma-Kinder sind in den<br />
südosteuropäischen Ländern laut einer Untersuchung<br />
des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin<br />
in Zusammenarbeit mit UNICEF beim Schulbesuch stark<br />
benachteiligt.<br />
Wenn sie überhaupt eingeschult werden, kommen sie oft<br />
auf reine Roma-Schulen, die meistens schlecht ausgestattet<br />
sind und wo es an qualifiziertem Personal fehlt. Oft werden<br />
Roma-Kinder mit fadenscheinigen Begründungen an<br />
Sonderschulen verwiesen. Das Bildungsniveau für Roma<br />
ist nach dem Zusammenbruch des Sozialismus und nach<br />
den Balkankriegen in den meisten Ländern noch mal gesunken.<br />
So ist in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien,<br />
Serbien und im Kosovo der Anteil der Roma, die nicht<br />
lesen und schreiben gelernt haben, bei den 14- bis 24-Jährigen<br />
deutlich höher als bei der mittleren Generation der<br />
heute 25- bis 34-Jährigen. Roma-Kinder in Südosteuropa<br />
sind in starkem Maße vom Schulbesuch ausgeschlossen.<br />
In Bosnien-Herzegowina gehen beispielsweise 80% der<br />
Roma- Kinder überhaupt nicht in die Schule.<br />
Am 1.1.2005 trat das jetzige Ausländergesetz in Kraft, das<br />
die Lebensbedingungen der Flüchtlinge erleichterte. Nach<br />
diesem Gesetz gibt es nur noch eine befristete Aufenthalterlaubnis,<br />
die Kettenduldung ist abgeschafft, und langjährig<br />
geduldete Flüchtlinge bekommen das erste Mal eine<br />
Aufenthalterlaubnis, die Erwerbstätigkeit ist gestattet, es<br />
gibt ein Recht auf Kindergeld, Erziehungsgeld und Unterhaltsvorschuss,<br />
was den Kitabesuch finanziell erleichtert.<br />
Und sie bekommen eine unbefristete Niederlassungserlaubnis.<br />
Die Schulpflicht ist für alle in Deutschland lebenden<br />
Kinder eingeführt und eine berufliche Ausbildung ist<br />
möglich.<br />
Als Folge des bis 2005 erschwerten Zugangs für Flüchtlinge<br />
zur Schule und zur Bildung in Deutschland zeigt<br />
sich bei vielen Roma-Familien ein zurückhaltendes und<br />
unvertrautes Verhältnis zur Schule. Das drückt sich zum<br />
Beispiel in folgenden Problematiken aus: Familien haben<br />
wegen der Erlebnisse von Ignoranz, Ausschluss-Erfahrungen,<br />
Nicht-Akzeptanz und Diskriminierung Angst davor,<br />
ihre Kinder in die Schule zu schicken. Wie in den anderen<br />
europäischen Ländern teilen die unterschiedlichen Roma-<br />
Gruppen auch in Deutschland die Erfahrung, als Zigeuner<br />
beschimpft zu werden.<br />
Viele Kinder sind zu spät eingeschult oder ihr Schulbesuch<br />
ist aufgrund eines unsicheren Aufenthaltes und der<br />
Unmöglichkeit für die Familien, eine klare Perspektive in<br />
Deutschland zu entwickeln, unregelmäßig.<br />
Eltern nehmen wenig an den schulischen Anliegen ihrer<br />
Kinder teil. Sie können ihnen nicht bei den Hausaufgaben<br />
helfen, weil sie Analphabeten sind oder wenig schulische<br />
Erfahrungen haben.<br />
Familien geben bei ablehnenden Haltungen von Schule<br />
und Schulamt schnell auf, weil sie oft nur an ihren Defiziten<br />
gespiegelt werden. Ein Dialog auf gleicher Augenhöhe<br />
findet kaum statt.
Viele Kinder werden überhaupt nicht oder nicht genug<br />
gefördert oder von der Schule im Stich gelassen bzw.<br />
in Sonderschulen geschickt. Viele Kinder fallen durch<br />
schlechte Deutschkenntnisse, demnach schwachen<br />
Schulleistungen, und dem Status Sonderschüler auf.<br />
Manche Kinder werden in der Schule häufiger wegen<br />
schlechten Benehmens bestraft oder sie werden als Störfaktor<br />
wegen häufiger Verspätung im Unterricht und vieler<br />
Fehltage betrachtet.<br />
Viele Kinder fühlen sich wegen ihrer mangelnden<br />
Leistungen und Diskriminierungserfahrungen seitens der<br />
Mitschüler nicht wohl. Viele Kinder schwänzen deswegen,<br />
sie sind krank geschrieben und haben psychosomatische<br />
Störungen, wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder<br />
Schlafstörungen usw.<br />
Mit Blick auf die geschichtlichen, gesellschaftlichen und<br />
sozialen Hintergründe ist es nicht schwer zu erkennen,<br />
wie Schuldistanz und Schulangst entstehen und welcher<br />
Schritte es bedarf, um langfristige Änderungsprozesse in<br />
Gang zu setzen.<br />
Alle Eltern möchten, dass ihre Kinder erfolgreich sein können,<br />
aber der Enthusiasmus am Anfang der Einschulung<br />
bei den Kindern weicht schnell der Resignation und löst<br />
ihren Rückzug aus. Es wird weiterhin berichtet, dass Sinti-<br />
und Roma-Kinder in Sonderschulen überrepräsentiert<br />
sind, und dass diese Kinder die Schule zu einem unverhältnismäßig<br />
hohen Anteil vorzeitig verlassen.<br />
Der Schlüssel für die Veränderung dieser Situation muss<br />
sein, den Einstieg der Kinder in die Schule zu verbessern.<br />
Da entscheidet sich, ob sie den Schritt aus einer bildungsfernen<br />
Umgebung schaffen. Aus einer Umgebung, die Ablehnung,<br />
Hass und Ressentiments erfahren hat und wo<br />
die Eltern misstrauisch sind, ob ihre Kinder Fuß in der<br />
Schule fassen können. In einer Schule, die wesentlich von<br />
der Mehrheitsgesellschaft geprägt ist. Die Kinder müssen<br />
besser auf die Schule vorbereitet werden, in Vorschulen<br />
und Kindergärten, wo sie möglichst vorurteilsfrei gemeinsam<br />
mit Kindern aus der Mehrheitsgesellschaft lernen<br />
und spielen.<br />
Schritte, die wir in unserer Arbeit versuchen, sind, dass<br />
wir romastämmige SozialarbeiterInnen als Mediatoren<br />
einsetzen, um Roma-Kinder erfolgreich an die Schule<br />
heranzuführen, was sich in Köln oder in Berlin bewährt<br />
hat. Wir begleiten die Eltern zur Schule, nehmen ihnen<br />
die Ängste und geben Sicherheit. Wir ermutigen und motivieren<br />
die Eltern und die Kinder. Wir geben Informationen<br />
über die Rechte und Möglichkeiten der Familien, um die<br />
schulischen Leistungen ihrer Kinder zu fördern.<br />
Wir unterstützen andererseits die Schulen, um die Probleme<br />
rechtzeitig zu erkennen. Wir beteiligen dabei alle<br />
Seiten und suchen gemeinsam mit den Eltern nach Lösungen.<br />
Zum Beispiel sensibilisieren wir für Mobbing in<br />
der Klasse und besprechen frühzeitig die Fehlstunden<br />
der Kinder. Wir arbeiten an der Früherkennung von Defiziten,<br />
zum Beispiel für die Sprach- und Lernförderung, Förderung<br />
im Regelunterricht, geben Hinweise auf mögliche<br />
Lernhilfen und Angebote im sozialen Umfeld.<br />
Wir machen eine bedarfsorientierte Einzelfallberatung, in<br />
der je nach den schulischen und bildungsrelevanten Prämissen<br />
Einzelfallhilfe für die Sinti und Roma praktiziert<br />
wird, um einen zufrieden stellenden Schulabschluss bzw.<br />
eine Berufsausbildung zu erreichen.<br />
In dem Kontext bieten wir zum Beispiel noch zusätzlich besondere<br />
Lernhilfen für Sinti- und Roma-Kinder durch den<br />
Kollegen an, in Zusammenarbeit mit Schule, Eltern und<br />
Lehrern.<br />
Meine Mitarbeiterin Frau Krabel, Ethnologin und gebürtige<br />
Jugoslawin, wird jetzt weiter berichten, und zwar insbesondere<br />
zur fehlenden Kommunikation zwischen den Schulen,<br />
den Kindern und den Familien.<br />
Svetlana Krabel: Ich werde über die Situation in Bezug<br />
auf die Schule sprechen und die Schwierigkeiten,<br />
die Flüchtlingsfamilien dabei haben, sich frei und offen<br />
dort äußern zu können und ihre eigenen Interessen zu<br />
vertreten.<br />
Mit dem Wissen, dass eine Arbeit im Bereich Schule und<br />
Migrantenkinder keine gute Basis haben kann, wenn<br />
man die Familien und ihre Lebensrealitäten nicht kennt,<br />
haben wir im letzten Jahr eine Befragung über ihre Lebenssituation<br />
mit ungefähr 100 Familien, die im Wedding<br />
leben, durchgeführt. Ein Auszug ist zum Nachlesen<br />
in der Tagungsmappe. Diese Befragung hatte das Ziel,<br />
die Lage von deren schulpflichtigen Kindern zu beleuch-<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 141
142<br />
Workshop Pass-genau?<br />
Pass-ganau?<br />
ten. Dabei suchten wir auch nach Möglichkeiten um die<br />
Lage der Kinder zu verbessern, was auch bedeutet, dass<br />
ihr schulischer Erfolg verbessert wird.<br />
Das Besondere an dieser Befragung war, dass zum ersten<br />
Mal die Eltern die Gelegenheit hatten, frei über ihre Erfahrungen<br />
zu sprechen. Sie ließen uns mit großer Offenheit<br />
daran teilhaben. Damit ermöglichten sie uns, dass wir<br />
wichtige Eindrücke und Informationen zum besseren Verständnis<br />
und zum Überblick erhielten, und zwar über ihre<br />
materielle Lebensgrundlage, über ihre sozialen Verhältnisse,<br />
die Ressourcen in den Familien, wie Wertesysteme,<br />
Bewusstsein, Grad der Bildung oder Bestrebungen. Wir<br />
bekamen auch mehr Informationen über ihre Erfahrungen<br />
mit Krieg und Vertreibung und die damit verbundenen psycho-sozialen<br />
Folgen für die Familienmitglieder.<br />
Aus den Ergebnissen unserer Befragung wurde deutlich,<br />
dass besonders Roma-Familien jahrelang in extrem belastenden<br />
und unsicheren Situationen lebten. Weiter wurde<br />
deutlich, dass die Schulen in keiner Weise diesen besonderen<br />
Umständen Rechnung tragen. Die Kinder werden<br />
nicht in der erforderlichen Weise gefördert – in der Sprache<br />
oder beim Lernen, und die Eltern nicht über ihre Möglichkeiten<br />
und Rechte bezüglich der Förderungsoptionen<br />
informiert.<br />
Mit dieser Befragung wurde uns bestätigt, dass die Gesellschaft<br />
und die Schule als wichtige Institution ungenügend<br />
flexibel sind, sie reproduzieren die Ungleichheit anstatt diese<br />
aufzuheben. Aber ein Leben in normalen – und nicht<br />
ausgrenzenden – Verhältnissen ist die wichtigste Bedingung<br />
für die Entwicklung und den schulischen Erfolg der<br />
Kinder.<br />
Wir haben versucht eine Erklärung auf die Frage zu geben,<br />
wie dieses vorhandene Schulsystem und seine Mechanismen<br />
bei der Problemlösung helfen kann, wie sich das<br />
Schulsystem auf die Integration der ausländischen Schüler<br />
auswirkt, wie weit es Integration verwirklicht oder auch<br />
unmöglich macht.<br />
Wir sind aber auf dieses vorhandene System angewiesen,<br />
was allerdings kein ideales System ist. Das soll uns<br />
aber nicht stoppen, alles Mögliche zu unternehmen, als<br />
Eltern, als Lehrer, als Sozialarbeiter, als engagierter Bürger,<br />
ein besseres Klima in der Gesellschaft zu schaffen<br />
und uns darum zu bemühen, dass jedes Kind motiviert<br />
wird, sich in der Schule zu integrieren und einen Schulabschluss<br />
zu schaffen.<br />
Wir haben schon erwähnt, was es für eine undankbare<br />
Gesetzgebung vor 2005 gab. Ich beziehe mich auf diese<br />
Zeit, wenn ich jetzt über eine junge, erwachsene<br />
Roma-Frau aus Bosnien erzähle. Sie ist mit ihren Großeltern<br />
1992 nach Deutschland geflüchtet, da war sie 7<br />
Jahre alt. Heute ist sie 24 Jahre alt und macht gerade<br />
ihren Hauptschulabschluss bei „Frauenzukunft“. Das<br />
ist ein Projekt, das eine staatlich anerkannte Schule für<br />
erwachsene Frauen unterhält, die aus verschiedenen<br />
Gründen nicht in einer Regelschule ihren Abschluss<br />
machen konnten. Ich bin sehr stolz darauf, dass es mir<br />
gelungen ist, diese Frau zu ermutigen, diesen wichtigen<br />
Schritt in ihrem Leben zu machen, sich ausbilden zu<br />
lassen, obwohl sie niemals zuvor in ihrem Leben eine<br />
Schule besucht hat.<br />
Man kann sich vorstellen, wie schwer es dieser Frau fallen<br />
musste, die komischen Blicke und das Erstaunen der Mitarbeiter<br />
zu ertragen in den zahlreichen Beratungsstellen,<br />
die wir gemeinsam besuchten. Dort haben wir uns informiert,<br />
ob es Ausbildungsmöglichkeiten und wenn ja, welche,<br />
für diese Frau gibt. Sie war mutig genug nicht aufzugeben,<br />
trotz der geäußerten Skepsis und dem Misstrauen<br />
vonseiten ihrer Familie, den Beratungsstellen, am Anfang<br />
auch ihrer jetzigen Schule. Und auch trotz ihrer eigenen<br />
Skepsis.<br />
Einmal fragte sie mich: Wo war das Jugendamt damals,<br />
um mir zu helfen und um meine Großeltern zu beeinflussen,<br />
mich in die Schule zu schicken? Ich konnte<br />
ihr die Frage nicht beantworten. Heute frage ich mich<br />
immer noch, wie das hier in Deutschland möglich sein<br />
konnte. Als sie vor 15 Jahren nach Berlin kam, wollte<br />
ihr Onkel sie in zwei Grundschulen einschreiben. Beide<br />
Schulen haben sie wegen Platzmangels nicht angenommen.<br />
Die Familie hat es dann aufgegeben, weiter<br />
einen Schulplatz für das kleine Mädchen zu suchen, so<br />
dass sie hier aufgewachsen ist, ohne jemals eine Schule<br />
besucht zu haben. Das ist eine Alptraum-Geschichte,<br />
weil es unglaublich ist, dass sie heutzutage überhaupt<br />
möglich ist.
Wie wir alle wissen, werden die Menschen in schwierigen<br />
Lagen immer zur Zielscheibe der schlimmsten Vorurteile.<br />
Gegen eines möchte ich kämpfen, nämlich dass die Schuldistanz<br />
als eine Eigenschaft der Roma-Familien angesehen<br />
wird. Mir wäre es lieber, wenn ich spekulieren könnte,<br />
unter welchen Verhältnissen Schuldistanz entstanden ist<br />
und wie dieses System dazu beigetragen hat. Stattdessen<br />
werde ich eine Geschichte aus meinem Arbeitsalltag<br />
erzählen. Jeden von Euch lasse ich eine eigene Meinung<br />
über das Bildungssystem haben.<br />
Schuldistanz ist – meiner Meinung nach – nur eines von<br />
vielen schlechten Symptomen eines veralteten, unflexiblen<br />
Bildungssystems, das Unterschiede beibehält anstatt sie<br />
abzubauen. Auf einer Mikroebene reproduziert die Schule<br />
die Werte der Mehrheitsgesellschaft, die verkörpert sind<br />
in Nichtanerkennung der Anderen.<br />
In meinem Arbeitsalltag habe ich erlebt, dass eine Klassenlehrerin<br />
nicht wusste, welche Muttersprache ihre<br />
Schülerin spricht, obwohl sie das Mädchen schon vier Jahre<br />
unterrichtete. Ich weiß nicht, wie ich dieses Phänomen<br />
bezeichnen kann. Als Ignoranz? Desinteresse? Soziale Inkompetenz?<br />
Faulheit? Gleichgültigkeit? Ein wichtiger Teil<br />
dieses kleinen Mädchens ist in ihrer Schule bzw. vor ihrer<br />
Klassenlehrerin verborgen geblieben. Diese Diskrepanz<br />
zwischen dem schulischen Leben und dem Familienleben<br />
erfahren viele Kinder.<br />
Was können wir tun, um diese Diskrepanz zu überwinden?<br />
Was tut die Schule und was tut die Klassenlehrerin? Wie<br />
kann sich dieses Mädchen als normal fühlen, wenn es<br />
nicht anerkannt und über seine Muttersprache und ihre<br />
Herkunft geschwiegen wird? Was für eine Meinung wird<br />
sie sich über sich selbst bilden und welches Selbstbewusstsein<br />
wird sie haben? Wie können wir eine Kultur der<br />
Anerkennung pflegen?<br />
Ein sehr gutes Beispiel kommt von einer Freundin von mir,<br />
einer Basketballtrainerin. Sie hat mir erzählt, wie sie bei ihrem<br />
Training einige Übungen mit ihren kleinen Spielerinnen<br />
macht, bei denen in der eigenen Muttersprache manche<br />
Begriffe, die zur Bewegung animieren, laut geschrieen werden,<br />
schneller, wirf in den Korb, komm her. Sie merkt, dass<br />
solche Spiele dem Klima im Team gut tun, weil die kleinen<br />
Mädchen in ihren eigenen Augen größer werden.<br />
Herbert Scherer: Das ist ein gutes Beispiel zum Schluss.<br />
Es gibt offensichtlich Diskrepanzen zwischen dem, was<br />
möglich ist, und dem, was an Möglichkeiten wahrgenommen<br />
wird. Ich denke, das ist der Kern von Eurem Ansatz.<br />
Ihr versucht das, was möglich ist. Aber teilweise ist das ja<br />
erst neuerdings möglich, seit der Gesetzgebung ab 2005.<br />
Jetzt gilt der Aufenthaltsstatus von den EU-Ausländern,<br />
viele Roma gehören jetzt zur EU, wenn sie zum Beispiel<br />
aus Rumänien oder Tschechien kommen. Dinge verändern<br />
sich, aber das Bewusstsein verändert sich erst sehr<br />
viel später. Das schließt auch ein bisschen den Bogen zu<br />
dem, was wir gestern im Anfangsreferat gehört haben,<br />
dass die Rechte und die Wirklichkeit miteinander im Konflikt<br />
stehen.<br />
TN: Ich fände es gut, hier mal Lehrer und Sozialpädagogen<br />
aus dem sozialpädagogischen Dienst dazu zu hören. Die<br />
haben eine andere Sichtweise dazu. Die beschäftigen sich<br />
sehr intensiv mit den Sinti-Familien, weil es ihr Alltagsgeschäft<br />
ist, und es ist eine entsetzliche Hilflosigkeit zu spüren.<br />
Der Vorwurf ist mir einfach zu kurz, dass die Schule<br />
nicht ihre Integrationsaufgabe leistet. Die Lehrer stellen<br />
es anders dar, erstens gibt es keinen regelmäßigen Schulbesuch<br />
der Kinder und zweitens keinen Kontakt zu Eltern.<br />
Das während ihrer Arbeit zu leisten ist für einen Lehrer<br />
im Wedding, wo ihnen die Probleme sowieso bis zum Hals<br />
gehen, dieser Anspruch ist einfach zu hoch.<br />
Wir müssen bei uns als Dienstleister gucken, was wir als<br />
Zuarbeiter für Schulen und sozialpädagogische Dienste<br />
leisten können. Ihr macht ganz viel, aber ich würde gerne<br />
von dieser Vorwurfshaltung wegkommen, weil sie nichts<br />
nützt.<br />
TN: Ich glaube auch, dass die Schule alleingelassen<br />
wird, wir haben die staatliche Schule, teilweise handlungsunfähig.<br />
Die Lehrer leiden natürlich darunter, dass<br />
sie keinen Zugang zu den Familien finden, mit deren Kindern<br />
sie arbeiten. Aber ich will noch mal zurück zu den<br />
arabischen Familien: Bei Ihnen klingt das so, als sei alles<br />
katastrophal. Wir haben z.B. mit dem Projekt Al Nadi<br />
auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Da ist es durchaus<br />
gelungen, Kontakt zu palästinensischen Familien<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 143
144<br />
Workshop Pass-genau?<br />
Pass-ganau?<br />
herzustellen. Ausgangspunkt war, dass die Schularbeitsgruppen<br />
überlaufen waren und wir uns eine andere Art<br />
der Unterstützung ausdenken mussten. Wir haben dann<br />
ein Patenschaftsmodell entwickelt und Ehrenamtliche<br />
gefunden, die bereit waren, in die arabischen Familien<br />
zu gehen. Da erhob sich die Frage: sind die arabischen<br />
Familien bereit, ehrenamtliche Deutsche, meistens sind<br />
es Frauen, in ihre Wohnungen zu lassen? Und tatsächlich<br />
klappt das wunderbar und funktioniert bestens. Es<br />
gibt bestimmt auch Grund zum Klagen, dennoch sehen<br />
wir hier sehr kleinteilige schöne Ansätze, die sehr gut zu<br />
uns passen, denn wir sind in unseren Möglichkeiten viel<br />
flexibler und handlungsfähiger, als viele andere Institutionen.<br />
Und genau diese Rolle müssen wir einnehmen.<br />
Haroun Sweis: Ich denke, Projekte wie Al Nadi sind notwendig<br />
und erfolgreich, es gibt auch mehr ehrenamtliche<br />
Mitarbeiter als früher, das ist eine gute Tendenz,<br />
aber zugleich erlebe ich das Verhalten der Araber gegenüber<br />
den Medien als katastrophal. Die Informationen holen<br />
sie im Allgemeinen nicht von deutschen Medien und<br />
nicht von deutschen Informationen, Projekte wie Al Nadi<br />
funktionieren wunderbar, aber nur in einem kleinen Rahmen.<br />
Wenn man jetzt die Situation in Neukölln sieht, da<br />
sieht man ein neues Bild, dazu gehört übrigens auch,<br />
dass viele Kinder nicht zur Schule gehen. Ein großes<br />
Thema ist auch die Gewalt an der Schule. Ich gehe oft<br />
an Schulen mit unserem neuen Projekt Orient-Express<br />
und dann merke ich, dass die Jugendlichen sich in der<br />
Klasse oft genau so verhalten wie sie das von zu Hause<br />
mitbekommen haben. Die Lehrer sagen nichts, auch die<br />
engagierten Lehrer trauen sich manchmal nicht etwas<br />
zu sagen, wenn ein Kind auf einmal vom „Judenstaat“<br />
spricht, weil im Fernsehen immer vom Judenstaat gesprochen<br />
wird. Auf Arabisch sagt man Israel oder Judenstaat.<br />
Juden sind für das Kind alle gleich: sie kämpfen<br />
mit Waffen gegen alle Palästinenser. Und auch die Eltern<br />
machen da keine Unterschiede.<br />
TN: Kennen die Deutschen auch nicht, die Unterschiede<br />
zwischen Judentum, Israel und Zionisten.<br />
Haroun Sweis: Ja, aber die Deutschen sehen diese Bilder<br />
nicht, die im Fernsehen laufen. Die sind das Problem.<br />
TN: Ich fand erst mal für mich auch die kompakten Informationen<br />
von Petra Kindermann gut. Ich wusste gar nicht,<br />
dass Flüchtlinge bis 2005 keine Schulpflicht hatten usw.<br />
Es ist auch wichtig zu wissen, welche Problematik sich<br />
über Jahrzehnte auch in Deutschland aufgebaut hat. Ich<br />
sehe auch, dass sich Dinge, die bis 2005 so waren, sich<br />
noch Jahrzehnte in ihren Auswirkungen weiterschleppen<br />
werden.<br />
TN: Sie durften aber zur Schule gehen.<br />
TN: Aber sie hatten eben keine Pflicht dazu. Ich wohne in<br />
Marzahn und habe eine Zeit im Mädchenzentrum gearbeitet.<br />
Wir hatten dort auch viele bosnische Kinder aus<br />
Familien, die im Wohnheim untergebracht waren. Da gab<br />
es ganz viele Probleme zwischen bosnischen und deutschen<br />
Kindern, weil die deutschen Kinder sauer waren,<br />
dass die bosnischen Kinder nur teilweise zur Schule gekommen<br />
sind. Dann hatten die was verpasst und haben<br />
nachgefragt, so dass es wiederholt werden musste. Es gab<br />
so viele Sachen, die man von einander gar nicht wusste.<br />
Ich finde, ihr macht da eine tolle Arbeit. Auch bei den türkischen<br />
Familien sieht man ja, dass die Probleme über<br />
Jahrzehnte mitgeschleppt werden.<br />
TN: Ich fand an den beiden Beispiel gut, dass deutlich wurde,<br />
dass Menschen in unserer Nachbarschaft leben und<br />
doch wenig Möglichkeiten haben, die Gesellschaft oder<br />
die Nachbarschaft mit zu gestalten. Das fand ich wichtig.<br />
Auch die Information, dass arabische Familien die Informationen<br />
nicht von hier aus dem nachbarschaftlichen<br />
Umfeld nutzen, sondern von weit weg. Oder auch zu wissen,<br />
dass Sinti und Roma lange Zeit keinen Schulzugang<br />
hatten, weshalb sie erst mal wieder mühsam herangeführt<br />
werden müssen. Wie kriegen wir das zusammen gelöst?<br />
Meine Frage wäre, wie kriegen wir die arabische Community<br />
aufgeschlossen dazu, sich über ihre Nachbarschaft zu<br />
informieren?
Herbert Scherer: Das entscheidende Wort ist ja von Svetlana<br />
gesagt worden, die Brückenfunktion. Es geht nicht<br />
um ein Schwarzer-Peter-Spiel, sondern es geht darum,<br />
was können wir – also unser Bereich – bestenfalls in einer<br />
Situation machen, einerseits die Augen aufmachen und<br />
die Katastrophe hinter den Kulissen sehen. Andererseits<br />
die Brückenfunktion bewusst an den Stellen so wahrnehmen,<br />
wie es jeweils möglich ist. Und die Brückenfunktion<br />
heißt, mit zwei Seiten kommunizieren.<br />
Folien zum Beitrag von Haci-Halil Uslucan<br />
TN: Für mich ist jetzt für unsere Arbeit herausgekommen,<br />
dass wir viel mehr Hintergrundwissen brauchen und zwar<br />
über die Wurzeln. Ich habe keine Ahnung, wie das Verhältnis<br />
zwischen Türken und Arabern ist, deren Sozialisation,<br />
alles, was für unsere Arbeit wichtig ist. Ich nehme einiges<br />
heute mit, vielen Dank.<br />
TN: Jetzt fängt es eigentlich erst an, weil wir immer von<br />
Deutschen und Arabern, von Deutschen und Bosniern, von<br />
Deutschen und Türken sprechen. Die Russland-Aussiedler<br />
sind noch gar nicht erwähnt worden, das ist auch eine eigene<br />
Problematik. Das finde ich spannend, dass es eine<br />
Brückenfunktion auch innerhalb dieser Comunities geben<br />
müsste. Da sind wir, glaube ich, erst am Anfang.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 145
146<br />
Abschlussplenum<br />
„Wohin geht die Reise?“<br />
Herbert Scherer: Zwei Beobachter, Benjamin Eberle und<br />
Katrin Fleischer, haben ihre subjektiven Eindrücke von der<br />
Tagung gesammelt, und möchten sie hier als Anregung an<br />
die Teilnehmer zurückgeben. Es sind Gäste von außerhalb<br />
unseres Verbandes, aber sie sind aus dem Umfeld und<br />
kennen Nachbarschaftseinrichtungen.<br />
Benjamin Eberle: Ich komme von der Arbeiterwohlfahrt<br />
und leite das Begegnungszentrum der AWO in Berlin-Kreuzberg.<br />
Das ist eine Einrichtung, die aus der Migrations-Sozialarbeit<br />
entstanden ist und die seit ca. 30 Jahren existiert.<br />
Ich glaube,<br />
die erste Beratungsstelle<br />
wurde 1973<br />
dort eröffnet.<br />
Seit 1994 haben<br />
wir daraus<br />
ein Nachbarschaftsheim<br />
a u f g e b a u t ,<br />
um näher an<br />
den Bedürfnissen der Menschen – nicht nur der Migranten<br />
– zu sein. Ich komme von außen, aber ich habe eine große<br />
Affinität zu der Nachbarschaftsheim-Bewegung.<br />
Ich fange mit den eher positiven Sachen an. Was mich an<br />
dieser Nachbarschaftsheim-Bewegung immer wieder beeindruckt,<br />
ist das unglaubliche Engagement von unten.<br />
Und dass die Leute die Möglichkeit bekommen, irgendetwas<br />
anzupacken, sie werden unterstützt, ihren Weg zu<br />
gehen bzw. zu finden. Sehr deutlich wird das u.a. an der<br />
Arbeit vom Tauschring in Charlottenburg oder auch bei<br />
diesem jungen Mann von Exit, da ist eine unheimliche Energie<br />
drin. Sie kommt von unten. Es wird nicht von oben<br />
gesagt: so musst du es machen. Sondern die Leute sagen:<br />
Ich habe ein Bedürfnis, das umzusetzen, und dann bekommen<br />
sie dafür Unterstützung von den Nachbarschaftseinrichtungen.<br />
Das hat sich seit Jahren nicht verändert<br />
und das ist immer wieder das Tolle daran.<br />
Eine der großen Herausforderungen ist der demografische<br />
Wandel. Das wissen wir schon länger. Ich finde, dass die<br />
Nachbarschaftsheim-Bewegung, auch das Quartiersmanagement,<br />
erkannt hat, dass in den Bezirken und Quartieren<br />
untereinander ein Informationsfluss nötig ist, um<br />
auf das Älterwerden der Gesellschaft zu reagieren. Das<br />
kann nicht vom Staat kommen, der sagt, wie die Betreuung<br />
sein muss, sondern das müssen sich die Menschen<br />
selbst erarbeiten. Das ist der Ansatz der Mehrgenerationenhäuser,<br />
nicht nur von der Finanzierung her, auch vom<br />
Konzept her finde ich das genau richtig. Es gibt viele gute<br />
Beispiele bei den Nachbarschaftsheimen, wie sie sich neu<br />
organisieren, um sich den heutigen Fragen zu stellen: Wie<br />
wollen die Generationen miteinander leben, wie wollen wir<br />
neue Familiennetzwerke erarbeiten. Diese Bewegung ist<br />
da ganz vorne und sehr innovativ, sie wird sich neue Wege<br />
erarbeiten.<br />
Die andere große Herausforderung, die ich sehe, ist Migration<br />
und Integration. Da bin ich immer wieder erstaunt, wie<br />
naiv und unerfahren die Nachbarschaftsheim-Bewegung<br />
damit umgeht. Nicht nur, weil es schon lange ansteht, vielleicht<br />
nicht in jedem Quartier, aber grundsätzlich schon.<br />
Die Anmerkung, die ich in einem Workshop mitbekommen<br />
habe, bezieht sich darauf, dass sich die sozialen Institutionen<br />
mehr interkulturell öffnen sollen. Was nach dieser<br />
interkulturellen Öffnung kommt, das weiß ich nicht, aber<br />
wir sind dran, einen nächsten Schritt zu machen.<br />
Diese Begriffe ‚interkulturelle Kompetenz’,’ interkulturelle<br />
Öffnung’, die gibt es, seit ich vor 14 Jahren bei der AWO
angefangen habe, das ist wirklich nichts Neues. Es ist gesellschaftlich<br />
angekommen, aber ob man das Jugendamt<br />
öffnet oder ein Nachbarschaftsheim öffnet, das muss jeweils<br />
bei jeder Einrichtung vor Ort erarbeitet werden, denn<br />
es gibt keine Zauberformel. Wir alle leben hier, und es<br />
geht darum, wie wir unser Zusammenleben gemeinsam<br />
gestalten können. Das macht die Nachbarschaftsheim-Bewegung<br />
sehr gut. Aber sie muss die Zielgruppe noch besser<br />
erreichen. Ich sehe hier heute sehr wenige Gesichter<br />
von Menschen mit Migrationserfahrung. Ich sehe keine<br />
Familien hier, nur wenige. Wenn ich auf andere Veranstaltungen<br />
gehe, die Familien sind da, die Menschen sind da,<br />
aber hier fehlt das. Das sollte eigentlich bei einer Bewegung,<br />
die an der Wurzel der Zeit ist, anders sein.<br />
Herbert Scherer: Ich komme gerade aus einer Arbeitsgruppe,<br />
wo das das Thema war und wo wir nicht über Migranten<br />
geredet haben, sondern sie waren unter uns und<br />
haben von ihren Erfahrungen berichtet. Aber wir nehmen<br />
zur Kenntnis, dass wir so wahrgenommen werden.<br />
Katrin Fleischer: Ich finde unsere Nachbarschaftsheim-<br />
Bewegung auch ausgesprochen deutschlastig. Das tut mir<br />
leid. Wir haben unsere Vorzeigehäuser, in denen es eine<br />
gewisse Mischung der Kulturen gibt. Aber sich zu öffnen<br />
heißt nicht nur, darüber reden, sondern es auch praktizieren,<br />
d.h., die Leute gleichberechtigt reinholen.<br />
Herbert Scherer: Katrin ist Geschäftsführerin des Vereins<br />
Berlin 21, sozusagen in Vereinsform eine Nachfolgeorganisation<br />
von der Agenda 21-Bewegung, aber sie ist auch<br />
uns gewissermaßen verbunden als Gründerin des Nachbarschaftszentrums<br />
Kiezspinne in Berlin-Lichtenberg, wo<br />
sie lange Zeit im Vorstand aktiv war.<br />
Katrin Fleischer: Die Themen, die ich bei dieser Tagung<br />
angetroffen habe, fand ich alle total spannend. Ich habe<br />
auch festgestellt, dass es eine sehr undankbare Aufgabe<br />
ist, mal durch drei Workshops zu wandern, um sich einen<br />
Eindruck zu verschaffen. Dann wird man auch noch blöd<br />
angeguckt, weil man nicht angekündigt ist und trotzdem<br />
eine Frage stellt.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 147
148<br />
Abschlussplenum<br />
Was ich bei allen Arbeitsgruppen spannend fand, dass<br />
die alte Regel stimmt, nämlich, dass eine Sache interessant<br />
wird, wenn man hinter die Kulissen guckt. Auch beim<br />
Thema Krippe ist es dann interessant, wenn man sich die<br />
Krippe genauer anguckt, was sie ermöglicht, aber auch<br />
verhindert. Wo muss man die Krippe kritisch betrachten,<br />
wenn es um Fremdbetreuung geht, und wo ist sie aber<br />
auch eine echte Bereicherung?<br />
Ähnlich interessant war es in der anderen Arbeitsgruppe,<br />
wo jemand sagte, dass er bis vor Kurzem nicht wusste,<br />
was der Unterschied zwischen arabischen und türkischen<br />
Familien ist, aber er hatte durch die Arbeitsgruppe mehr<br />
begriffen. Das zeigt mir immer wieder, wie wenig wir eigentlich<br />
hinter die Kulissen gucken.<br />
Die Krippe gab es mal, sie war völlig normal. Dann ist sie<br />
verschwunden, so wie die Schulgärten. Und jetzt kommt<br />
sie plötzlich wieder. Ich freue mich, dass 750.000 Krippenplätze<br />
geschaffen werden sollen, weil ich denke, das<br />
ist eine echte Bereicherung für die Familien.<br />
Es wurde immer darüber geredet, dass man mehr über<br />
die Familien erfahren muss. Da gibt es was ganz Simples,<br />
früher war es zum Beispiel in der DDR staatlich verordnet,<br />
dass mit den Familien gearbeitet werden musste.<br />
Jetzt entdeckt man es gerade wieder, wie wichtig es ist,<br />
mit den Eltern zu reden, damit man begreift, wo die Kinder<br />
herkommen, um zu verstehen, was sie für Probleme haben.<br />
Bestimmte Sachen kommen immer wieder hoch, die<br />
eigentlich schon bekannt sind.<br />
Abschlussplenum<br />
TN: Ich will das ein Stück weit relativieren mit der nicht<br />
geglückten Integration von Migranten. Ich arbeite u.a. in<br />
der Osloer Straße in Berlin-Wedding und komme auch<br />
viel herum. Ich merke, dass wir die türkischen Frauen bei<br />
dem Frauenfrühstück einbeziehen konnten, auch mit den<br />
Themen zur Gesundheit ihrer Kinder. Dass die Türkinnen<br />
im Kiez arbeiten, das finde ich eine sehr gelungene Migrationspolitik.<br />
Es ist so was von selbstverständlich geworden,<br />
das habe ich noch nirgends so erlebt. Das geht<br />
auch ohne Stadtteilmütter, die Türkinnen selbst machen<br />
ihr Frauenfrühstück, sie tanzen da, sie öffnen sich den Angeboten,<br />
die es da gibt, wodurch Begegnungen entstehen.<br />
Es gibt eine Türkin, die künstlerisch begabt ist und dort
Geschichten vorliest, dann werden sie an der Volkshochschule<br />
in die Kurse einbezogen, in die PEKiP-Gruppen, Geburtsvorbereitungskurse.<br />
Das ist über Jahre gewachsen.<br />
Ich kenne ziemlich viele soziale Einichtungen, aber dieses<br />
von der Pike auf, das ist etwas ganz Besonderes bei den<br />
Nachbarschaftseinrichtungen. Es kommt von unten, es<br />
dauert seine Zeit, aber dann geht es.<br />
TN: Ich habe Benjamin Eberle so verstanden, dass er bei<br />
uns ein Arbeitsfeld sieht, nämlich das der Einbeziehung<br />
von Migranten, wo er denkt, dass wir zuwenig hingucken.<br />
Das glaube ich auch, weil die Integration von den Institutionen<br />
wie Jugendamt, Schule, Kita usw. zu wenig geleistet<br />
wird und vielleicht auch nicht von allen geleistet werden<br />
kann, gibt es hier in unserer Gesellschaft riesige Lücken.<br />
Da sollten wir uns vielleicht überproportional anstrengen,<br />
so habe ich ihn verstanden, als Aufforderung, sich dem<br />
Thema mehr zu stellen.<br />
Benjamin Eberle: Eine Kritik steht mir nicht zu, aber ich<br />
glaube, man weiß oft nicht, was man nicht weiß. Es gibt<br />
einzelne Nachbarschaftshäuser, die gelungene Beispiele<br />
für interkulturelle Zusammenarbeit geben, wo ganz viel<br />
passiert. Aber in den Diskussionen in den Pausen oder<br />
nach den Arbeitsgruppen kam heraus, dass es immer<br />
noch eine ziemlich naive Vorstellung über die Verbindung<br />
der Kulturen gibt. Das ist ein langer Weg für unsere Einrichtungen,<br />
wie bei dem Frauenfrühstück, das seit 20 Jahren<br />
existiert. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, es ist genau<br />
richtig. Nur es kann viel mehr passieren und es kann auch<br />
in viel mehr Einrichtungen passieren. Darum geht es. Das<br />
ist ein langer Weg, aber wir müssen ihn gehen.<br />
Herbert Scherer: Es gibt jemanden, der die Aufgaben formulieren<br />
und uns die Hausarbeit mit auf den Weg geben<br />
kann, nämlich der Vorsitzende unseres Verbandes, Georg<br />
Zinner. Er hat jetzt für diese Tagung das letzte Wort.<br />
Georg Zinner: Wir sind als Nachbarschaftsheime oder<br />
als Mehrgenerationenhäuser tatsächlich eine Instanz,<br />
die zwischen den Familien und den Institutionen vermittelt<br />
und dazu beiträgt, sowohl die Schulen zu verändern,<br />
als auch dazu beiträgt, dass sich in den Familien etwas<br />
verändert. Wir haben mit diesem Thema was ganz Praktisches<br />
aufgegriffen, etwas Naheliegendes und ganz<br />
Einfaches. Ich bin auch glücklich, dass – wie in der Tagung<br />
ein Jahr zuvor – Beispiele aus der Praxis dargestellt<br />
wurden, die beeindruckend belegen, dass sich Nachbarschaftsheime<br />
diesen Aufgaben stellen. Wenn es vielleicht<br />
von der Teilnehmerstruktur her anders aussieht, stellen<br />
sie sich aber natürlich auch den Aufgaben interkultureller<br />
Arbeit, wir sind vielleicht besser, als es scheint.<br />
Ich bin stolz auf die Nachbarschaftsheime, wie sie sich bewegen<br />
und wie sie sich engagieren und einmischen, und<br />
wie viel Selbstbewusstsein sie mittlerweile auch erworben<br />
haben, mit welcher Selbstverständlichkeit sie ihre Aufgaben<br />
angehen. Das ist auch etwas, was mich sehr mutig in<br />
die Zukunft blicken lässt.<br />
<strong>Familiennetze</strong> haben tatsächlich eine Rolle in unserer Gesellschaft<br />
eingenommen. Die Familie selbst, früher eine<br />
sehr bedeutende Institution unserer Gesellschaft, verliert als<br />
tragende Institution an Bedeutung, während andere Beziehungsgeflechte<br />
wie Nachbarschaften wichtiger werden. Da<br />
werden Nachbarschaftshäuser zu gesellschaftlich wichtigen<br />
Instanzen. Ich glaube, dass wir uns mit dem Thema noch intensiver<br />
beschäftigen müssen, welche Rolle wir in unserer<br />
Gesellschaft einnehmen wollen. Man soll sich ja immer wieder<br />
vergewissern, warum man etwas macht. Das wäre vielleicht<br />
auch eine Aufgabe für die Tagung im nächsten Jahr.<br />
Wir werden im nächsten Jahr wieder so eine Tagung veranstalten,<br />
das hat gestern die Mitgliederversammlung gefordert<br />
und unterstützt. Diese Tagungen helfen uns, mit einander im<br />
Austausch zu bleiben, unsere Praxis vor den kritischen Ohren<br />
der Kollegen auf den Prüfstand zu legen, damit wir voneinander<br />
profitieren und lernen können, und nicht in einem geschlossenen<br />
Kreis verharren. Sondern dass wir immer wieder<br />
versuchen, über uns hinaus weitere Einrichtungen für unsere<br />
Aufgaben zu interessieren. Vielleicht holen wir noch mehr Studenten<br />
aus den Fachhochschulen zu dieser Tagung.<br />
Mir bleibt, allen, die hier als Teilnehmer mit dabei waren,<br />
zu danken. Aber ich möchte mich auch bei denen bedanken,<br />
die es mit einem guten Gespür für das, was uns interessieren<br />
könnte, geschafft haben, diese Tagung auf die<br />
Beine zu stellen.<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 149
150<br />
Teilnehmerliste<br />
Keziban Aydin<br />
Dr. Clemens Back<br />
Theda Blohm<br />
Barbara Borchers<br />
Tatjana Borodina<br />
Andrea Brandt<br />
Gabriele Colwin<br />
Paula Diederichs<br />
Monika Döhrmann<br />
Benjamin Eberle<br />
Willy Essmann<br />
Ulrike Feige<br />
Kathrin Feldmann<br />
Gabriele Fichtner<br />
Andris Fischer<br />
Dirk Fischer<br />
Kathrin Fleischer<br />
Heidrun Förster<br />
Theo Fontana<br />
Ursula Franz<br />
Kerstin Gerth<br />
Bernd Giesecke<br />
Reinhilde Godulla<br />
Claudia Grass<br />
Angelika Groß<br />
Christiane Grunau<br />
Kirsten Harnisch-Eckert<br />
Bernhard Heeb<br />
Gisela Hübner<br />
Dr. Konrad Hummel<br />
Bengt Jacobs<br />
Klaus Kaiser<br />
Aicha Katjivena<br />
Anke Kehrmann-Panten<br />
Petra Kindermann<br />
Cordula Kleinfeldt<br />
Semih Kneip<br />
Beate Köhn<br />
Romy Kopp-Gödecke<br />
Heike Kötter<br />
Svetlana Krabel<br />
Michaela Kropp-Schwarzbart<br />
Margritt Küntzel<br />
Oliver Kulitz<br />
Timm Lehmann<br />
Bianca Liwicki<br />
Dr. Eberhard Löhnert<br />
Stadtteilmütter / Diakonisches Werk ▪ www.diakonie-portal.de<br />
K.I.O.S.K. auf dem Rieselfeld e.V. ▪ http://kjk.rieselfeld.org<br />
KREATIVHAUS ▪ www.kreativhaus-tpz.de<br />
Gesundheitsamt Potsdam Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst ▪ www.potsdam.de<br />
Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der ufafabrik e.V. ▪ www.nusz.de<br />
Biffy Berlin - Big Friends for Youngsters e.V. ▪ www.biffy-berlin.de/cms_biffy/<br />
Schreibabyambulanz Berlin ▪ www.schreibabyambulanz.info/paula_diederichs.htm<br />
Mütterzentrum Braunschweig e.V./ Mehrgenerationenhaus ▪ www.muetterzentrum-braunschweig.de<br />
AWO Begegnungszentrum ▪ www.begegnungszentrum.org/startseite.html<br />
Outreach berlin ▪ www.outreach-berlin.de<br />
Tausendfüßler Kinder- und Familiengarten Kaltenkirchen e.V. /Mehrgenerationenhaus Kaltenkirchen ▪ http://tausendfuessler-kaki.de<br />
Stadtkontor GmbH ▪ www.stadtkontor.de<br />
BALL e.V. ▪ www.ball-ev-berlin.de<br />
Verband für sozial-kulturelle Arbeit ▪ www.stadtteilzentren.de<br />
Berlin 21 e.V. ▪ www.berlin21.net<br />
ElKize Teltow-Fläming/Diakonisches Werk<br />
Verband für sozial-kulturelle Arbeit ▪ www.stadtteilzentren.de/<br />
Frei-Zeit-Haus e.V. / Charlotte Treff ▪ http://jugendserver.spinnenwerk.de/~fzh/aussenst/charlotte.htm<br />
Bürgerhaus Bocklemünd ▪ www.buergerschaftshaus.de/<br />
Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V., Projekt Network ▪ www.spinnenwerk.de<br />
Nachbarschaftsheim Schöneberg ▪ www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de<br />
Gesundheitsamt Potsdam Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst ▪ www.potsdam.de<br />
Wellcome-Koordinierungsstelle ▪ www.wellcome-online.de<br />
Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. ▪ www.nbh-neukoelln.de<br />
Verband für sozial-kulturelle Arbeit ▪ www.stadtteilzentren.de<br />
ehemals Stadtrat für Soziales, Jugend, Familie, Frauen, Senioren, Stiftungen und Wohnen in Augsburg<br />
LABYRINTH - Offenes Kinder- und Jugendhaus und Stadtteiltreff ▪ www.im-labyrinth.de<br />
Malteser Hilfsdienst e.V. ▪ www.malteser-berlin.de<br />
Erzieherin<br />
Tausendfüßler Kinder- und Familiengarten Kaltenkirchen e.V. ▪ http://tausendfuessler-kaki.de<br />
Nachbarschaftsetage Fabrik Osloer Straße ▪ www.fabrik-osloer-strasse.de<br />
Verein für ambulante Versorgung, Kita Abenteuerland ▪ www.vav-hhausen.de<br />
Gangway ▪ www.gangway.de<br />
Fachstelle Berliner Notdienst Kinderschutz ▪ www.kindernotdienst.de<br />
Gemeinwesenverein Haselhorst e.V. ▪ www.gemeinwesenverein-haselhorst.de<br />
Mehrgenerationenhaus Königs Wusterhausen ▪ www.mehrgenerationenhaeuser.de<br />
Nachbarschaftshaus Prinzenallee e.V. ▪ www.nachbarschaftshaus-prinzenallee.de<br />
Hippo Kita des KOTTI e.V ▪ www.kotti-berlin.de<br />
Verein für ambulante Versorgung ▪ www.vav-hhausen.de<br />
NBH Mittelhof, Mehrgenerationenhaus Zehlendorf-Süd ▪ www.nachbarschaftsheim-mittelhof.de/1024/mitte-mhaus.htm<br />
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. ▪ www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de<br />
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin ▪ www.paritaet-berlin.de
Manja Mai<br />
Kerstin Mallok-Gerwien<br />
Annette Maurer-Kartal<br />
Isabelle Meyer<br />
Ingrid Müller<br />
Linda Ortleb<br />
Elke Ostwaldt<br />
Waldemar Palmowski<br />
Norman Pankratz<br />
Dr. Lore-Maria Peschel-Gutzeit<br />
Dorothee Peter<br />
Sandra Pietsch<br />
Ulrike Preißer<br />
Christina Putze<br />
Cornelia Rasulis<br />
Barbara Rehbehn<br />
Friedrich Reinsch<br />
Susanne Rinck<br />
Markus Runge<br />
Barbara Rüster<br />
Gerald Saathoff<br />
Marion Scheidler<br />
Dr. Herbert Scherer<br />
Elena Scherer<br />
Gerd Schmitt<br />
Viola Scholz-Thies<br />
Elke Schönrock<br />
Karl-Fried Schuwirth<br />
Petra Sgodda<br />
Petra Sperling<br />
Sandra Stock<br />
Josella Stolz<br />
Haroun Sweis<br />
Joachim Toll<br />
Evelyn Ulrich<br />
Dr. Haci-Halil Uslucan<br />
Dr. Dagmar Voelker<br />
Hanne Voget-Berkenkamp<br />
Gabriele Wegerich<br />
Katrin Wegner<br />
Charlotte Weidenhammer<br />
Torsten Wischnewski<br />
Torsten Wlock<br />
Ute Wollburg<br />
Bettina Zey<br />
Georg Zinner<br />
Outreach - Marzahn-Hellersdorf ▪ www.outreach-berlin.de<br />
Haus der Generationen und Kulturen ▪ http://milanhorst-potsdam.de/blog/<br />
Stadtteilverein Schöneberg e.V. ▪ www.halkkoesesi.de<br />
K.I.O.S.K. auf dem Rieselfeld e.V. ▪ http://kjk.rieselfeld.org/<br />
NBZ Bürger für Bürger ▪ www.volkssolidaritaet-berlin.de/begegnung/bg_bz_mitt_02.html<br />
Jugendamt Steglitz-Zehlendorf ▪ www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/verwaltung/jugend/<br />
Outreach- Mobile Jugendarbeit Treptow-Köpenick ▪ www.outreach-berlin.de<br />
NBH Schöneberg e.V. ▪ www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de<br />
K.I.O.S.K. auf dem Rieselfeld e.V. ▪ http://kjk.rieselfeld.org<br />
Senatorin für Justiz a.D.; Rechtsanwältin ▪ www.fps-law.de/ger/includes/anwaelte/anwalt.php?record%5Bnid%5D=102<br />
Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. ▪ www.nbh-neukoelln.de/<br />
Nachbarschaftszentrum Amtshaus Buchholz ▪ www.amtshaus-buchholz.de<br />
Nachbarschaftsetage Fabrik Osloer Straße ▪ www.fabrik-osloer-strasse.de<br />
KREATIVHAUS ▪ www.kreativhaus-tpz.de<br />
DPW Geschäftsstelle Bezirke ▪ www.paritaet-berlin.de<br />
Bürgerhaus am Schlaatz ▪ www.buergerhaus-schlaatz.de<br />
Verein Soziale Stadt Potsdam e.V. ▪ www.soziale-stadt-potsdam.de<br />
Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. ▪ www.nachbarschaftshaus.de<br />
Gemeinwesenverein Heerstr. Nord ▪ www.treffpunkt-heerstrasse.de<br />
NBH Mittelhof ▪ www.nacharschaftsheim-mittelhof.de<br />
Freizeithaus Weißensee / Selbsthilfe-Kontaktstelle ▪ www.frei-zeit-haus.de<br />
Verband für sozial-kulturelle Arbeit ▪ www.stadtteilzentren.de<br />
Verband für sozial-kulturelle Arbeit ▪ www.stadtteilzentren.de<br />
Kiezoase Schöneberg / PFH ▪ www.pfh-berlin.de/index.php?/de/inhalt/mehrgenerationenhaus_kiezoase<br />
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. ▪ www.treffpunkt-heerstrasse.de<br />
Gemeinwesenverein Haselhorst e.V. ▪ www.gemeinwesenverein-haselhorst.de<br />
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. ▪ www.nachbarschaftshaus-wiesbaden.de<br />
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. ▪ www.treffpunkt-heerstrasse.de<br />
Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. ▪ www.treffpunkt-heerstrasse.de<br />
Stadtschloß Moabit, Moabiter Ratschlag e.V. ▪ www.moabiter-ratschlag.de<br />
Tauschring Charlottenburg ▪ www.tauschring-charlottenburg.de.vu<br />
Outreach Berlin ▪ www.outreach-berlin.de<br />
Verband für sozial-kulturelle Arbeit ▪ www.stadtteilzentren.de<br />
Nachbarschaftshaus am berl ▪ www.vav-hhausen.de/web/inhalt/nbshaus.html<br />
Europäisches Integrationszentrum - Akademie für interkulturelles Management ▪ http://uslucan.eiz-berlin.de<br />
Ärztin für Neurologie und Psychiatrie , Leipzig<br />
Jugend- und Familienzentrum im Nachbarschaftsheim Schöneberg ▪ www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de<br />
Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V. ▪ www.nachbarschaftshaus-wiesbaden.de<br />
TÄKS e.V. / Kiezinseln ▪ www.taeks.de/familie-und-nachbarschaft/kiezinseln<br />
Menschenskinder - Werkstatt für Familienkultur e.V. ▪ www.menschenskinder-darmstadt.de<br />
Pfefferwerk Berlin ▪ www.pfefferwerk.net/stadtkultur/aktuelles/start_aktuell.php<br />
Netti-Internetwerkstatt ▪ www.spinnenwerk.de/netti/<br />
Zeig-Courage ▪ www.zeig-courage.de<br />
Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V. ▪ www.nachbarschaftsheim-mittelhof.de<br />
Nachbarschaftsheim Schöneberg ▪ www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de<br />
<strong>Familiennetze</strong> - Jahrestagung Stadtteilarbeit 2008 151
152 Impressum<br />
Impressum<br />
Der <strong>Rundbrief</strong> wird herausgegeben vom<br />
Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.<br />
Tucholskystraße 11, 10117 Berlin<br />
Telefon: 030 280 961 03<br />
Fax: 030 862 11 55<br />
Email: bund@sozkult.de<br />
Internet: www.vska.de<br />
Redaktion: Herbert Scherer<br />
Gestaltung: Hulitschke Mediengestaltung<br />
Druck: Agit-Druck Berlin<br />
Der <strong>Rundbrief</strong> erscheint halbjährlich<br />
Einzelheft: 5 Euro inkl. Versand