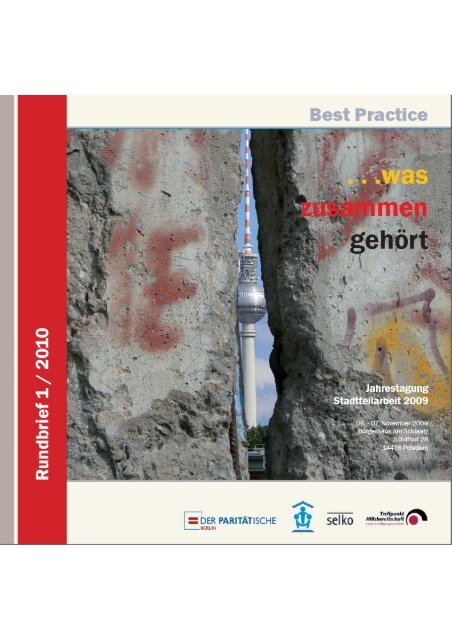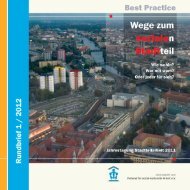Rundbrief 1-2010 - Verband für sozial-kulturelle Arbeit
Rundbrief 1-2010 - Verband für sozial-kulturelle Arbeit
Rundbrief 1-2010 - Verband für sozial-kulturelle Arbeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Was zusammen gehört ...<br />
Jahrestagung Stadtteilarbeit 2009<br />
veranstaltet vom <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> e.V.<br />
vom 06. - 07. November 2009<br />
im Bürgerhaus Am Schlaatz<br />
Schilfhof 28<br />
14478 Potsdam
2<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
4 - 10<br />
11 - 22<br />
23 - 39<br />
40 - 53<br />
54 - 65<br />
66 - 81<br />
82 - 98<br />
99 - 115<br />
116 - 131<br />
132 - 146<br />
147 - 152<br />
153<br />
154 - 155<br />
Anfangsplenum: Joachim Walther<br />
20 Jahre Mauerfall<br />
eine Zwischenbilanz<br />
Workshop: Frauen-Power<br />
Ostfrauen begegnen Westfrauen<br />
Workshop: Jugend – Herausforderungen<br />
Jugendarbeit begegnet Nachbarschaftsarbeit<br />
Workshop: Integrations-Perspektiven<br />
„Eingeborene“ begegnen Migranten<br />
Workshop: Ost/West-Begegnungen<br />
Ossis begegnen Wessis<br />
Workshop: Kultur-Botschaften<br />
Sozial-Kultur begegnet Sozio-Kultur<br />
Workshop: Stadtteil-Entdeckungen<br />
Gemeinwesenarbeit begegnet Quartiersmanagement<br />
Workshop: Organisations-Erfahrungen<br />
Schnelles Wachstum begegnet langsamem Wachstum<br />
Workshop: Gründungs-Impulse<br />
Neue Initiativen begegnen „alten Hasen“<br />
Workshop: Berufs-Bilder<br />
Ausbildung begegnet Praxis<br />
Abschlussplenum Konrad Hummel<br />
Woher wir kommen und wohin wir gehen<br />
Herausforderungen, Problemlösungen, Chancen<br />
‚Wendezeiten‘ Schwarz / Weiß Fotografi en von Harald Hauswald<br />
Teilnehmerliste
Vorwort<br />
Was zusammen gehört ...<br />
Vorwort zur Dokumentation<br />
Unsere Jahrestagung hat wenige Tage vor dem 9. November 2009 stattgefunden, der 20<br />
Jahre nach der Maueröffnung Anlass <strong>für</strong> vielfältige Rückerinnerungen war. Wir haben uns<br />
mit unserem Thema bewusst in diesen Zusammenhang gestellt, um uns dessen bewusst<br />
zu werden, was sich <strong>für</strong> uns und unsere <strong>Arbeit</strong> durch diesen historischen Umbruch, aber<br />
auch sonst in den letzten 20 Jahren bewegt und verändert hat.<br />
Wir haben da<strong>für</strong> wieder eine Form gewählt, in der sich persönliche und fachliche<br />
Perspektiven überschneiden. Aus den individuellen Erinnerungen, die dabei im<br />
Vordergrund stehen, entfaltet sich wie bei einem Puzzle in der Summe ein buntes und<br />
facettenreiches Gemälde.<br />
Wir haben uns bei der Wiedergabe der Diskussionen in den <strong>Arbeit</strong>sgruppen eng an<br />
das gesprochene Wort und den originalen Gesprächsverlauf gehalten. Was dadurch<br />
an Stringenz mancher Argumentationslinie fehlt, wird u.E. mehr als aufgewogen durch<br />
die spürbare Nähe zum realen Geschehen, zum engagierten offenen und freimütigen<br />
Austausch, der – wie in den Vorjahren – den besonderen Charakter unserer Tagung<br />
ausgemacht hat. Dem/der Leser/in der Dokumentation wird das Gefühl vermittelt, dabei<br />
gewesen zu sein. Und allen, die dabei waren, wird die Chance gegeben, die Diskussionen<br />
auch in den <strong>Arbeit</strong>sgruppen quasi „live“ zu erleben, die parallel getagt haben.<br />
Es war eine spannende Tagung, nicht zuletzt, weil sie an vielen Stellen Einblicke in<br />
Sichtweisen und Befi ndlichkeiten ermöglicht hat, die uns in unserem Handeln und<br />
im Umgang miteinander beeinfl ussen, ohne dass wir uns dessen in der Regel im<br />
Alltagsgeschehen bewusst sind. Einmal innehalten, sich erinnern und daraus Kraft <strong>für</strong> die<br />
Bewältigung der zukünftigen Aufgaben schöpfen: das ist der tiefere Sinn einer solchen<br />
Tagung – und das will auch die Dokumentation ermöglichen.<br />
Wir wünschen uns und Ihnen, unseren Lesern, dass das gelingt!<br />
Herzlichen Dank allen, die uns bei der Planung und Durchführung der Tagung und bei der<br />
Aufbereitung der Materialien <strong>für</strong> die Dokumentation geholfen haben: Constanze Reder <strong>für</strong><br />
die Mitwirkung bei der Vorbereitung, Gitty Czirr und Margot Weblus <strong>für</strong> die Bearbeitung<br />
der Tonaufzeichnungen, Gabriele Hulitschke <strong>für</strong> die grafi sche Gestaltung, den Kolleginnen<br />
und Kollegen aus dem Bürgerhaus am Schlaatz <strong>für</strong> die Logistik, allen Moderatorinnen<br />
und Moderatoren <strong>für</strong> die Leitung der <strong>Arbeit</strong>sgruppen, den Impulsgeber/innen <strong>für</strong> die<br />
Aufbereitung ihrer Erinnerungen und Harald Hauswald <strong>für</strong> die Wende-Fotos.<br />
Mit freundlichem Gruß<br />
Herbert Scherer<br />
Geschäftsführer
Anfangsplenum<br />
20 Jahre Mauerfall<br />
eine Zwischenbilanz<br />
Joachim Walther<br />
Schriftsteller<br />
Die Deutschen 20 Jahre nach dem Mauerfall: vereint<br />
und doch geteilt. Vereint als Volk, geteilt in ihrer Meinung<br />
über diese Vereinigung. Die einen sind enttäuscht.<br />
Die anderen zufrieden. Ein Drittel sieht <strong>für</strong> sich sowohl<br />
Gewinne als Verluste. Umfragen und statistische Erhebungen<br />
ergeben ein verwirrendes Bild. Besonders wirr<br />
ist es hier in Ostdeutschland. Da sagen 54 Prozent<br />
der Leute, die Lage in den neuen Bundesländern habe<br />
sich seit 1990 generell verbessert. Gleichzeitig beklagt<br />
jeder vierte Ostdeutsche, dass es ihm heute schlechter<br />
gehe als vor 1989. Im Westen schimpfen viele, <strong>für</strong> den<br />
Osten abkassiert zu werden. Im Osten wird gemurrt,<br />
vom Westen ausgenutzt zu sein. Die Emotionen branden<br />
hoch, die wechselseitigen Vorurteile stehen in<br />
schönster Blüte, das gefühlte Binnenklima ist kälter als<br />
das gemessene, der geäußerte Unmut lauter als Dankbarkeit<br />
und Freude. Manchmal will mir scheinen, ich<br />
lebte in einem anderen Land als viele der schmollenden<br />
Mitbewohner, und ich frage mich, wo bei dieser subjektiven<br />
Wahrnehmung und Bewertung das Faktische, das<br />
sichtbar Erreichte und die ökonomische Bilanz bleiben?<br />
Vor allem: Wie war vor 20 Jahren die zu berücksichtigende<br />
Ausgangslage?<br />
Haben sich doch dazumal zwei extrem ungleiche Partner<br />
vereint. Der eine brachte vier Fünftel der Masse auf die<br />
Waage, war politisch stabil, ökonomisch effi zient und fi nanziell<br />
vermögend. Der andere, wirtschaftlich ausgezehrt,<br />
technologisch 20 Jahre zurück und politisch in Aufl ösung,<br />
hatte naturgemäß die entsprechend längeren Wege: von<br />
der Diktatur zur Demokratie und von der Planwirtschaft<br />
zur Marktwirtschaft. Für den einen blieb zunächst alles<br />
beim Alten, <strong>für</strong> den anderen änderte sich alles. Und das<br />
war nicht der Bosheit des Dickeren geschuldet, sondern<br />
war die logische Folge des Exposés, das die Geschichte<br />
höchst selbst geschrieben hatte. Und heute? Zwar ist die<br />
Ehe vollzogen, aber ein Abstand geblieben, der jedoch<br />
schrumpft. Lag der Anteil der ostdeutschen Wirtschaft an<br />
der gesamtdeutschen Industrieproduktion 1992 gerade<br />
mal bei 3,4 Prozent, so ist der heute auf knapp 10 Prozent<br />
gestiegen. Für notorische Nostalgiker nebenbei bemerkt:<br />
Damit ist die ostdeutsche Industrieproduktion höher als<br />
zu DDR-Zeiten. Und dennoch lebt Ostdeutschland über<br />
seine Verhältnisse, was heißt, der fi nanzielle Transfer aus<br />
dem Westen ist größer als das im Osten Erwirtschaftete.<br />
Oder anders: Bei der Wirtschaftsleistung liegt der Ostdeutsche<br />
pro Kopf bei 70 Prozent des Westdeutschen,<br />
beim verfügbaren Einkommen jedoch bei 80 Prozent<br />
des Westniveaus. Das will mir nicht unbedingt ungerecht<br />
erscheinen, obwohl die Angleichung auf 100 Prozent weiter<br />
auf der politischen Agenda steht. Und auch wenn das<br />
Folgende so gar nicht zur Stimmung zu passen scheint, so<br />
gibt es doch schon einige ostdeutsche Überholvorgänge.<br />
Beispielsweise besitzen 57 Prozent der Ostdeutschen ein<br />
Auto, im Westen sind es nur 51 Prozent. Oder nehmen wir<br />
Suhl und Flensburg: In Thüringen verfügen die Einwohner<br />
der Stadt im Schnitt jährlich über 16.879 Euro, in Schleswig-Holstein<br />
dagegen nur über 14.874 Euro. Ich weiß,<br />
Zahlen sind geduldig, deshalb genug davon und hin zur<br />
subjektiven Wahrnehmung und Bewertung des ganzen.<br />
Da gibt es das Drittel der Unzufriedenen, doch haben<br />
nicht alle die gleichen Gründe. An der Spitze die 1989<br />
gestürzten Machteliten-Ost, denen mein Mitgefühl am<br />
wenigsten gilt, da sie in der Regel besser berentet sind als<br />
die meisten ihrer Opfer. Dann die nicht Wenigen, deren
Freude über die deutsche Einheit von der nachfolgenden<br />
<strong>Arbeit</strong>slosigkeit zermahlen wurde, zumal die <strong>Arbeit</strong> im<br />
Osten <strong>sozial</strong> höher bewertet war und also das Schicksal<br />
des erzwungenen Nichtstuns mental verschärft erlitten<br />
wird. Sie hat es wirklich hart getroffen, und es ist kein<br />
Trost <strong>für</strong> sie zu wissen, dass 1990 nur zwei Prozent der<br />
DDR-Industrie weltmarktfähig und also überlebensfähig<br />
war. Da gibt es auch die geschürte Unzufriedenheit der<br />
<strong>sozial</strong> Abgestiegenen und Alimentierten durch die Linken<br />
und die Rechten. Apropos Linke. Gestatten Sie mir dazu<br />
einen kleinen Exkurs, da wir uns hier gerade in der Landeshauptstadt<br />
Potsdam befi nden.<br />
Wie Sie wissen, droht Rot-Rot im Lande Brandenburg.<br />
Vor zwanzig Jahren hielt ich es <strong>für</strong> völlig ausgeschlossen,<br />
jemals wieder von den Nachfahren der Einheitspartei<br />
regiert oder mitregiert zu werden. Für mich, <strong>für</strong> viele, die<br />
die SED und die, die sie geführt und getragen haben, nie<br />
wieder an der Macht sehen wollten, war und bleibt das<br />
der demokratische Lackmus-Test. Nun ist das Papier im<br />
Reagenzglas Brandenburg wieder rot, dunkelrot. Ministerpräsident<br />
Platzeck und die Brandenburger SPD sind wild<br />
entschlossen, die SED-Nachfolgepartei an die Teilhabe<br />
der Macht zu hieven. Der Teufel, der sie dabei reitet, ist<br />
der bundesweite Stimmen- und Bedeutungsverlust der<br />
SPD, den die <strong>sozial</strong>demokratischen Linken stoppen möchten<br />
durch ein Kuschelvorspiel und eine schlussendliche<br />
Vereinigung mit der postkommunistischen Linken. Statt<br />
panisch die Flucht nach vorn anzutreten, sollten sich die<br />
Sozialdemokraten auf die inhaltlich wie historisch wohl<br />
begründete Differenz zu den Kommunisten besinnen,<br />
haben sie doch ihre Erfahrungen mit denen gemacht: in<br />
der Weimarer Republik, bei der Zwangsvereinigung, den<br />
Verfolgungen danach, der Demontage Willy Brandts, um<br />
nur einiges zu nennen. Alles vergessen und vergeben?<br />
Vergessen die Vorgänge nach der deutschen Einheit: das<br />
trickreiche Mauscheln mit dem SED-Vermögen, der hinhaltende<br />
Widerstand gegen die Aufarbeitung der zweiten<br />
deutschen Diktatur, der Stimmenfang mit populistischem<br />
Schalmeienspiel und all die andere unglaubwürdige Anpassungsakrobatik?<br />
Vergessen auch, wer da in Brandenburg<br />
zur Machtteilhabe drängt? Der taktische Verzicht der sin-<br />
genden Prinzipalin auf ein Ministeramt ist so durchsichtig<br />
wie peinlich, wenngleich der Grund wenig überraschend<br />
ist: Auch sie diente der Staatssicherheit einst als Spitzel.<br />
Die anderen inoffi ziellen Stasi-Mitarbeiter an der Linkenspitze<br />
scheinen da nicht mehr zu zählen, auch dass die<br />
Mehrheit der linken Landtagsfraktion selbstverständlich<br />
früher schon Genosse war, stört nicht. Jedenfalls nicht<br />
im Lande Brandenburg, das der vormalige Ministerpräsident<br />
und einst als IM „Sekretär“ geführte Manfred Stolpe<br />
launisch als „kleine DDR“ bezeichnete. So ganz daneben<br />
lag und liegt er dabei nicht. Nach 15 Jahren Brandenburg-Erfahrung<br />
habe ich den Eindruck, nirgendwo sonst<br />
in Deutschland geht es derart ideologisch zu, nirgendwo<br />
sonst ist die Stimmung so politisch polarisiert, nirgendwo<br />
sonst gefällt man sich so in Geschichtsvergessenheit<br />
und nostalgischer Rückwendung, nirgendwo sonst wird<br />
die Demokratie so massiv geschmäht und die gewonnene<br />
Freiheit verschmäht wie hier. Und nicht zufällig installierte<br />
Brandenburg als letztes neues Bundesland einen Stasi-<br />
Beauftragten. Neulich sagte eine Buchhändlerin eine vereinbarte<br />
Lesung mit der Begründung ab, sie wolle keinen<br />
Ärger bekommen mit ihrer Hauptkundschaft. So weit sind<br />
wir gekommen. Stolpes langer Schlagschatten liegt noch<br />
immer über dem Land. Der gegenwärtige und zukünftige<br />
Ministerpräsident ist dessen politischer Ziehsohn, hielt<br />
ihm die Hand in schweren Tagen und meint nun, auch<br />
der Linken die Hand reichen zu müssen. Die zwei Hände<br />
im Emblem, das kennen wir schon. Und falls es an einem<br />
Parteinamen <strong>für</strong> die fi nale Fusion mangelt, so habe ich<br />
einen politisch probaten Vorschlag parat. Wie wäre es<br />
denn mit: Sozialistische Einheitspartei Deutschland? Das<br />
Kürzel da<strong>für</strong> lautet: SED.<br />
Doch weiter mit den Unzufriedenen. Da gibt es die ewigen<br />
Nostalgiker, die alle Vergangenheiten verklären und<br />
die prinzipiell früher alles besser fanden. Und da gibt es<br />
die enttäuschten illusionären Erwartungen, materiell wie<br />
ideell. Materiell war es eine märchenhafte Hoffnung, dass<br />
sich auf einen Schlag die Lebensverhältnisse im Osten auf<br />
das Westniveau heben würden, und das fatale Kanzlerwort<br />
von den blühenden Landschaften hat das seine dazu<br />
getan. Und ideell gibt es die, die das Ende der Revolution<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 5
6<br />
Anfangsplenum<br />
bedauern, wobei die Forderung nach einer permanenten<br />
Revolution in etwa so gescheit ist wie das Verlangen nach<br />
dem permanenten Orgasmus. Ich <strong>für</strong> meinen Teil bin froh<br />
und dankbar, in meinem Leben eine friedliche und gelungene<br />
Revolution erlebt zu haben, dazu noch in Deutschland,<br />
wo der Revolutionär, bevor er den Bahnhof besetzt,<br />
bekanntlich vorher eine Bahnsteigkarte löst. Diese<br />
Revolution war ein einmaliger Glücksfall der Geschichte,<br />
denn wann bricht schon mal ein Staat zusammen, dazu<br />
ein derart hochgerüsteter? Andere sehen darin freilich<br />
eher einen Grund zur Trauer, und mitunter ist mir, als<br />
säßen die Unzufriedenen in einer rot befl aggten Wagenburg,<br />
an deren Lagerfeuer sie die alten Lieder singen, in<br />
der Asche nach utopischer Restglut stochern und über<br />
einen dritten Weg oder, schlimmer noch, einen zweiten<br />
Sozialismus-Versuch sinnieren. Natürlich ist die trutzige<br />
Wagenburg umritten von westdeutschen Desperados, die<br />
alle Habseligkeiten und so genannten Errungenschaften,<br />
selbst die Biografi en und Identitäten, rauben möchten:<br />
Eine Halluzination, die das Flimmern der Freiheit im nicht<br />
ummauerten Raum als bedrohliche Wüste wahrnimmt.<br />
Die Freiheit erscheint als Leere, als Bindungslosigkeit und<br />
Zumutung. Gegen diese Bedrängnis helfen nur stärkste<br />
Psychopharmaka: Verdrängen und Verklären des Vergangenen,<br />
Dämonisieren des Gegenwärtigen und Schwarzmalen<br />
des Zukünftigen, dazu der Traum aller Träume<br />
von einer <strong>sozial</strong> egalitären Welt, die sie an den Horizont<br />
projizieren und sich wundern, dass die sich entfernt, je<br />
näher sie ihr zu kommen glauben. Der Verlust der Utopie<br />
macht ihnen schwer zu schaffen. Dabei war die Überzeugung,<br />
auf einem heilsgeschichtlichen Weg zu sein, eine<br />
ideologische Selbstverzauberung, die offenbar einfachste<br />
sittliche Regeln außer Kraft setzen konnte, freilich als<br />
Ausdruck einer überlegenen, neuen Moral, die sich als<br />
Klassenmoral im Klassenkampf verstand und Täuschung,<br />
Terror und Verrat als Instrumente der Geburtshilfe akzeptierte,<br />
um vom „Reich der Notwendigkeit“ (nach Marx) ins<br />
kommunistisch-chiliastische „Reich der Freiheit“ zu gelangen.<br />
Brecht, revolutionär reduktionistisch, in seinem Agitationsstück<br />
„Die Maßnahme“: „Wer <strong>für</strong> den Kommunismus<br />
kämpft, hat von allen Tugenden nur eine: dass er <strong>für</strong><br />
den Kommunismus kämpft.“ Doch birgt eine Geschichts-<br />
auffassung in der geistesgeschichtlichen Tradition von<br />
Hegel und Marx, die der Geschichte eine gesetzmäßige<br />
Zielrichtung mit einem heilsgeschichtlichen Horizont<br />
gab, <strong>für</strong> deren Anhänger stets die Gefahr, von der Politik,<br />
die sich solcher Ideen bemächtigt, instrumentalisiert<br />
oder, bei Abweichen von dieser ideologisch kanonisierten<br />
Heilserwartung, denunziert zu werden: als Ketzer, Revisionisten,<br />
Skeptizisten und Renegaten. Die Furcht wird<br />
Wahn, der Wahn Methode, die Furcht, das Volk, der große<br />
Lümmel, könnte seiner Zunge mächtig werden - wie es<br />
denn auch im Herbst 1989 hierorts geschah. Woraus <strong>für</strong><br />
mich aus allem folgt: Sozialutopien, um Himmels willen,<br />
nein, danke – Visionen aber, die weiter reichen als eine<br />
Legislaturperiode des deutschen Bundestages, um unser<br />
aller Überleben willen, ja!<br />
Nun jedoch zu den Zufriedenen, die der menschlichen<br />
Natur gemäß, entsprechend langweiliger scheinen. Das<br />
sind jene, die eine gute <strong>Arbeit</strong> und ein gutes Einkommen<br />
gefunden und deren Wohnverhältnisse sich erheblich verbessert<br />
haben, die genießen können, was es zu kaufen<br />
und in der großen, weiten Welt zu sehen gibt. Da sind<br />
auch die nachgewachsenen Generationen, denen die<br />
DDR historisch ebenso fern ist wie das deutsche Kaiserreich,<br />
<strong>für</strong> die Demokratie, Grundrechte und Weltoffenheit<br />
Selbstverständlichkeiten sind. Und schließlich, nicht zu<br />
vergessen, sind da die Opfer und politisch Verfolgten, die<br />
noch immer froh sind, dass der kommunistische Paradies-Versuch,<br />
der in die Hölle von Workuta oder Bautzen<br />
führte, sein Ende fand, und die darauf bestehen, die Diktatur<br />
eine Diktatur zu nennen. Was bei manchem neuen<br />
Funktionär selbst heute noch zu Stirnrunzeln führt und<br />
auch vor dem Fall der Mauer nicht gern gehört war, im<br />
Osten sowieso, doch wunderlicherweise auch in manchen<br />
Gegenden des Westens nicht.<br />
Deshalb ein weiterer Exkurs, ein kurzer Blick in den Rückspiegel<br />
West. Vor dem Untergang der DDR war es in der<br />
dominanten DDR-Forschung und Literaturgeschichtsschreibung<br />
der Bundesrepublik weitgehend verpönt,<br />
den Begriff Diktatur zu gebrauchen. Man schonte die<br />
DDR und schonte die eigenen Illusionen, freilich um den
Preis nicht nur einer Linsentrübung des Auges, sondern<br />
einer bewussten Wahrnehmungsverweigerung, um das<br />
aus linker Sicht weltwichtige Experiment, eine Utopie zu<br />
realisieren, freundlich zu begleiten, was denen im Osten<br />
als zynischer Snobismus erscheinen musste, aus komfortablem<br />
Abstand zu betrachten, ob und wie die Versuchspersonen<br />
das Experiment überstanden. Nach dem<br />
Untergang des sowjetischen Imperiums und der Epochen-<br />
Illusion auch im Westen, sucht man nun den treffenden<br />
Begriff Diktatur mit mildernden Epitheta zu schönen. So<br />
etwa fand Günter Grass, die DDR sei eine „kommode“<br />
Diktatur gewesen. Ihm und allen, die das auch gern glauben<br />
möchten, empfehle ich so freundlich wie dringlich<br />
einen tiefen Blick ins offene Archiv der DDR-Verbrechen,<br />
und wenn sie nach der Kenntnisnahme der 43.000 Toten<br />
der Speziallager nach 1945, den Zahlen und Schicksalen<br />
der politischen Häftlinge, der im stalinistischen<br />
Gulag Verschwundenen, der in der Aktion „Ungeziefer“<br />
Zwangsumgesiedelten, der willkürlich Enteigneten und<br />
zwangsadoptierten Kinder, wenn sie nach der Lektüre<br />
der massenhaften Spitzelberichte, Verhörprotokolle und<br />
Gerichtsakten, des Missbrauchs von Minderjährigen als<br />
Inoffi zielle Mitarbeiter der Staatssicherheit, der detaillierten<br />
Maßnahmepläne zur psychischen Vernichtung<br />
(„Zersetzung“ genannt), der Berichte über erschossene<br />
Mauerfl üchtlinge mit den buchhalterischen Anmerkungen<br />
über den zu hohen Munitionsverbrauch pro Tötung oder<br />
der fertigen Pläne <strong>für</strong> die Isolierungslager Ende der achtziger<br />
Jahre, den minutiös und namentlich festgelegten<br />
Verhaftungslisten nebst Einsatzort, Uhrzeit, Anzahl und<br />
Bewaffnung der Häscherkommandos noch immer meinen,<br />
die DDR-Diktatur sei „kommod“ gewesen, dann ist<br />
ihnen nicht zu helfen.<br />
Nun zu dem letzten Drittel derer, zu denen ich mich zähle.<br />
Sie sehen beides: Gewinn und Verlust, Glück und Gefahr,<br />
Fortschritt und Defi zit. Sie wissen die gewonnenen persönlichen<br />
Freiheiten zu schätzen und sehen die wesentlichen<br />
Forderungen der friedlichen Revolution erfüllt: Fall<br />
der Mauer, das Aus <strong>für</strong> die Staatssicherheit, die deutsche<br />
Einheit und in deren Gefolge die demokratischen Grundrechte<br />
Reisefreiheit, Meinungsfreiheit und Wahlfreiheit.<br />
Ebenso wichtig, wenn nicht weitaus wichtiger ist ihnen, ist<br />
mir jedoch die Befreiung von der Angst. Die Staatssicherheit<br />
und die anderen Gewaltorgane der SED waren übel<br />
genug, doch waren sie nicht der Kern des Übels. Unheilvoller<br />
war, dass sie durch ihre Allgegenwart und die ständige<br />
Drohung einen gesellschaftlichen Raum der Angst<br />
erzeugten, in dem das Virus der Furcht in die Innenwelten<br />
der Beherrschten eindrang und dort seine verheerende<br />
Wirkung des Abtötens und Lähmens verrichtete, des Abtötens<br />
und Lähmens von Widerspruch und alternativem<br />
Denken. Die Zensur erzeugt die Selbstzensur und wo das<br />
freie Wort unter Kuratel und Strafe steht, auferlegt sich<br />
der Mensch nach dem gelernten Schweigen zum Selbstschutz<br />
letztlich Denkblockaden. Diese tief verinnerlichte<br />
Angst vor dem zu weit gehenden Denken ist die subtilste<br />
und zugleich <strong>für</strong>chterlichste Tiefenwirkung einer Diktatur.<br />
Das Machtmittel Angst war bis zuletzt konserviert in der<br />
Funktionärsformel: Wir können auch anders! Und das<br />
meinte die Option der nackten Gewalt, den Griff zur chinesischen<br />
Lösung, die noch im Oktober 1989, nicht nur<br />
in Leipzig, real drohte.<br />
Vor diesem düsteren Geschichtshintergrund wirkt die<br />
gegenwärtige Welt erfreulich hell, möglicherweise heller,<br />
als sie es tatsächlich ist. Und doch kann ich mich freuen<br />
über die auferstandenen Altstädte, sind mir doch die<br />
traurigen Bilder des Verfalls ins Hirn gebrannt. Kann mich<br />
freuen, lesen zu dürfen, was ich möchte, weil ich mich<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 7
8<br />
Anfangsplenum<br />
gut erinnern kann, was früher alles auf dem Index stand.<br />
Kann mich freuen, visumfrei frei und kurz entschlossen<br />
über den Brenner zu fahren, wo doch Rom und Sizilien<br />
lange auf der weltabgewandten Seite des Mondes lagen.<br />
Kann mich freuen über das Nachtleben und die Kneipendichte<br />
im Prenzlauer Berg, hatte ich mir doch solch<br />
eine Szenelebendigkeit zu meinen Studentenzeiten auch<br />
gewünscht.<br />
Die anhaltende Freude über die Angstfreiheit heißt jedoch<br />
nicht, unkritisch oder blind gegenüber den neuen Problemen<br />
zu sein.<br />
Zu DDR-Zeiten hingen über meinem Schreibtisch Hölderlins<br />
Verse aus dem Gedicht „Hälfte des Lebens“: Die Mauern<br />
stehn / Sprachlos und kalt, im Winde / Klirren die<br />
Fahnen. Für mich damals die historische Reprise einer<br />
in die Realität gesprungenen und scharf empfundenen<br />
Metapher.<br />
Derzeit hängt über meinem Schreibtisch auch ein Hölderlin-Zitat,<br />
ebenfalls mit Wind und Fahne, doch ist der Sinn<br />
ein völlig anderer: Die Sonne gehet hoch darüber und<br />
färbet das Blech, im Winde aber oben stille krähet die<br />
Fahne. Das Gedicht heißt „In lieblicher Bläue“. Zwanzig<br />
Jahre nach dem Mauerfall scheint mir diese Metapher<br />
von bestürzender Aktualität.<br />
Den frostklirrenden Fahnen, doch nicht dem Wind entkommen,<br />
erweist sich die Zeit als größtes Problem. Wenn wir<br />
Zeugen einer Wende waren, so einer Zeiten-Wende. Die<br />
Mauer war auch eine Barriere gegen die Zeit, ein ebenso<br />
martialischer wie lächerlicher Versuch der in Schildagorsk<br />
gebürtigen Genossen, die Zeit aufzuhalten. Ein Haarriss<br />
in der Zeitmauer genügte - und die westliche Weltzeit<br />
strömte ein als Flut, die die östliche Binnenzeit hinwegschwemmte<br />
von Wernigerode bis Wladiwostok. Ich hatte<br />
die gesetzte Zeit, die eine verstaatlichte war und zum<br />
Ende hin stagnierte und fast stillestand, über die Jahre<br />
und Jahrzehnte verinnerlicht und zu meinem Biorhythmus<br />
werden lassen, und habe nun meine liebe Mühe mit dem<br />
neuen Metronom, das schneller tickt als ich die Tasten<br />
fi nde. Die im Westen sind im Takt geblieben, und mancher<br />
meint beim Anblick der aus dem Rhythmus gekommenen<br />
Ostler, er sei der Sieger dieser historischen Klavierstunde.<br />
Der Überlegene hat seine Zeit gesetzt und glaubt fatalerweise,<br />
diese gelte nun weltweit und <strong>für</strong> alle Zeiten bis ans<br />
Ende der Geschichte. Das allerdings könnte tatsächlich<br />
der Anfang vom Ende sein, denn die Weltzeit ist wertfrei,<br />
sie egalisiert Grenzen und öffnet Räume, ohne sie<br />
jedoch mit etwas zu füllen außer dem großen Beschleuniger<br />
Geld. Das Geld verbindet Wirtschaftsräume, lässt<br />
die inneren Räume jedoch leer. Die Sinnfrage bleibt, es<br />
sei denn, das Geld nimmt sich selbst als letzten Sinn und<br />
hält eine <strong>für</strong> alle verbindliche Ethik und einen allseits<br />
akzeptierten neuen Wertekanon <strong>für</strong> überfl üssig, da sich<br />
das nicht rechnen lässt. Wer den globalen Triumph der<br />
Weltzeit zum Endsieg des Bestehenden stilisiert, übersieht<br />
die latente Gefahr: Die Barbarei lauert dicht unterm<br />
bunten Blech der Zivilisation. „Am Ende der Aufklärung<br />
steht das Goldene Kalb“, so Max Frisch 1986. Doch auch<br />
das Blattgold des Kalbes blättert, und die Sonne gehet<br />
hoch darüber und färbet das Blech: das trotz der Krisen<br />
weiter umtanzte Idol unter den krähenden Fahnen des<br />
globalen Marketing.<br />
Der gesellschaftliche Umbruch von 1989/90 hat uns<br />
zwar das erfreuliche Ende einer Diktatur gebracht, doch<br />
nicht den dringend notwendigen Werte-Wandel, nicht den<br />
Umbau des herrschenden Paradigmas. Trotz des galop-
pierenden Klimawandels, der unübersehbaren Umweltkrise<br />
und des akuten Finanzdesasters ist keine grundlegende<br />
Transformation unserer Kultur erkennbar, die<br />
sich von Wachstumswahn und instrumenteller Vernunft<br />
verabschiedet und das konsequente Umdenken einleitet,<br />
hin zu einer von unten kommenden, solidarischen Weltgemeinschaft<br />
der Verantwortung, der Balance von Mensch<br />
und Natur. Und dabei geht es nicht um neue Parteien,<br />
sondern um eine weltweit kooperierende, neue Haltung<br />
des Einzelnen. Der einst den Blick verstellende und nun<br />
fortgefallene, kräfteverschleißende Ost-West-Showdown<br />
gibt den Blick frei auf den neuen Gegner: auf uns selbst.<br />
Sind wir, die wir heute massiv Kredite bei der Natur aufnehmen,<br />
Zinsen und Tilgung jedoch den nachfolgenden<br />
Generationen überlassen, tatsächlich weiter im Kopf als<br />
beispielsweise der Reisbauer im Gleichnis, der all seine<br />
Reispfl anzen ein Stück in die Höhe zog, um schneller den<br />
maximalen Ertrag zu erreichen, und am Ende nichts in<br />
den Händen hielt? Was leitet uns nach dem trügerischen<br />
und machtmissbrauchten Prinzip Hoffnung? Ernst Bloch<br />
beschrieb die enttäuschte Hoffnung als ein Gespenst,<br />
das den Rückweg zum Friedhof verloren hat. Das Prinzip<br />
Verantwortung, das einen Ausweg aus der Misere weisen<br />
könnte, wird nicht angenommen, und zwar von uns nicht,<br />
nicht etwa nur von denen da oben nicht, wie ewige Ideologen<br />
uns glauben machen wollen und die Schuld ungebrochen<br />
kämpferisch an die da oben delegieren, womit<br />
sie das Entstehen eines neuen, von innen und unten<br />
kommenden, individuell gelebten Ethos des freiwilligen<br />
Verzichts behindern.<br />
Nicht wildes Wünschen, nicht in die Ewigkeit projizierte<br />
Illusionen können dazu taugen. Die Fakten sind zur Kenntnis<br />
zu nehmen, und die sind, in die nähere Zukunft extrapoliert,<br />
nicht eben rosig. Die zu verteilende <strong>Arbeit</strong> wird<br />
weniger werden, wodurch der Bereich der Frei-Zeit weltweit<br />
wächst. Nicht die freiheitliche, sondern die freizeitliche<br />
Gesellschaft scheint auf am Rand der neuen Scheinwelt,<br />
deren Sonne rechteckig ist, ein Bildschirm, natürlich<br />
fl ach. Zeitvertreib - was <strong>für</strong> ein sinnlich starkes Wort: die<br />
Zeit vertreiben, als hätten wir zu viel davon, als wäre sie<br />
der unsichtbare Feind, dessen Aggregatzustand die Leere<br />
ist, die sinnentleerte Langeweile. Wo kein Sinn ist, muss<br />
Sinn suggeriert und Sinnlichkeit simuliert werden: Die<br />
Unterhaltungsindustrie, auch das ein starkes Neo-Wort,<br />
das Fernsehen als der große Nuckel <strong>für</strong> das freizeitliche<br />
Volk, das nun nicht mehr greint und strampelt, sondern<br />
still am Gummi saugt, als wär es eine Brust.<br />
Weit produktiver als die rückwärtsgewandte Frage „Was<br />
bleibt?“ fand und fi nde ich die Frage: Was kommt? Was<br />
kommt, wenn wir nach dem kläglichen Ende des opferreichen<br />
Versuches, eine Utopie zu realisieren, und nach<br />
dem Ende der zweiten deutschen Diktatur die Tatsachen<br />
nicht zur Kenntnis nehmen und als warnendes Lehrstück<br />
begreifen wollen? Was kommt künftig über uns, wenn wir<br />
das eigene wie das fremde Versagen, die eingebildete wie<br />
die berechtigte Angst, die Inkonsequenz von einsichtigem<br />
Denken und nach wie vor unverantwortlichem Handeln,<br />
wenn wir die gigantisch gesteigerte Gier und die alten<br />
wie die neuen Lügen nicht erkennen und benennen und<br />
korrigieren?<br />
Dass die Hölderlin´sche liebliche Bläue eher Wunsch<br />
denn Wirklichkeit war und ist und wir, vielleicht?, durch<br />
die politischen Tragödien des vorigen Jahrhundert scharfsichtiger<br />
geworden, das eine vom andern besser zu scheiden<br />
vermögen, darin liegt mein vorsichtiger Optimismus,<br />
ein Optimismus, der skeptisch bleibt.<br />
Und dennoch setze ich weiter auf das Wort. Denn Worte<br />
haben Kraft - sie können etwas sichtbar machen, sie können<br />
Handeln bewirken und Zukunft generieren. Worte<br />
halten Zugänge zwischen Menschen offen. Worte können<br />
und sollten wider die Abgesandten des Nichts stehen, und<br />
seien die noch so eloquent. Auch das Unbenannte, im<br />
Dunkel Bleibende, Tabu und Geheimnis üben Gewalt aus,<br />
indem geglaubt werden muss, was gewusst werden kann.<br />
So wird zwingend und zwanghaft Gehorsam erzeugt. Woraus<br />
folgt, dass es in der Verantwortung der Wortführer<br />
liegt, medial manipulierte Massen zu erregen oder Individuen<br />
zu bestärken, das kollektivistische Wir zu propagieren<br />
oder das autonome, kritische Ich zu inthronisieren<br />
als höchste irdische Instanz. Die differenzierte, demokra-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 9
10<br />
Anfangsplenum<br />
tische Gesellschaft, in der wir angekommen sind, erweist<br />
sich als ein Kosmos mit vielen Mikrokosmen, was verwirren<br />
und dem als Unübersichtlichkeit erscheinen kann, der<br />
an den klaren Anblick der feudal<strong>sozial</strong>istischen Machtpyramide<br />
gewöhnt war. Manch einer sucht noch immer<br />
den Staat als Stab und Stern, der stützt und leitet, und<br />
gleicht dem Besucher von Oxford, der nach der Besichtigung<br />
sämtlicher Colleges nun aber endlich die Universität<br />
zu sehen wünscht.<br />
Auch wenn der Staat, in dem wir leben, nicht mehr der<br />
alles und alle beherrschende Leviathan ist, so ist er doch<br />
unübersehbar in der Krise: hoch verschuldet, abhängig<br />
von Großbanken, Weltkonzernen und globalen Marktprozessen,<br />
bei denen er nicht mehr als Kapitän oder Steuermann,<br />
sondern lediglich als Leckfl icker fungiert. Auch<br />
sein Verhältnis zum Volk, oder sagen wir vornehmer: zum<br />
Bürger, bedarf der Konturierung. Es kann nicht Endziel der<br />
Politik sein, den gesellschaftlichen Frieden durch <strong>sozial</strong>e<br />
Zuwendungen zu wahren, den Bürger als Bezugsberechtigten<br />
zu sehen und ihn aus seiner Eigenverantwortung zu<br />
erlösen. Vielmehr muss es darum gehen, durch eine neu<br />
defi nierte politische Kultur dem Einzelnen die Möglichkeit<br />
zu geben, in Freiheit politisch zu partizipieren, gestaltend<br />
einzugreifen in laufende Prozesse und Zukunftsentwürfe,<br />
Protest und Konfl ikt nicht als Hausfriedensbruch und<br />
Gefährdung der Demokratie zu empfi nden, sondern als<br />
bestes Mittel, Demokratie zu stärken und eine Gesellschaft<br />
beieinander zu halten. Die vielen Einzelnen waren<br />
nicht nur im Herbst 1989 das Volk, sie sind es noch<br />
heute, auch wenn das nicht so scheinen mag. Volk ist<br />
nicht nur Volk, wenn es auf die Straße geht, sich durch<br />
Masse Gehör verschafft und Veränderung erzwingt. Intelligenter<br />
wäre es, wenn die Bürger nicht als Volk auf die<br />
Straße gehen müssten, um etwas zu bewirken, sondern<br />
wenn es eine ständige Kommunikation und Interaktion<br />
zwischen Oben und Unten gäbe, nicht nur wie üblich vor<br />
Wahlen aus durchsichtigem Grund ein gnädiges Hinunterneigen<br />
der Oberen, um ihr Ohr an die Masse zu legen,<br />
sondern ein Interagieren auf gleicher Augenhöhe und<br />
zu jeder Zeit, womit die unselige Trennung in Oben und<br />
Unten und das kurzfristige Denken in Legislaturperioden<br />
aufgehoben werden könnte. Eine neuartige Bürgergesellschaft<br />
offen <strong>für</strong> Impulse von unten, offen <strong>für</strong> Alternativen,<br />
die das Etablierte bereichern, verändern oder auch, wenn<br />
es überlebt ist, abschaffen, ohne das System wechseln<br />
zu müssen.<br />
Das wäre so eine der Visionen, von denen ich sprach, Visionen,<br />
die ohne neue Sozialutopien, ohne ideologisches<br />
Parteigeklingel und revolutionäre Rhetorik auskommen<br />
und möglich sind, wenn sich Demokratie selbst beim Wort<br />
nimmt.<br />
In diesem Sinne: Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche<br />
Jahrestagung.
Input<br />
Workshop<br />
Frauen-Power<br />
Ostfrauen begegnen Westfrauen<br />
Walli Gleim Gemeinwesenverein Heerstr. Nord (Spandau)<br />
Evelyn Ulrich Nachbarschaftshaus Am Berl<br />
(Hohenschönhausen)<br />
Moderation: Reinhilde Godulla<br />
Walli Gleim: Ich gebe eine verkürzte, wahrscheinlich<br />
zugespitzte und subjektive Darstellung der letzten 30<br />
Jahre meines Vereins und der dort enthaltenen frauenbewegten<br />
Phase. Zur Vorbereitung unserer Diskussion habe<br />
ich eine Mini-Mini-Umfrage gemacht: Was verbindest du<br />
mit Frauen-Power? Eine junge Frau, die hier am Empfang<br />
sitzt, sagte: Keine Ahnung, ich glaube, so eine feministische<br />
Gruppe von früher. Eine andere Kollegin, Streetworkerin,<br />
also eine bodenständige Frau, die Mädchenarbeit<br />
macht, meinte: Da fallen mir als erstes die Power-Girls<br />
ein in Spandau, die trainieren richtig doll, ich fi nde,<br />
das ist eine gute Gruppe. Und eine langjährige Kollegin<br />
und Freundin, Heidi, Anfang 60, sagte: Ja, Frauen sind<br />
immer noch aufgerufen, etwas zu bewegen, sie arbeiten<br />
unglaublich viel, und es ist weitgehend immer noch so,<br />
dass Männer entscheiden und Frauen umsetzen. Aber ich<br />
glaube, das Thema ist trotzdem veraltet.<br />
Meinen Mann habe ich auch gefragt, der sagte: Aber ihr<br />
habt doch jetzt eine Bundeskanzlerin, was wollt ihr eigentlich<br />
noch?<br />
Ja, wir haben in einer relativ kurzen geschichtlichen Zeit<br />
unwahrscheinlich viel erreicht – ich spreche jetzt von<br />
der alten Bundesrepublik. Aber was wir erreicht haben,<br />
wie die Zeiten vorher waren, von welchem Stand wir<br />
ausgegangen sind, ist heute bei vielen jungen Frauen in<br />
Nachbarschaftseinrichtungen gar nicht mehr bekannt.<br />
Dennoch wird das, was wir erreicht haben, heute gelebt:<br />
Frauen in allen Positionen, Frauen in Führungspositionen,<br />
es ist eine unglaubliche Freiheit, die wir erreicht haben,<br />
Selbstbestimmung, Orte <strong>für</strong> Frauen, immer noch starke<br />
politische Initiativen, um keine Gewalt gegen Frauen<br />
zuzulassen, Gleichberechtigung in Beruf und Familie.<br />
Vielleicht mit Abstrichen, aber insgesamt haben wir viel<br />
erreicht. Nur das Bewusstsein über diese historische Zeit<br />
ist in weiten Teilen weg.<br />
Wie hat sich das in unserer <strong>Arbeit</strong> in den Nachbarschaftseinrichtungen<br />
niedergeschlagen? Nachbarschaftseinrichtungen<br />
waren von Anfang an keine Frauenprojekte,<br />
sondern waren <strong>für</strong> Stadtteilarbeit zuständig. Aber die Zeit<br />
zwischen 1968 und Mitte bis Ende der 80er Jahre, also<br />
sozusagen die Hochzeit der Frauenbewegung, hatte eine<br />
unwahrscheinlich starke Ausstrahlung in die Nachbarschaftseinrichtungen<br />
– das ist meine These.<br />
Was ist da alles passiert? Welche Möglichkeiten haben<br />
sich aufgetan? Welche Projekte sind entstanden? Welche<br />
Orte? Welche vielfältigen Angebote und Initiativen von<br />
Frauen? Was in der Frauenbewegung radikal diskutiert<br />
wurde, hat sich in abgemilderter Form in der <strong>Arbeit</strong> der<br />
Nachbarschaftseinrichtungen niedergeschlagen.<br />
Mein Verein war in den vierziger Jahren als ganz traditionelle<br />
Nachbarschaftseinrichtung gegründet worden.<br />
Als ich 1980 dort eintrat, arbeiteten dort drei Männer,<br />
ich war die erste Frau bei diesem ganz kleinen Verein.<br />
Es entwickelte sich dahin, dass eine zweite Frau kam,<br />
zwei Männer gingen weg. Bis 2000 hatten wir in der<br />
Nachbarschaftseinrichtung dann ausschließlich weibliche<br />
Mitarbeiterinnen, der Vorstand war weiblich, und wir<br />
haben eine ganze Menge Projekte <strong>für</strong> Frauen gemacht:<br />
Frauengruppen, Frauenbildung, fast 20 Jahre lang Frauenorientierungskurse,<br />
Beratung <strong>für</strong> Frauen, Selbsthilfegruppen<br />
<strong>für</strong> Frauen, Kurse <strong>für</strong> Frauen. Das alles hatten<br />
wir in unserer Einrichtung aufgebaut und angeboten. Aber<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 11
12<br />
Workshop Frauenpower<br />
gleichzeitig waren wir immer Stadtteilzentrum, Nachbarschaftseinrichtung,<br />
es gab bei uns nie einen Ausschluss<br />
von Männern. Männer kamen zum Beispiel verstärkt in<br />
unsere <strong>sozial</strong>e Beratung.<br />
Wir waren der Meinung: wenn schon die Leiter in den<br />
anderen Einrichtungen Männer sind, dann wollten wir<br />
wenigstens aus frauenpolitischen und berufspolitischen<br />
Gründen das Feld <strong>für</strong> Frauen frei halten und entsprechend<br />
Sozialarbeiterinnen einstellen. Ab 1995 entwickelte sich<br />
ein neues <strong>Arbeit</strong>sfeld. Dieser Stadtteil ist eine Großraumsiedlung,<br />
ein bisschen vergleichbar mit Gropiusstadt oder<br />
Märkischem Viertel, zwar ein bisschen kleiner, aber ungefähr<br />
in der gleichen Machart. Hier gab es in den neunziger<br />
Jahren einen verstärkten Zuzug von Migranten und Migrantinnen,<br />
so dass der Bedarf, mit Migrantinnen oder<br />
Migranten zu arbeiten, deutlich wurde.<br />
In diesem Bereich entstand ein sehr großer Bedarf an<br />
<strong>sozial</strong>er Beratung. Bei den Deutschkursen haben wir dann<br />
wieder hauptsächlich Angebote <strong>für</strong> Frauen gemacht, Integrationskurse,<br />
immer mit dem Aspekt, dass Migrantinnen<br />
ganz oft noch in Zwängen und teilweise in Gewaltverhältnissen<br />
leben, teilweise als sogenannte Importbräute<br />
nach Deutschland gekommen sind. Also haben wir in<br />
den Deutschkursen einen frauenpolitischen Schwerpunkt<br />
gesetzt.<br />
Ich habe ein paar Thesen aufgeschrieben, die wir zu dieser<br />
Zeit entwickelt haben, weil ich denke, dass die durchaus<br />
weiter gültig sind:<br />
Frauen sind im Stadtteil aktiver<br />
Frauen engagieren sich in Gruppen und Initiativen<br />
Frauen suchen und wollen Weiterbildung<br />
Frauen wollen sich austauschen<br />
Frauen wollen Lebensqualität <strong>für</strong> sich und ihre<br />
Familien und tun etwas da<strong>für</strong>.<br />
Das ist meine und unsere Erfahrung aus fast 30 Jahren<br />
<strong>Arbeit</strong> in diesem Stadtteil. Wir wollen Ost und West miteinander<br />
vergleichen, aber wir sollten auch die Frage diskutieren:<br />
Wie kommt es, dass wir so viel erreicht haben,<br />
aber Feminismus oder Frauenbewegung überhaupt kein<br />
Thema mehr sind und inzwischen schon von uns selber<br />
irgendwie als peinlich angesehen werden?<br />
Reinhilde Godulla: Gibt es bei euch immer noch keine<br />
Männer?<br />
Walli Gleim: Doch, doch, jede Menge …<br />
<br />
Reinhilde Godulla: Elena, was ist <strong>für</strong> Dich Frauen-Power?<br />
Elena Scherer: Ach du liebe Güte ... meine Mutter ist<br />
Frauen-Power ... die studiert gerade noch mit Ende 40.<br />
Evelyn Ulrich: Frauen-Power ist mir ein sehr angenehmer<br />
Begriff, weil ich ganz viele Frauen kenne, die<br />
wirklich eine Menge Power haben und eine Menge<br />
aus ihrem Leben machen, nicht nur <strong>für</strong> sich, sondern<br />
auch <strong>für</strong> andere. Das ist sicher ein großer Vorteil, den<br />
Frauen von sich aus mitbringen. Die Thesen kann ich<br />
alle bestätigen, ohne dass ich an irgendeinem Wort<br />
einen Zweifel hätte. Ost- Frauen begegnen West-<br />
Frauen, dazu ist mir als erstes eingefallen, dass ich<br />
über mein Geschlecht, dass ich eine Frau bin, wirklich<br />
erst zu Zeiten der Wende nachgedacht habe, vorher<br />
war es <strong>für</strong> mich nicht wichtig. Schule, Kindergarten<br />
– ich habe nie irgendwelche Nachteile gehabt, habe<br />
meinen Berufsweg gefunden, da war überhaupt kein<br />
Problem. Mit der Wende haben sich mein Blickwinkel<br />
und auch mein Sprachgebrauch geändert. Ich weiß<br />
noch, wie befremdet ich war, als im Kaufvertrag <strong>für</strong><br />
ein neues Auto mein Beruf als „Erzieherin“ angegeben<br />
war. Heute ist mir das wichtig. Es hat sich also viel in<br />
meinem persönlichen Erleben getan.<br />
1991 wurde unser Verein gegründet. Wer hat diesen<br />
Verein gegründet? Frauen, die sich in diesem Stadtteil<br />
fragten, wie mit dieser Fülle neuer Gesetze umzugehen<br />
ist. Wie die Leute, die noch in <strong>Arbeit</strong> sind oder schon ihre<br />
<strong>Arbeit</strong> verloren haben, überhaupt begreifen können, was<br />
passiert, welche Gesetze gelten. Wir wollten besonders<br />
<strong>für</strong> Frauen und <strong>für</strong> Mütter etwas tun, um heraus zu fi nden,<br />
welche Möglichkeiten dieser neue Staat bietet, um<br />
Familien zu unterstützen. Das war der Grundgedanke <strong>für</strong><br />
diesen Verein.
Das heißt, wir haben diesen Verein als Treffpunkt zur<br />
Begleitung, Unterstützung und Selbsthilfe gegründet, mit<br />
dem Schwerpunkt, dass sehr viele Angebote <strong>für</strong> Frauen<br />
entwickelt wurden. Frauen waren die ersten, die mutig<br />
waren und wissen wollten: Was kann ich machen, wie<br />
können wir in dieser neuen Zeit überleben, wie kann ich<br />
meine Kinder gut erziehen, wie kann ich diese Wende,<br />
die es ja staatlich gab, auch wirklich ganz persönlich nutzen,<br />
und welche Hilfen kann ich in Anspruch nehmen? Es<br />
waren auch sehr schnell Frauen, die nicht nur kamen, um<br />
Rat und Hilfe zu holen, sondern Frauen, die mitmachen<br />
wollten.<br />
Aus einem kleinen Treffpunkt „Begleitung, Unterstützung,<br />
Selbsthilfe“ ist ein großes Nachbarschaftshaus entstanden.<br />
1998 sind wir umgezogen und haben alle Besucher<br />
mitgenommen, obwohl es von dem einen Ort zum anderen<br />
ein ganzes Stück Weg war. Wir haben ein ehemaliges<br />
Kita-Gebäude als Nachbarschaftshaus umbauen können.<br />
Es sind wieder die Frauen gewesen, die aktiv waren und<br />
gemalert haben, um das Haus überhaupt <strong>für</strong> das Wohngebiet<br />
öffnen zu können. Das ist Frauen-Power!<br />
Da wir ein Nachbarschaftshaus sein wollen, das <strong>für</strong><br />
alle da ist, haben wir es dann über Freizeitangebote<br />
geschafft, dass Männer den Weg zu uns gefunden<br />
haben. Bis wir schließlich auch begriffen haben, dass<br />
wir auch ein paar Männer als Mitarbeiter brauchen,<br />
damit auch Männer reinkommen. Die Frauen sagten<br />
sich: Warum sollen nicht auch Männer diesen Stadtteil<br />
mit gestalten? Interessanterweise fi nden sich auch sehr<br />
unterschiedliche Dinge, wo sich Männer angesprochen<br />
fühlen, zum Beispiel im Kiezbeirat befi nden sich vorwiegend<br />
Männer.<br />
Im Familienzentrum, das wir entwickelt haben, sind inzwischen<br />
sehr viele Väter dabei. Das fi nde ich sehr gut, weil<br />
ich immer davon ausgehe, dass Kinder in der Erziehung<br />
möglichst Mutter und Vater brauchen und beide in der<br />
Freizeitgestaltung und in der Auseinandersetzung mit<br />
tieferen Fragen erleben können sollten.<br />
TN: Zu dem Stichwort Frauen-Power – es gibt doch eine<br />
Karrierefrau bei euch? Das ist allgemein bekannt.<br />
Evelyn Ulrich: Wir haben auch eine Karrierefrau, selbstverständlich,<br />
damit können wir angeben. Sie hat den Verein<br />
mit viel Power gegründet, mit vielen Frauen an ihrer<br />
Seite, jetzt ist sie Bürgermeisterin in Lichtenberg. Insofern<br />
ist es auch eine Erfolgsgeschichte von Ost-Power der<br />
Frauen, wie man sich entwickeln kann. So ein Verein kann<br />
eine gute Startbasis da<strong>für</strong> sein, sich auch woanders einzubringen.<br />
Wir sind ja nicht nur im Nachbarschaftshaus,<br />
sondern natürlich auch in anderen Gremien in Lichtenberg<br />
vertreten und arbeiten mit politischem Engagement.<br />
TN: In der DDR hatte es keine Bedeutung, ob man junges<br />
Mädchen, Mann oder Frau war, das spielte keine Rolle.<br />
Nach der Wende aber schon. Mein Kind war 5 Jahre alt<br />
und wollte in ein Mädchenzentrum gehen. Ich dachte, so<br />
ein Quatsch, Mädchenzentrum, was soll das denn? Aber<br />
ich habe mal reingeguckt. Dann hat sich ergeben, dass<br />
ich dort auch eine ABM-Stelle bekommen habe. Meine<br />
Meinung zu dem Punkt Mädchenarbeit und Frauenarbeit<br />
hat sich dann geändert, denn mit diesem veränderten<br />
politischen System waren andere gesellschaftliche<br />
Bedingungen gegeben.<br />
Mich hat erschreckt, wie schnell es seit der Wende -<br />
innerhalb von ein paar Jahren - nötig wurde, Angebote<br />
<strong>für</strong> Mädchen und Frauen zu machen, weil die Frauen als<br />
erste arbeitslos in die Ecke gestellt wurden. In manchen<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 13
14<br />
Workshop Frauenpower<br />
Familien hat man Kinder zur Betreuung dann zu älteren<br />
Geschwistern abgeschoben. Oder es gab Frauen, die erst<br />
mal wieder Halt fi nden mussten und die trotz <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
einfach noch aktiv sein wollten. Das war <strong>für</strong> mich<br />
eine neue Erfahrung, die ich als negativ empfi nde, weil es<br />
<strong>für</strong> mich ein Rückschritt ist, im Vergleich mit den relativ<br />
gesicherten Verhältnissen in der DDR.<br />
Heute sind im Nachbarschaftsheim die Besucher überwiegend<br />
Frauen. Zur Beratung kommen aber genauso<br />
viele Männer wie Frauen. Es gibt auch Selbsthilfegruppen<br />
oder Interessengruppen, wo die Anzahl der Männer<br />
nicht ganz gering ist, aber die Besucher sind eben überwiegend<br />
Frauen. Bei den Ehrenamtlichen, zum Beispiel<br />
bei der Nachhilfe, habe ich mehr Männer als Frauen, also<br />
es hängt auch von den Inhalten ab.<br />
Vielleicht noch ergänzend: Meine Mutter ist 1933 geboren,<br />
hatte damals ganz normal einen einfachen Schulabschluss,<br />
Berufsausbildung, hat später die 10. Klasse<br />
nachgeholt. Sie ist immer arbeiten gegangen, hat das<br />
Abi nachgeholt und mit Ende 30 ein Hochschulstudium<br />
gemacht. Und heute ist das so eine Ausnahmeerscheinung!<br />
Das fi nde ich sehr schade, weil Frauen diese Möglichkeiten<br />
doch haben. Sie müssen bloß darum kämpfen<br />
oder rausfi nden, wie sie sie nutzen können.<br />
Reinhilde Godulla: Es stand gerade im Tagesspiegel ein<br />
Artikel, der sehr gut passt. Darin geht es um die unter-<br />
schiedlichen Lebensverhältnisse von Ostfrauen und<br />
Westfrauen. Demnach sei es in der DDR gar nicht nötig<br />
gewesen, Erzieherin zu sagen. Die Frauen hätten beides<br />
gelebt, Kinder zu haben, berufstätig zu sein und noch weiter<br />
zu studieren. Wohingegen im Westen gesagt worden<br />
sei: eine Frau müsse erst mal Karriere machen, erst dann<br />
kämen Kinder. In dem Artikel steht auch, dass die Westfrauen<br />
den Feminismus erklären könnten, während die<br />
Ostfrauen ihn gelebt hätten..<br />
TN: Ich bin im Westen aufgewachsen, in Düsseldorf, habe<br />
dann in Berlin gelebt und danach im ländlichen Raum.<br />
Wir hatten nach der Maueröffnung sehr früh Kontakte zu<br />
<strong>kulturelle</strong>n Einrichtungen im Osten. Wir waren sehr beeindruckt<br />
davon, mit welcher Selbstverständlichkeit die<br />
Frauen in ihren Berufen als Ingenieurinnen usw. standen<br />
und selbstbewusster auftraten als wir es von den eher<br />
feministisch orientierten Frauentreffen gewohnt waren.<br />
Was ich zu der Zeit aber trotzdem wahrgenommen habe,<br />
was auch von Ostfrauen ausgesprochen wurde, war, dass<br />
trotz aller Gleichberechtigung und Selbstverständlichkeit<br />
Frauen in gehobenen Positionen in der DDR auch kaum<br />
vertreten waren. Damals wie heute hatte die Frau nicht nur<br />
einen Beruf, sondern drei. Der Haushalt wurde auch in der<br />
ehemaligen DDR den Frauen überlassen, ebenso wie die<br />
Kinderbetreuung. Es gab die gleichen Diskrepanzen, die<br />
wir auch hier erleben. Diese Doppel- oder Dreifachbelastungen<br />
waren eben ähnlich, trotz aller Errungenschaften<br />
und trotz allem, was viel selbstverständlicher war.<br />
Im Westen feministisch zu sein, das hat so einen Beigeschmack<br />
gekriegt. Dieser einseitige Kampf wurde<br />
irgendwann von dem Gefühl begleitet, dass die Fixierung<br />
auf die Frage gleicher Rechte nicht ausreichend ist. Die<br />
Beschäftigung damit, als die Mauer geöffnet wurde, war<br />
<strong>für</strong> die Frauen aus dem Osten erst einmal völlig überfl üssig,<br />
weil sie meinten, dass sie das nicht nötig hätten, weil<br />
sie Gleichberechtigung schon gelebt hätten. Das kann ich<br />
gut nachvollziehen.<br />
Gisela Hübner: Das klafft jetzt so weit auseinander, aber<br />
ich glaube, man muss ein bisschen die Zeit bedenken.<br />
Bis 1961, also bis zum Mauerbau, spielte es in Ost und
in West eine Rolle, dass unglaublich viele Frauen ihre<br />
Männer im Krieg verloren hatten. Sie dachten nicht über<br />
Frauen-Power nach, sondern brachten ihre Familien<br />
durch. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen waren im<br />
Osten natürlich auf gleichberechtigt abgestellt, auch das<br />
ganze Versorgungssystem war so, dass Frauen ihrer Tätigkeit<br />
ohne Unterbrechung nachgehen konnten, das war<br />
überhaupt keine Frage.<br />
Aber jetzt möchte ich noch was zu der Situation der Frauen<br />
im Westen sagen, weil es da wirklich eine Frauen-Power,<br />
eine sehr große, von Frauen bewegte Zeit gegeben hat,<br />
ausgelöst durch die Studentenbewegung, durch politische<br />
Umbrüche. Frauen wollten weiter studieren, Berufe beenden,<br />
wollten raus und politisch mitwirken. Das hat eine<br />
Riesenwelle, eine politisch getragene Welle, ausgelöst,<br />
wo auch Männer mitgingen. Das war kein Gegeneinander.<br />
Auch bei den Kindergartengründungen waren damals<br />
Männer und Frauen dabei. Die Auseinandersetzungen um<br />
neue Formen, um Emanzipation, Kinder in neuer Freiheit<br />
zu erziehen, das mussten Männer und Frauen gemeinsam<br />
machen, die Elternabende jede Woche bis Mitternacht.<br />
Da lachen die Frauen, die dabei waren.<br />
Ende der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre war das<br />
zunächst einmal <strong>für</strong> sehr bürgerliche Schichten, aber<br />
das weichte sich dann auf. Gesellschaftlich wurde darauf<br />
tatsächlich in den 70er Jahren reagiert, die Politik,<br />
SPD-Regierung – und auch danach -, unternahm unendlich<br />
viele Modellversuche, die gefördert und gestützt wurden,<br />
wo Frauen eingebunden waren. Auch das war ein<br />
Miteinander. In den 80er Jahren gab es Veränderungen,<br />
in den 90er ebenfalls. Heute sind wir wieder an so einem<br />
Punkt, wo man bei dem Begriff Feminismus ein bisschen<br />
lächelt, aber ich glaube, irgendwo ist es jetzt in den Köpfen<br />
angekommen, dass man nur gemeinsam etwas verändern<br />
kann, Männer und Frauen. Mir ist es wichtig, dass<br />
es im Westen außerhalb eines abgesicherten Rahmens<br />
zunächst mal von unten Entwicklungen gegeben hat, die<br />
bis heute Grundlage einer starken Veränderung in ganz<br />
Deutschland sind.<br />
Walli Gleim: In der Ausgangsposition haben in der Frauenbewegung<br />
damals Themen eine Rolle gespielt wie die<br />
Rückkehr der starken Frauen nach dem Krieg, die sich<br />
alleine mit ihren Familien durchgekämpft haben. Ich<br />
habe es selber als junges Mädchen erlebt, dass ich mit<br />
meinem Schulabschluss keine Beamtenlaufbahn einschlagen<br />
konnte, aber die Jungens mit dem gleichen<br />
Schulabschluss und mit schlechteren Noten diese Laufbahn<br />
mit entsprechender Ausbildung machen konnten.<br />
Solche Dinge, dass der Ehemann entscheiden durfte, ob<br />
seine Frau arbeiten gehen durfte; dass eine Frau, die sich<br />
trennte und die eheliche Wohnung verließ, automatisch<br />
schuldig geschieden wurde; dass es überhaupt keine<br />
Verhütung gab, sodass jeder Geschlechtsverkehr in einer<br />
Schwangerschaft enden konnte, während parallel Abtreibungsverbot<br />
herrschte. Das waren mitreißende Themen.<br />
Auch dass klar war, dass die besseren Positionen den<br />
Männern vorbehalten waren. Gewalt in Familien oder<br />
überhaupt Gewalt gegen Frauen war ein Thema, Kinderbetreuung<br />
war ein Thema, da gab es bestimmte Punkte,<br />
die in der DDR nicht relevant waren, Hausarbeit war ein<br />
Thema.<br />
Allerdings kann ich der These nicht zustimmen, dass ab<br />
Ende der 80er Jahre der Trend war, wir könnten Veränderungen<br />
nur zusammen mit Männern schaffen. Ich glaube<br />
eher, dass durch so viele Erfolge die Frauen ab einem<br />
bestimmten Punkt in der Politik offene Türen eingerannt<br />
haben. Wenn inzwischen die CSU sagt, dass Frauen<br />
gleichberechtigt sein müssen. Das hatten sie auf Migranten<br />
bezogen. Wir hatten über Jahrzehnte eine absolut<br />
traditionelle Familienpolitik, die darauf aus war, dass die<br />
Frauen eben zu Hause bleiben und die Kinder am besten<br />
den ganzen Tag bei der Mutter aufgehoben sind. Also da<br />
hat sich so viel verändert in dem ganzen Klima, dass das<br />
heute niemand mehr infrage stellen würde, dass Frauen<br />
das Recht haben zu studieren, dass sie das Recht auf<br />
einen Beruf und Familie haben. Wenn ich manchmal<br />
jüngeren Kolleginnen Beispiele erzähle, wie noch Ende<br />
der 60er Jahre die Bedingungen <strong>für</strong> Frauen waren, dann<br />
denken die, dass ich von einem fernen Planeten rede.<br />
Diese Dynamik hat die Frauenbewegung befördert, deren<br />
Ursprünge zwar von intellektuellen Frauen bzw. von<br />
Studentinnen ausgegangen waren, aber diese Veränderungen<br />
haben sich rasant verbreitet.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 15
16<br />
Workshop Frauenpower<br />
TN: Das Thema Gewalt gegen Frauen – wie wurde damit<br />
in der DDR umgegangen?<br />
TN: Man dachte wohl: das liegt leider auch in der Natur<br />
der Menschen, dass sie auch gewalttätig sein können.<br />
TN: Ich meine auch Missbrauch oder Missbrauch gegen<br />
Kindern …<br />
TN: Sagen wir mal, das Thema war nicht medienwirksam.<br />
Wenn aber ein Fall bekannt wurde, dann wurde er auch<br />
strafrechtlich verfolgt.<br />
TN: Es gab noch einen anderen Aspekt, der da vielleicht<br />
eine Rolle spielt. Nämlich dadurch, dass die Frauen eine<br />
größere ökonomische Unabhängigkeit hatten, konnten<br />
sie ihre Männer leichter verlassen, was auch dazu führte,<br />
dass die Scheidungsrate in der DDR erheblich höher war.<br />
Was sich jetzt wieder ins Gegenteil verkehrt.<br />
Zum Thema Gewalt in Familien war <strong>für</strong> mich faszinierend,<br />
wie die Politik in der Bundesrepublik darauf reagiert<br />
hat. Man hat zwar Frauenhäuser geschaffen, wo Frauen<br />
dann Zufl ucht fi nden konnten, aber die Folgen der Gewalt<br />
mussten einseitig Frauen und Kinder tragen. Wenn Kinder<br />
beteiligt waren, mussten sie die Schule wechseln,<br />
die Frauen haben die Wohnung verlassen, während der<br />
Mann, der geschlagen hat, weniger betroffen war und<br />
meistens in der Wohnung blieb.<br />
Wir haben uns gesagt, wir müssten eigentlich das Übel an<br />
der Wurzel packen und was mit den Männern tun, in Form<br />
von Therapie, damit sie nicht gewalttätig werden. 1997<br />
haben wir das Projekt „Männer gegen Gewalt“ initiiert,<br />
wo Männer, die aggressiv geworden sind, von Psychologen<br />
in der Zusammenarbeit mit der Justiz und der Polizei,<br />
therapiert und behandelt wurden. Wir sind damit in der<br />
Politik nicht auf sehr viel Gegenliebe gestoßen, denn das<br />
ist kein Thema, mit dem man politisch Furore machen<br />
kann, wenn man sich um gewalttätige Männer kümmert,<br />
sondern es ist besser angesehen, sich auf die Opferseite<br />
zu schlagen, damit man sagen kann, man hat ein Frauenhaus<br />
geschaffen.<br />
TN: Dieses Projekt kriegt jetzt aber den Berliner Präventionspreis...<br />
TN: Noch eine wichtige Ergänzung: Die Frauenhäuser<br />
wurden nicht von der Regierung geschaffen.<br />
TN: An den Punkt zu kommen, dass gewalttätige Männer<br />
die Wohnung verlassen müssen, hat sehr lange gedauert.<br />
TN: Aus meiner Sicht ist es ganz klar, dass auf der politischen<br />
Ebene hier sehr viel erreicht wurde. Irgendwann<br />
hatten die Frauen das Gefühl: jetzt sind wir gleichberechtigt,<br />
dann ist ja alles gut, also brauchen wir keine<br />
Feministinnen mehr. Und es wurde direkt unangenehm<br />
zu sagen: ich bin Feministin. In meiner Generation war<br />
es noch durchaus üblich, hinzufügen: ich bin aber nicht<br />
gegen Männer.<br />
Ich fi nde das eigentlich eine ganz gefährliche Haltung,<br />
weil wir noch lange nicht gleichberechtigt sind. Ganz viele<br />
Frauen in Führungspositionen, die Macht haben, imitieren<br />
Männer nur, weil sie nicht die Energie aufgewendet haben,<br />
einen eigenen weiblichen Führungsstil zu entwickeln,<br />
sondern sie sind Manager im Kostüm. Erschreckend ist<br />
auch in der Jugendarbeit, die ich mache, wenn man sich<br />
die fi nanzielle Lage oder den Bildungsstand von Mädchen<br />
anschaut. Sie resignieren und sehen keine Perspektive,<br />
denn sie glauben, ohne Kerl seien sie nichts wert.<br />
Das habe ich oft erleben müssen. Selbst Mütter sagen<br />
zu ihren 16-jährigen Töchtern: sieh zu, dass du unter die<br />
Haube kommst. Ich dachte, von dieser Einstellung wären<br />
wir schon lange weg, aber ich habe das Gefühl, dass<br />
sie ganz verstärkt zurückkommt – und zwar in den bildungsferneren<br />
und armen Schichten. Wir müssen genau<br />
hinsehen, um die heutigen Formen der Ungleichheit und<br />
Ungerechtigkeit zu entlarven.<br />
TN: Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Es<br />
hat auch in der DDR eine Frauenbewegung gegeben. Das<br />
war ja kein historischer Zufall, dass sie entstanden ist,<br />
sondern sie hatte handfeste Gründe, zum Beispiel die eingeschränkten<br />
Karrierechancen von Frauen in der DDR.<br />
Ein starkes Thema, soweit ich mich erinnere, war die
Frage der erstarrten Geschlechterrollen, an denen offensichtlich<br />
ein dringender Veränderungsbedarf bestand,<br />
weil dadurch aktiv Beteiligung erfahren wurde. Ein ganz<br />
starkes Thema war auch die sexuelle Selbstbestimmung,<br />
also die verordnete Heterosexualität. Ebenfalls ein starkes<br />
Thema war die verordnete Gleichberechtigung, mit der die<br />
Frau sich nicht zufrieden geben wollte, damit, dass eine<br />
Partei beschlossen hat, dass die Frau in der DDR gleichberechtigt<br />
ist. Damit war von oben her das Thema abgehakt.<br />
Aus Sicht von DDR-Frauen, die sich mittlerweile auch<br />
organisiert hatten, wurde damit ein gesellschaftliches<br />
Tabu errichtet, über Benachteiligung von Frauen in der<br />
DDR noch zu reden.<br />
Es gab dann viele Gründungen von Frauenzentren, zumindest<br />
in Berlin, die bestimmt auch ihren Ursprung in dem<br />
hatten, was im Protest der Wende entstanden ist, weil<br />
es eklatante Verschlechterungen gegeben hat. Aber es<br />
spielte <strong>für</strong> die Frauen sicher auch eine Rolle, dass sie<br />
diese Einrichtungen nach der Wende endlich schaffen<br />
konnten, die sie gerne schon länger gehabt hätten.<br />
Endlich konnten sie etwas tun und da<strong>für</strong> streiten, wo<strong>für</strong><br />
gestritten werden muss.<br />
TN: Zur Zeit der Wende reisten auch Frauen aus dem Ostteil<br />
nach Schöneberg, um dort eine Berufsorientierung<br />
zu machen. Sie haben es als Gewinn gesehen, im Rahmen<br />
dieser Kurse die Möglichkeit zu haben, so etwas wie<br />
Selbsterfahrung zu erleben. Häufi g wurde gesagt, dass es<br />
in diesem Punkt ein Manko gab, weil sie aufgrund ihrer<br />
Dreifachbelastung nicht die Chance hatten, sich so intensiv<br />
mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ein wichtiger<br />
Punkt war aber auch, dass viele Frauen sich gezwungen<br />
gefühlt haben, ihre Kinder in die Krippe zu geben, also<br />
sie hatten nicht das Gefühl, dass sie selbst bestimmen<br />
können, ob sie sich zwei Jahre vielleicht selbst um die<br />
Kinder kümmern.<br />
Ich habe auch sehr eindrücklich in Erinnerung, dass die<br />
ökonomische Unabhängigkeit eben dazu führt, dass eine<br />
Frau nie in so eine Abhängigkeit geraten konnte, wie<br />
das häufi g bei uns in Familie und Ehe der Fall ist. Später<br />
habe ich mit Studentinnen Kontakt gehabt. Da habe ich<br />
gemerkt, dass sich das Bild jetzt verändert. Sie möchten<br />
zum Beispiel auch eine Babyzeit, ungefähr drei Jahre nach<br />
der Geburt. Die Norm ist aber immer noch der männliche<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmer, 38,5 Stunden, und Frauen müssen sich<br />
wahnsinnig anstrengen, um da ihren Weg zu fi nden. Es<br />
gibt nach wie vor große Probleme <strong>für</strong> Frauen. Viele sind<br />
gut ausgebildet, sind aber nicht berufstätig, weil sie nach<br />
längerer Berufsunterbrechung keinen Job mehr fi nden.<br />
Das ist eine Katastrophe.<br />
TN: Ich habe das Gefühl, dass das Leben im Osten <strong>für</strong><br />
mich als Frau irgendwie schon vorgeformt war durch die<br />
Pfl icht zu arbeiten. Denn ein Ausstieg aus dem <strong>Arbeit</strong>sprozess<br />
hat enorm viel Kraft gekostet oder eine unheilbare<br />
Krankheit vorausgesetzt. Aber verschiedene Sachen<br />
in Bezug auf Gleichberechtigung waren wirklich anders.<br />
Wenn ich ein Kind bekommen habe, dann war die Krippe<br />
eben Pfl icht, das war die Grundvoraussetzung <strong>für</strong> die<br />
Rückkehr in den Beruf. Die große Schwierigkeit war,<br />
irgendeine Form von Individualität zu leben. Es gab aber<br />
durchaus auch in Universitätsstädten gute Ansätze, vor<br />
allem über kirchliche Zusammenhänge.<br />
TN: Genau. Die Gesetzgebung gab einer Frau, die verheiratet<br />
war und geschieden wurde, immer eine sehr starke und<br />
eigenständige Position. Man ist dann auseinander gegangen,<br />
hatte sein Berufsleben und fi ng einfach wieder an. Ich denke,<br />
das ist schon ein gravierender Unterschied. Als ich hier im<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 17
18<br />
Workshop Frauenpower<br />
Westen ankam, war ich schon ein bisschen erschrocken darüber,<br />
dass es ganz andere Strukturen gab, in denen ich als<br />
Frau plötzlich auf ganz anderen Positionen stand.<br />
TN: Ich habe manche meiner Vorstellungen, die ich vor<br />
20 Jahren hatte, sehr verändert. Ich habe zum Beispiel<br />
gedacht, der überwiegende Teil der Frauen aus den alten<br />
Bundesländern seien gerne Hausfrau. Bis ich mal kapiert<br />
habe, selbst wenn sie gewollt hätten, sie konnten nicht<br />
arbeiten gehen, zumindest keine volle Stelle annehmen.<br />
Oder bis ich verstanden hatte, dass ich die drei Euro, die<br />
ich verdiene, wieder <strong>für</strong> die Kinderbetreuung ausgeben<br />
muss. In dieser Hinsicht haben wir alle eine Entwicklung<br />
durchgemacht. Aber die Mehrheit der Frauen, die ich seit<br />
35 Jahren in der DDR gekannt habe, hat freiwillig und<br />
gerne gearbeitet. Vom Gesetz her konnten die Verheirateten<br />
so lange Hausfrau sein wie sie wollten. Und dann<br />
möchte ich nach wie vor positiv hervorheben, was sich<br />
besonders in den 70er und 80er Jahren entwickelt hat:<br />
die Unterstützung der Frauen, unabhängig vom Familienstand,<br />
wenn sie Kinder bekommen haben. Beim Babyjahr<br />
wurde mindestens 70 % deines Einkommens über ein<br />
Jahr bezahlt oder es gab Freistellungszeit bei Krankheit<br />
des Kindes, das hat sich alles mit entwickelt.<br />
Mit der Selbstrefl exion habe ich ein einschneidendes<br />
Erlebnis gehabt. 1994 bin ich mit meiner Tochter in eine<br />
Mutter-Kind-Gruppe gekommen. Sie hatten mir geraten,<br />
dass ich in den Antrag schreiben soll, dass ich berufstätig<br />
bin, alleinziehend mit drei Kindern. Da dachte ich, was<br />
soll denn der Quatsch? Das war <strong>für</strong> mich normal, auch<br />
wenn es nicht einfach war. Heute bewerte ich das, mit<br />
zeitlichem Abstand, ein bisschen anders, weil es wirklich<br />
eine Leistung ist, wenn man drei Kinder alleine groß zieht.<br />
Wie gesagt, es war <strong>für</strong> mich normal, ich bin auch gerne<br />
arbeiten gegangen, war ab und zu auch arbeitslos und war<br />
immer wieder froh, wenn ich wieder <strong>Arbeit</strong> hatte. Und viele<br />
Frauen, die heute keine oder nicht ausreichend <strong>Arbeit</strong> fi nden,<br />
haben auch nicht wenige psychische Probleme, weil<br />
sie sich mit der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit nicht gut fühlen.<br />
Was ich auch so erschreckend fi nde, was aber leider <strong>für</strong><br />
die gesellschaftliche Entwicklung nicht untypisch ist,<br />
ist, dass auch die Aggressivität und Gewalttätigkeit von<br />
Frauen und Mädchen zunimmt. Wenn man Statistiken<br />
liest, wird deutlich: es sind ja nicht nur Männer und Jungen<br />
gewalttätig. Im Rahmen des Projektes gegen Männergewalt<br />
hat die Polizei auf Anfrage auch mit gewalttätigen<br />
Frauen gearbeitet.<br />
TN: Es gab aber in der DDR die Möglichkeit <strong>für</strong> eine Frau, nicht<br />
arbeiten zu gehen und mit dem Kind zu Hause zu bleiben?<br />
TN: Wenn man zum Beispiel ledig war und mit seinem<br />
Kind zu Hause bleiben wollte, dann konnte man wegen<br />
a<strong>sozial</strong>en Verhaltens angeklagt werden. Das waren durchaus<br />
bittere Erfahrungen, die einige Leute machten, die<br />
vielleicht nur aus jugendlicher Revolte heraus versucht<br />
haben, so ihren eigenen Weg zu gehen. Es gab Bitternis<br />
dadurch und auch wirklich tragische Schicksale. Ich bin<br />
1985 nach Berlin gegangen, weil ich das reglementierte<br />
und enge Leben in Thüringen nicht mehr wollte. In Berlin<br />
habe ich mich entschieden, nicht mehr voll zu arbeiten.<br />
Ich habe davon gelebt, dass ich <strong>für</strong> eine gewisse Zeit<br />
Wetten auf der Rennbahn verkauft habe. Dann habe ich<br />
mich über den Freundeskreis schließlich doch wieder im<br />
Berufsleben integriert. Die wirklichen Außenseiter waren<br />
die Ausreisewilligen.<br />
TN: Bei den Berufsorientierungskursen <strong>für</strong> Frauen<br />
waren Berufsbilder und Berufsfindung ein wichtiger
Part. Einige der Frauen sagten, dass sie in der DDR<br />
ganz selten wirklich eine Berufswahl hatten, gerade<br />
als Frauen. Ganz viele waren auch in Männerberufen<br />
tätig, was etwas mit dem regionalen <strong>Arbeit</strong>smarkt zu<br />
tun hatte. Aber sie meinten, wenn sie in der damaligen<br />
neuen Situation 10 oder 20 Jahre jünger gewesen<br />
wären und ihren Beruf selber hätten bestimmen können,<br />
dann hätten sie einen anderen Beruf ausgeübt.<br />
Der individuelle Berufswunsch war bei uns im Westen<br />
ja auch schwierig umzusetzen. Aber in den 70er und<br />
80er Jahren war die Selbstfindung sehr ausgeprägt,<br />
was man wirklich wollte, und mit welchen finanziellen<br />
Mitteln man das verwirklichen konnte. Was die Frauen<br />
jetzt wirklich möchten, diese Frage ist jedenfalls auch<br />
gekommen. Wir dachten damals, dass Frauen im Bezug<br />
auf <strong>Arbeit</strong> deutlich besser dran waren als im Westen.<br />
Aber es ist ja nicht nur die <strong>Arbeit</strong> allein.<br />
TN: Wir wissen alle: was im Gesetz steht und was wirklich<br />
ist, das sind zweierlei Sachen. Selbst wenn gesetzlich<br />
klar war, dass Männer und Frauen arbeiten gehen<br />
mussten, hieß das aber auch: wenn ich mich außerhalb<br />
eines Rollenbildes bewege, bekomme ich Sanktionen zu<br />
spüren. Sich zu entscheiden, nicht zu arbeiten oder nicht<br />
sofort nach der Geburt eines Kindes arbeiten zu gehen<br />
oder aber wo anders leben zu wollen, das war schon nicht<br />
so einfach. Die Frage ist, wo und wie Frauen auf Rollen<br />
festgelegt werden. Ich frage mich, in welche Richtung wir<br />
heute an diesen Punkt gehen.<br />
TN: Ich will es noch einmal unterstreichen, dass es wirklich<br />
sehr schwierig war, nicht arbeiten zu gehen. Ich lebte<br />
in einer Partnerschaft und wagte, ein ganzes Jahr nicht<br />
zu arbeiten, was mir Schwierigkeiten gemacht hat, weil<br />
ich dadurch nicht versichert war. Die andere Seite ist,<br />
das fand ich in der DDR wirklich bemerkenswert: wenn<br />
man alleinerziehend war, war man genauso gleichgestellt<br />
und abgesichert wie jede verheiratete Frau. Das ist etwas<br />
unheimlich Positives gewesen.<br />
TN: Das empfi nde ich auch so.<br />
TN: In der DDR konnten sich weder Mädchen noch Jungen<br />
einen Beruf aussuchen. Man stellte Hochrechnungen an,<br />
wie viele Lehrer gebraucht werden, wie viele Ingenieure<br />
oder Menschen in der Landwirtschaft. Diese Ausbildungsplätze<br />
hat man kontingentiert, also das wurde gelenkt.<br />
Der Vorteil daran war, dass man fast mit 100 prozentiger<br />
Sicherheit, wenn man den Beruf erlernt hatte, danach<br />
eine Tätigkeit hatte. Wenn man sich das in den alten<br />
Bundesländern anschaut, da konnte man vielleicht den<br />
Beruf erlernen, den man wollte, aber ob man dann eine<br />
Tätigkeit bekommen hat? Ich will einfach nur sagen: Es<br />
hat alles zwei Seiten.<br />
Ich habe seit 1991/92 in der <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n <strong>Arbeit</strong><br />
festgestellt, dass Frauen, was das Sozialengagement<br />
angeht, die Aktiven sind. Kurz nach der Wende habe ich<br />
auch festgestellt, dass Spezialbereiche eingerichtet wurden<br />
wie Frauenladen, Mädchenladen, Frauentreff, Frauengruppen.<br />
Man hat dann relativ schnell erkannt, dass<br />
man mit Spezialeinrichtungen alleine nicht so eine gute<br />
Überlebenschance hat. Wenn man aber diese Spezialaufgaben<br />
in ein Nachbarschaftszentrum integriert, kommen<br />
sie besser zum Tragen, weil diese Umgebung nicht stigmatisiert<br />
und nichts verfestigt, wie wenn zum Beispiel<br />
zum <strong>Arbeit</strong>slosenfrühstück nur <strong>Arbeit</strong>slose kommen.<br />
Aber ich kann nur meinen Hut ziehen vor allen aus dieser<br />
Runde, die sich nicht haben unterkriegen lassen, sondern<br />
überlegen, wie sie die Lebensqualität der Menschen verbessern<br />
können. Und was ist jetzt aktuell?<br />
TN: Wir haben übrigens keine Gleichstellungsbeauftragte<br />
mehr, sondern Gender-Beauftragte. Das ist von oben initiiert<br />
worden. Meine Frage dabei ist, ob es bewusst initiiert<br />
wurde, weil Frauen an einen Punkt gekommen sind, wo<br />
vielleicht die Gefahr bestand, dass sie weiterkommen?<br />
Aber aus meiner Sicht sind sie noch lange nicht da angekommen,<br />
wo sie hätten ankommen müssen, nämlich bei<br />
echter Gleichwertigkeit.<br />
TN: Gender ist ja ein bisschen mehr als Mann und Frau.<br />
Und weil der Begriff so sperrig ist, ziehen jetzt unentwegt<br />
Berater durch die Gegend und erklären einem, was<br />
das ist. Weil man kein Geld mehr von der Bundesre-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 19
20<br />
Workshop Frauenpower<br />
gierung kriegt, wenn man Gender-Probleme nicht auch<br />
beschrieben hat. Aber was hinter diesem Wort steht,<br />
das fi nde ich wieder total wichtig, nämlich dass es nicht<br />
um Mann und Frau geht, sondern um die Rollen und die<br />
Fragen, in was <strong>für</strong> Zwängen lebt man, welchen Gestaltungsspielraum<br />
hat man dabei? Das Interessante an<br />
Gender ist, dass man innerhalb dieses Rahmens Rollen<br />
neu defi nieren und ändern kann.<br />
Evelyn Ulrich: Ich habe vorhin angedeutet, dass ich mich<br />
seit 1991 in der <strong>Arbeit</strong>swelt als Frau fühle. Das ist in den<br />
vergangenen Jahren nicht weniger geworden, sondern<br />
hat sich eher verstärkt, weil ich sehe, dass Frauen wirklich<br />
<strong>für</strong> Frauen kämpfen müssen. Wir haben einen Punkt<br />
erreicht, an dem wir nicht wieder eine Rolle rückwärts<br />
mit uns machen lassen dürfen. Aber wo liegen unsere<br />
Möglichkeiten? Diese Diskussion sollten wir gemeinsam<br />
führen.<br />
Wenn ich mir angucke, in welchem Wohngebiet unser<br />
Nachbarschaftszentrum liegt, dann sind knapp 60 %<br />
der Kinder von Hartz IV-Leistungen abhängig. Was kann<br />
ich da groß an Frauen-Power erwarten? Trotzdem sage<br />
ich: Gerade da kann und muss über Frauen-Power etwas<br />
passieren. Welche Hilfsangebote können und müssen wir<br />
machen, um den Frauen wieder ein Rückgrat zu geben,<br />
damit sie die Chance haben, <strong>für</strong> sich selber zu kämpfen<br />
und mutig ihre Unabhängigkeit zurückerobern? Wo sind<br />
Perspektiven <strong>für</strong> Frauen? Bei uns wird eine berufl iche<br />
Perspektive als sehr wichtig angesehen. Wo fi ndet sich<br />
<strong>Arbeit</strong>? <strong>Arbeit</strong> ist eine Menge da, und Frauen lassen sich<br />
ganz schnell verführen, sich auch ehrenamtlich zu engagieren.<br />
Für die Frauen selber ist es ganz wichtig, dass sie<br />
was tun, dass sie eine Anerkennung bekommen, aber das<br />
heißt ja dennoch, dass eine Menge an bezahlter <strong>Arbeit</strong><br />
notwendig wäre. Das sollten wir in Zukunft noch stärker<br />
auf die Reihe kriegen, dass wir uns <strong>für</strong> Frauen – damit<br />
auch <strong>für</strong> uns selber – stärker einsetzen können.<br />
TN: Ich kann das nur unterstützen. Die Nachbarschaftszentren<br />
decken gut den Bereich der Unterstützung von<br />
Familien ab, aber dann wird es schwierig. Es betrifft<br />
vor allem Frauen, die sich trennen wollen, Alleinerziehende,<br />
womit auch ein großes Armutsrisiko einhergeht.<br />
Im Grunde genommen geht es nicht ohne berufl iche Orientierung,<br />
also müssen Eingliederungsmöglichkeiten in<br />
den <strong>Arbeit</strong>smarkt zur Verfügung gestellt werden, weil die<br />
ökonomische Unabhängigkeit eine ganz wichtige Lebensgrundlage<br />
ist.<br />
TN: Noch mal zum Stichwort Gender: Es wurde ja ganz<br />
schnell ein Thema, dass Jungen inzwischen in der<br />
Schule benachteiligt werden. Mädchen haben bessere<br />
Abiturnoten, während Jungen ihre Schwierigkeiten durch<br />
auffälliges Verhalten ausdrücken. Die ganze geschichtliche<br />
Zeit, in der Frauen jede Bildung verweigert wurde,<br />
während Männer alle Chancen im Beruf hatten, das ist<br />
kein Thema mehr. Nun ist das seit einiger Zeit so, dass<br />
die Frauen nicht nur aufholen, sondern überholen, und<br />
sofort kommt diese Sorge, was jetzt aus den Jungen<br />
wird.<br />
Aber was können wir jetzt tun? Ehrlich gesagt, wir<br />
– meine Generation – wir können gar nichts tun. Denn<br />
wenn junge Frauen nicht selber Anliegen entwickeln, <strong>für</strong><br />
die sie etwas tun wollen, dann nützen die besten Angebote<br />
nichts. Man muss das noch mal ganz stark betonen.<br />
Wir hatten Anliegen und wir haben <strong>für</strong> etwas gekämpft,<br />
weil wir etwas wollten. Stichwort sexuelle Selbstbestimmung,<br />
da gehörte Homosexualität dazu, also anders zu<br />
leben, mehr Freiheit zu haben, in Wohngemeinschaften<br />
zu leben, ohne Partner zu leben, berufl iche Chancen zu
haben, das waren Anliegen, die wir hatten und die wir vertreten<br />
haben. Inzwischen sind Frauenrechte fast schon<br />
Mainstream geworden. Ich glaube, junge Mädchen oder<br />
junge Frauen, und das kann man ihnen jetzt mal vorwerfen,<br />
sehen heute <strong>für</strong> sich weder Hürden noch Barrieren.<br />
Bis sie vielleicht irgendwann merken, wenn sie zu lange<br />
aus dem Beruf ausgestiegen sind, dass sie da nicht mehr<br />
reinkommen.<br />
TN: Ich glaube, dass das nicht stimmt, dass Frauen deiner<br />
Generation nichts tun können. Wir haben so viel erreicht,<br />
was heute als normal gilt. Ich würde vehement bestreiten,<br />
dass ich alles hätte werden können. Mir hätten vielleicht<br />
formal die Wege offen gestanden. Aber ich hatte einen<br />
Mathelehrer, der mir gepredigt hat, dass ich Mathe gar<br />
nicht können kann, weil das in mein Mädchenhirn nicht<br />
reinpasst. Ich hatte einen Biolehrer, der bevorzugt mit<br />
seinem Schlüsselbund nach Mädchen geworfen hat. Das<br />
hat bewirkt, dass ich alles, was mit Naturwissenschaften<br />
zu tun hatte, einfach voll Scheiße fand, das Allerletzte.<br />
Das war eine Form, sich dagegen zu wehren, aber sie war<br />
nicht besonders effektiv, wenn man sie aus heutiger Sicht<br />
betrachtet, aber subjektiv <strong>für</strong> das eigene Überleben, dann<br />
doch recht erfolgreich. Was ich daraus in meinem Kopf<br />
mache, das ist entscheidend. Wir dürfen nicht aufhören,<br />
darüber zu reden, wo die Problematiken, die Fallstricke<br />
liegen. Man muss diese Debatten offen halten und da<br />
können wir als Stadtteileinrichtung bzw. als Nachbarschaftshäuser<br />
sehr viel tun, wir können uns Strukturen<br />
ausdenken, die den Austausch zwischen jungen und<br />
älteren Frauen möglich machen.<br />
TN: Ich würde da eine Aufgabe defi nieren, dass wir uns als<br />
Nachbarschaftseinrichtungen Möglichkeiten ausdenken,<br />
wie wir genau diese gesellschaftlichen Debatten um Rollen,<br />
Chancen, Lebensentwürfe offen halten.<br />
TN: Ich würde es sogar noch weiterführen, dass das nicht<br />
nur in den Nachbarschaftshäusern passierten sollte,<br />
sondern man muss zunehmend in die politische <strong>Arbeit</strong><br />
gehen, in die kommunalen Verwaltungen, auf Landesebene.<br />
Dass ich als Sozialarbeiterin oder Erzieherin nur<br />
unter Frauen bin, das heißt ja nicht, dass Männer diese<br />
Berufe ablehnen, sondern das hat ganz schnöde fi nanzielle<br />
Gründe. Das heißt, die Leitung machen die Männer,<br />
weil sie dadurch ein bisschen mehr verdienen, während<br />
die Frauen die <strong>Arbeit</strong> machen. Dagegen in der Politik vorzugehen<br />
und Debatten zu führen, das könnten Frauen<br />
machen, die genug Lebenserfahrung damit haben und<br />
junge Frauen coachen können.<br />
TN: Solche Diskussionen sind wichtig, um nach Strukturen<br />
und Orientierung zu suchen und da konkrete Wege<br />
aufzuzeigen.<br />
TN: Wir sind doch sicher alle in verschiedenen Gremien<br />
vernetzt. Ich bin unter anderem in der Fachgruppe Familie<br />
vom DPW, wo es um Vorschläge geht, die man in die verschiedenen<br />
Politikebenen weiterleiten kann. In unserem<br />
Nachbarschaftszentrum haben wir vor allem über die<br />
Schüler, die zu uns zum Nachhilfeunterricht kommen,<br />
Kontakt zu den Familien. Diese Familien kommen seit<br />
Jahren als Besucher zu uns, also wir haben da wirklich<br />
eine gute Zusammenarbeit über die Jahre entwickelt.<br />
Alleine durch niedrig schwellige <strong>Arbeit</strong> stabilisieren wir<br />
auch ein bisschen Frauen-Power bei den Müttern oder<br />
Mädchen aus den Migrationsfamilien. Wenn sie einmal<br />
den Weg zu uns gefunden haben, sind sie auch bereit,<br />
was zu machen. Ein Beispiel: Wir haben erreicht, dass<br />
Mütter oder Mädchen wiederholt ehrenamtlich das türkische<br />
Frühstück mit wirklich viel <strong>Arbeit</strong>saufwand vorbereitet<br />
haben. Es waren dann überwiegend deutsche<br />
Besucher, die das genutzt haben. Aber das sind Aktionen,<br />
wo man sich näher kommt und ein bisschen Selbstwertgefühl<br />
bekommt. Dabei zeigt sich auch, dass teilweise<br />
die Familien, bzw. überwiegend die Mütter, mit Fragen<br />
kommen. Es ist also auf alle Fälle möglich, zunehmend<br />
auch die Familien mit reinzuholen.<br />
TN: Ich glaube schon, dass es gesellschaftspolitisch in<br />
Bezug auf weibliches Rollenverständnis noch sehr, sehr<br />
viel zu tun gibt. Auch was die sexuelle Befreiung angeht.<br />
Ich kenne Mädchen, die vögeln wirklich durch die Gegend<br />
wie Hölle und behaupten, das wäre Freiheit. Die stehen<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 21
22<br />
Workshop Frauenpower<br />
500 Meter neben sich und kriegen es gar nicht mehr mit,<br />
was sie da mit sich machen. Sie sagen sogar noch, dass<br />
sie genauso gut rumfi cken können wie die Kerle auch.<br />
Und dabei berufen sie sich auf etwas wie sexuelle Freiheit<br />
und gleiches Recht <strong>für</strong> alle.<br />
Die traditionelle Frauenrolle beinhaltet einerseits eine<br />
Machtposition, aber sie wird nur gehalten, weil tief unter<br />
dem Ganzen eine große Ohnmacht von Frauen zementiert<br />
wird. Das haben wir über Generationen so mitbekommen.<br />
Da würde ich ganz selbstkritisch viel genauer hingucken,<br />
woran wir festhalten und wo wir auf eine ganz komische<br />
Art und Weise Macht ausüben, die uns letztendlich nichts<br />
bringt.<br />
TN: Ich wollte noch auf unser Forschungszentrum hinweisen,<br />
das ein Projekt gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus,<br />
dem Kreativhaus, angeht, in dem Schüler an<br />
Probleme herangeführt werden, die wir hier auch besprochen<br />
haben. Hier sind die Erfahrungen der Alten wichtig.<br />
Da sind erfahrene Leute, ob Männer oder Frauen, das<br />
spielt in dem Zusammenhang keine Rolle, die sich mit<br />
den jungen Leuten an einen Tisch setzen und deren Fragen<br />
beantworten. Es ist ja nicht so, dass die völlig desinteressiert<br />
sind, sondern sie werden von zu Hause da<strong>für</strong><br />
nicht sensibilisiert, man spricht darüber einfach nicht.<br />
Ich fi nde es insofern ganz wichtig, dass wir uns da<strong>für</strong> einsetzen,<br />
dass die Fragen der Jungen und Mädchen beantwortet<br />
werden, die sie an uns haben. Und sei es, dass<br />
sie nur in ein Streitgespräch kommen, dass man sagt, na<br />
ja, Langeweile oder Gleichgültigkeit ist ja gut und schön,<br />
aber das kann es doch nicht sein. Dass man darüber erst<br />
mal seine eigenen Erfahrungen einbringen kann, aber<br />
auch die Kinder und Jugendlichen dazu anregt, selber zu<br />
überlegen. Genauso wie wir hier reden und davon etwas<br />
mitnehmen, so ist es auch, wenn man generationenübergreifend<br />
tätig wird. Ich fi nde es immer wichtig, dass man<br />
den anderen achtet. Das wird vielen jungen Leuten nicht<br />
so bewusst, auch nicht bewusst gemacht. Darauf muss<br />
man immer wieder Einfl uss nehmen.<br />
TN: Mich machen solche Sachen, wie mit diesem 500<br />
Meter neben sich Stehen, weil man einfach wild durch<br />
die Gegend vögelt und denkt, man ist jetzt cool, total<br />
betroffen. Aber ich denke immer wieder, dass es diese<br />
berühmten Brüche braucht und auch so etwas wie Therapie,<br />
was sich an vielen Punkten gar nicht umgehen lässt,<br />
also diese Form von Refl ektion mit einem Gegenüber, was<br />
man dann auch mit den ganzen Fragen aushält. Ich weiß<br />
nicht, ob man diesen Prozess wirklich abkürzen kann. Für<br />
die jungen Leute heute ist es enorm schwierig, wie sie<br />
aufwachsen, wie sie sich in einer Gruppe behaupten, mit<br />
welchen Forderungen und Problemen sie ständig in der<br />
Gruppe konfrontiert werden. Und dann noch zu wissen,<br />
was ist eigentlich menschlich, also welche Rechte habe<br />
ich auch, auf mich zu achten und mich von anderen zu<br />
distanzieren.<br />
TN: Wo werden denn mit Kindern und Jugendlichen als<br />
wertgeschätzten Persönlichkeiten Gespräche geführt?<br />
Die jungen Leute ernst zu nehmen, ist ein wichtiger Punkt<br />
in unserer <strong>Arbeit</strong>. Dadurch entsteht Persönlichkeitsbildung<br />
und auch gesellschaftliche Bildung, mehr als wenn<br />
ich nur Kritik übe.<br />
TN: Wir haben ein Community-Center in Israel besucht,<br />
wir waren auch bei anderen Projekten im europäischen<br />
Ausland. Was mich bei uns immer wieder empört, ist das<br />
geringe gesellschaftliche Ansehen, das die <strong>sozial</strong>e <strong>Arbeit</strong><br />
hier hat. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Auch<br />
in New York waren wir erstaunt, dass Sozialarbeit dort<br />
einen richtig hohen gesellschaftlichen Status hat, weil<br />
Sozialarbeiter eben in unterschiedlichen Stadtteilen sehr<br />
viel wichtige <strong>Arbeit</strong> machen, wodurch sie tagtäglich den<br />
gesellschaftspolitischen Frieden garantieren. Diese Anerkennung<br />
ist hier noch nicht sehr ausgeprägt.<br />
TN: Aber da schließt sich doch der Kreis. Wenn wir unsere<br />
<strong>Arbeit</strong> selbstbewusst sehen, dann wird sie auch nach<br />
außen selbstbewusst dargestellt. Wir neigen aber dazu,<br />
sie selber klein zu reden und runter zu spielen. Wir sorgen<br />
selbst da<strong>für</strong>, dass sie so dürftig ankommt, weil wir unsere<br />
<strong>Arbeit</strong> schlecht gesellschaftlich vertreten.
Input<br />
Workshop<br />
Jugend – Herausforderungen<br />
Jugendarbeit begegnet Nachbarschaftsarbeit<br />
Ralf Jonas Bürgerhaus Oslebshausen (Bremen)<br />
Elke Ostwaldt Outreach (Treptow-Köpenick)<br />
Stephan Preschel Outreach (Team Oberschöneweide)<br />
Steffen Kindscher Outreach (Team Oberschöneweide)<br />
Moderation: Herbert Scherer<br />
Herbert Scherer: Wir haben zu dem Thema „Jugendarbeit<br />
begegnet Nachbarschaftsarbeit“ zwei Impulsbeiträge.<br />
Stephan Preschel: Wir kommen vom Outreach-Team<br />
Mobile Jugendarbeit Berlin und arbeiten im Berliner<br />
Bezirk Treptow-Köpenick. Ich bin 42 Jahre alt und in Berlin<br />
geboren, mein Kollege Steffen Kindscher, 30 Jahre alt,<br />
und unsere Kollegin Elke Ostwaldt.<br />
Elke Ostwaldt: Ich mache die Regionalleitung Treptow-<br />
Köpenick. Heute wollen wir zu einem Konfl ikt in Oberschöneweide<br />
etwas erzählen und starten mit einem Film,<br />
den wir im Verlauf dieses Konfl ikts gemacht haben. Der<br />
soll einerseits unseren Kiez zeigen. Oberschöneweide<br />
ist ein altes <strong>Arbeit</strong>erviertel, bis zur Grenzöffnung gab es<br />
über 20.000 <strong>Arbeit</strong>splätze in der Industrie, aktuell nur<br />
noch 3.500 <strong>Arbeit</strong>splätze, der Bezirk ist also von einer<br />
hohen <strong>Arbeit</strong>slosigkeit betroffen. Die Hoffnung ist derzeit,<br />
dass mit der Ansiedlung der Fachhochschule <strong>für</strong> Technik<br />
und Wirtschaft viele neue Studenten kommen, dass<br />
sich das ganze Viertel belebt, und dass es eine andere<br />
Durchmischung geben wird. Hier arbeiten wir täglich mit<br />
Jugendlichen, deren Lebensmittelpunkt die Straße ist.<br />
Wir machen rein aufsuchende <strong>Arbeit</strong> mit Jugendlichen<br />
im Alter von 14 bis 21 Jahren. Dann haben wir noch ein<br />
Kinderteam, das arbeitet mit Kindern im Alter von 9 bis<br />
13 Jahren.<br />
Wir haben noch ein besonderes Ausnahmeprojekt, das<br />
ich auf der Tagung letztes Jahr bereits vorgestellt hatte,<br />
das heißt Sofja, <strong>sozial</strong>räumliche Familien- und Jugendarbeit.<br />
Das ist eine Kombination von aufsuchender<br />
Familientherapie und Streetwork, also ein sehr ungewöhnliches<br />
Modell. Das haben wir entwickelt, weil wir<br />
merkten, dass es nicht nur wichtig ist, mit den Kindern<br />
und Jugendlichen zu arbeiten, sondern dass wir die<br />
Eltern einbeziehen müssen. Wir arbeiten mit sogenannten<br />
Multiproblemfamilien. Das sind Familien, in denen<br />
es sehr viele familiäre Konfl ikte gibt. Wir arbeiten mit<br />
Jugendlichen zusammen, die notorisch Schuldistanz<br />
haben, also wenn jemand einen Hauptschulabschluss<br />
schafft, dann sind wir immer schon gut dabei. Es gibt<br />
auch einige mit einem Realschulabschluss, aber das ist<br />
eher die Ausnahme. Sehr viele Jugendliche haben große<br />
Probleme, auf dem Ausbildungsmarkt integriert zu werden,<br />
weil sie einerseits das Problem haben, überhaupt<br />
etwas kontinuierlich zu machen, andererseits verfügen<br />
sie in der Regel nicht über einen adäquaten Hauptschulabschluss.<br />
In dem Film wird deutlich, wie unterschiedlich<br />
bzw. vielfältig dieser Kiez ist, wie die Straßen<br />
aussehen, wie die Atmosphäre ist. Das Besondere ist,<br />
dass der Film die Perspektiven der Jugendlichen und<br />
Kinder zeigt, wie sie ihren Kiez sehen. Die Erwachsenen<br />
sagen immer, oh Gott, Oberschöneweide, wie sieht es<br />
denn hier aus, die vielen Problemlagen usw.. Aber die<br />
Jugendlichen sagen, dass sie das gar nicht so sehen.<br />
Sie lieben ihren Kiez, er ist ihr Zuhause – und das vermittelt<br />
unser Film.<br />
Es ist ein Film, der in Kooperation mit der Volkshochschule,<br />
einem Jugendclub und Outreach Mobile Jugendarbeit<br />
entstanden ist. Das Geld hat uns Ende letzten<br />
Jahres tatsächlich die Volkshochschule gegeben. Wir<br />
haben keinen Cent bezahlt. Die Volkshochschule ist auf<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 23
24<br />
Workshop Jugend - Herausforderungen<br />
uns zugekommen und sagte, dass sie gerne eine Kooperation<br />
mit uns hätte, weil sie mit Jugendlichen arbeiten<br />
möchten. Aber das sollte nicht in ihrem Haus stattfi nden,<br />
sondern in einem Jugendclub, weil die Erwachsenen sich<br />
sonst bedrängt fühlen. Das ist ungefähr die Problemlage<br />
und davon handelt dieser Film.<br />
Herbert Scherer: Wegen technischer Schwierigkeiten zeigen<br />
wir den Film später, deshalb bitten wir Ralf Jonas aus<br />
Bremen vom Bürgerhaus Oslebshausen, seinen Beitrag<br />
vorzuziehen. Das Bürgerhaus Oslebshausen in Bremen<br />
hat eine Besonderheit – bezogen auf die Jugendarbeit.<br />
Irgendwann wollten sie einen neuen Geschäftsführer<br />
einstellen. Dieser Geschäftsführer hat eine Bedingung<br />
gestellt: Er wollte diesen Job nur machen, wenn er Jugendarbeit<br />
machen kann. Er hat dann Jugendarbeit in den Mittelpunkt<br />
des Nachbarschaftshauses gestellt und zwar als<br />
attraktives Angebot <strong>für</strong> die Familien.<br />
Ralf Jonas: Eine Besonderheit bei uns ist wahrscheinlich<br />
wirklich, dass ich bei meinem Antritt ein Haus vorgefunden<br />
habe, in dem es zwar auch mal Kinder und Jugendliche<br />
gab, aber nur ganz klassisch, mal eine Kinderdisko,<br />
mal ein Kindertheater. Aber es gab keine echte Jugendarbeit.<br />
Ich habe dann ganz autodidaktisch angefangen, mit<br />
den Jugendlichen klassische Sozialarbeit zu machen. Wir<br />
haben um unser Haus herum ein riesengroßes Gelände,<br />
einen riesengroßen Spielplatz. Dorthin habe ich mir eine<br />
Jugendgruppe von der Straße geholt. Ich bin kein ausgebildeter<br />
Jugend<strong>sozial</strong>arbeiter und habe vorher noch nie<br />
etwas mit Jugendlichen zu tun gehabt. Ich hatte vorher<br />
nur mit Erwachsenen zu tun, aber das auch nur als Student,<br />
weil ich direkt nach dem Studium in diese Funktion<br />
als Geschäftsführer gekommen bin.<br />
Diese Jugendarbeit hat sich dann unglaublich entwickelt.<br />
Das hatte auch damit zu tun, dass ich als Leitung natürlich<br />
auch auf mein Team einwirken konnte. Wir hatten<br />
verschiedene Beratungen usw., weil auch die Kollegen<br />
keine konkrete Kultur- oder Sozialarbeit gemacht haben,<br />
sondern mehr administrativ tätig waren. Klassischerweise<br />
macht ja der Geschäftsführer einer solchen Einrichtung<br />
keine konkrete Gruppenarbeit. Mir hat das aber<br />
viel Spaß gemacht. Mit der ersten Jugendgruppe, die<br />
praktisch tagtäglich im Bürgerhaus war, zusammen mit<br />
den Jugendlichen habe ich Zirkus gelernt, also ich selber<br />
habe jonglieren und andere Sachen gelernt. Daraus ist<br />
bis heute ein blühender Jugend- und Kinderzirkus geworden,<br />
der eine ganz zentrale Funktion im Bürgerhaus hat.<br />
Nach außen ist er jetzt unser Leitbild, also wir stecken<br />
alles, was wir an Geld und Personenressourcen haben, in<br />
die Kinder- und Jugendarbeit.<br />
Es gibt darüber hinaus natürlich auch alle anderen Gruppen<br />
in dem Bürgerhaus, Senioren, Familie, Kleinkinder<br />
usw. – wie überall in den Häusern auch, aber die sind<br />
mehr oder weniger sich selbst überlassen. Sie kriegen<br />
von uns zwar organisatorische Hilfen, aber alles, was wir<br />
an Personal haben, konzentriert sich auf die Kinder- und<br />
Jugendarbeit.<br />
Das hat dazu geführt, dass unsere <strong>Arbeit</strong> in der Stadt<br />
einen Stellenwert und Anerkennung bekommen hat.<br />
Wenn heute in Bremen vom Bürgerhaus Oslebshausen<br />
gesprochen wird, dann wird in erster Linie von der Kinder-<br />
und Jugendarbeit gesprochen. Das hat sehr viele positive<br />
Auswirkungen gehabt, auch was die Finanzierung<br />
des Hauses angeht. Die Verhandlungen mit Stiftungen,<br />
Spendern und Geldgebern laufen leichter, weil man mit<br />
der Sache nach außen gut ankommt. Die ganze Jugendarbeit<br />
kostet unglaublich viel Geld. Ohne dass wir zusätzlich<br />
unsere <strong>Arbeit</strong>szeit da<strong>für</strong> verwenden, Geld zu organisieren,<br />
könnten wir unsere Kinder- und Jugendarbeit<br />
nicht machen. Inzwischen werden 90 % unserer Gehälter<br />
von der Stadt getragen. Aber alles, was Programm- und<br />
Betriebskosten betrifft, müssen wir selber erwirtschaften.<br />
Inzwischen machen wir das auch zum Teil über die Kinder-<br />
und Jugendarbeit, weil wir mittlerweile auch über ein<br />
Zirkuszelt und haufenweise Equipment verfügen. Damit<br />
können die Jugendlichen auch woanders Veranstaltungen<br />
bzw. Aufführungen machen.<br />
Neben dem Zirkus hat sich noch Hip Hop herausgebildet,<br />
Tanzgeschichten. Wir haben schon drei Musicals<br />
produziert, auch mit ganz gutem Erfolg, auch teilweise<br />
verkauft. Neu dazugekommen ist eine Art Künstler-<br />
<strong>Arbeit</strong>, in der Künstler zusammen mit den Kindern aktiv<br />
sind und regelmäßig Ausstellungen machen. Das alles
fi ndet in Gröpelingen statt. Das ist in Bremen der Stadtteil,<br />
dem es am schlechtesten geht. Wobei ich persönlich<br />
fi nde, dass das ein ganz toller Stadtteil ist, der ganz<br />
viel buntes <strong>kulturelle</strong>s Leben hat. In den Medien werden<br />
eben nur die negativen Sachen hochgekocht, alles<br />
andere fi ndet kaum Erwähnung. Ich fi nde, es ist zwar ein<br />
sehr belasteter Stadtteil, ganz klar, die Werft AG Weser<br />
ist weg, hohe <strong>Arbeit</strong>slosigkeit, hoher Migrantenanteil,<br />
aber das ist kein Hindernis <strong>für</strong> eine gut funktionierende<br />
Kinder- und Jugendarbeit.<br />
TN: Was war Ihr Beweggrund, die Jugendarbeit zur Bedingung<br />
zu machen?<br />
Ralf Jonas: Als ich anfi ng, habe ich gesehen, dass mir<br />
etwas in diesem Haus fehlte. Nach und nach habe ich<br />
die Struktur im Haus verändert, die Vorstandsstruktur, die<br />
Mitbestimmungsstruktur, weil die nur von Alten besetzt<br />
war. Wir haben zum Beispiel den Vorstand von 12 auf<br />
3 Leute reduziert. Auf jeden Fall haben wir dem Ganzen<br />
eine Linie gegeben, fi nde ich. Persönlich habe ich Spaß<br />
an dieser Kinderarbeit gefunden. Im Haus gab es auch<br />
viele Konfl ikte, aber die sind immer fruchtbar. Wir haben<br />
auch Senioren im Haus. Es gibt immer mal wieder Konfl<br />
ikte, das wäre ja vollkommen unnormal, wenn nicht,<br />
aber sie sind eher befruchtend und inzwischen vertragen<br />
sich alle.<br />
TN: Das war die Kurzfassung.<br />
TN: Es ist so gewesen, dass Ralf tatsächlich gesagt hat,<br />
ich will nicht nur Geschäftsführer sein, sondern Gruppenarbeit<br />
machen. Er hatte Kinder bzw. Jugendliche, die im<br />
Heim untergebracht werden sollten. Wir sind mit ihnen zu<br />
einer staatlichen Stelle der Erziehungshilfe gegangen und<br />
haben gesagt: Wir machen Angebote <strong>für</strong> diese Kinder,<br />
fi nanziert die, dann spart ihr euch <strong>für</strong> sie die Heimkosten.<br />
Die haben gesagt: nee, Geld kriegt ihr nicht. Punkt. Das<br />
wurde der Ausgangspunkt unserer Jugendarbeit.<br />
Herbert Scherer: Wann hat das angefangen?<br />
Ralf Jonas: 1988. Zurzeit mache ich vier Gruppen pro<br />
Woche, mit Vor- und Nachbereitung sind das 4 x 4 Stunden,<br />
insofern kann man sagen, Hälfte – Hälfte.<br />
Herbert Scherer: Ist das Bürgerhaus Oslebshausen eine<br />
kleine Einrichtung, wo so etwas geht?<br />
Ralf Jonas: Ja. Das Bürgerhaus selber hat einen großen<br />
Saal <strong>für</strong> 160 Leute, einen kleinen Saal, ein paar Gruppenräume<br />
– und das war’s.<br />
TN: Wie viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene gehen<br />
da pro Woche ein und aus?<br />
Ralf Jonas: Das sind 150 Kinder und Jugendliche. Insgesamt<br />
haben wir pro Jahr einen Besucherdurchlauf von<br />
etwas über 5.000.<br />
TN: Worin besteht das Angebot? Das sind eher geschlossene<br />
Gruppen und kein offenes Angebot?<br />
Ralf Jonas: Ja. Es gab Versuche, im normalen Tagesgeschäft<br />
verschiedene offene Angebote zu machen. Aber<br />
das war eher schwierig, weil wir da<strong>für</strong> nicht die Personaldecke<br />
hatten. Jetzt gibt es die Gruppenarbeit im Bereich<br />
Zirkus, Theater, Tanz und Musik. Es gibt den Bereich Hip<br />
Hop. Da ist eine Besonderheit, dass die Jugendlichen<br />
selber einen Schlüssel haben. Sie können kommen und<br />
gehen wie sie wollen und Räume nutzen. Das ist meistens<br />
in der Nacht und am Wochenende, wenn nix los ist, dann<br />
sind die oft im Haus und trainieren. Das ist sozusagen<br />
unser offener Anteil. Das funktioniert, weil wir zwei oder<br />
drei inzwischen 25-Jährige haben, die seit 20 Jahren im<br />
Bürgerhaus sind und auch die Verantwortung übernehmen.<br />
Wir machen also nicht das klassische offene Haus,<br />
sondern ganz klar Gruppenarbeit.<br />
Die Gruppen versuchen immer, verschiedene Kinder<br />
unterschiedlicher Herkunft in die Gruppen zu integrieren.<br />
Die Nachfrage an den Gruppen ist sehr hoch, wir können<br />
die gar nicht alle unterbringen. Darüber, dass <strong>für</strong> die Gruppenangebote<br />
Teilnahmebeiträge bezahlt werden müssen,<br />
weil sie darüber teilfi nanziert werden, trifft man ja auch<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 25
26<br />
Workshop Jugend - Herausforderungen<br />
eine Auswahl im Stadtteil. Hartz IV-Empfänger kommen<br />
dann eher nicht, wenn es Geld kostet, aber da versuchen<br />
wir eben durch Kontakte zu Sozialen Diensten usw. auch<br />
einen Teil zu integrieren.<br />
Aber das Bürgerhaus hat noch eine andere Besonderheit:<br />
wir werden nicht gefördert vom Senator <strong>für</strong> Soziales, sondern<br />
vom Senator <strong>für</strong> Kultur. Von uns wird erwartet, dass<br />
wir schöne, <strong>kulturelle</strong> Sachen mit Kindern machen. Damit<br />
bin ich auch nicht ganz zufrieden, weil ich auch viele Probleme<br />
im Stadtteil sehe, die wir damit nicht bewältigen.<br />
Aber andererseits sehe ich ganz viele Kinder und Jugendliche,<br />
die dadurch auch einen entscheidenden Kick <strong>für</strong><br />
ihr Leben kriegen, was in die Hand nehmen, was zu verändern,<br />
ihren Hauptschulabschluss zu schaffen, teilweise<br />
dann hinterher auch nach Berlin oder nach London zur<br />
Zirkusschule zu gehen. Oder sie machen sich ohne Hauptschulabschluss<br />
als Tänzer in irgendeiner Form selbstständig<br />
und überleben so.<br />
Timm Lehmann: Welche Konfl ikte gibt es und wie löst ihr<br />
sie? Mein Hintergrund: Ich komme aus einem Mehrgenerationenhaus<br />
in Berlin-Zehlendorf. Wir haben den Vorteil,<br />
dass es vorher eine Jugendfreizeiteinrichtung war. Das<br />
heißt, das Haus hatte ein Image, das mit Jugendarbeit<br />
zu tun hatte. Wir machen recht erfolgreich die <strong>Arbeit</strong>, die<br />
du auch beschreibst, dass ihr als Haus von der <strong>Arbeit</strong><br />
mit den Kindern profi tiert. Diese klassischen Konfl iktsi-<br />
tuationen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, was<br />
Lärm, Ordnung oder Sauberkeit angeht, bearbeiten wir<br />
mit sehr strengen Regeln. Dadurch haben wir Interventionsmöglichkeiten.<br />
Das ist sehr arbeitsintensiv, weil die<br />
Durchsetzung der Regeln unseren Mitarbeitern obliegt.<br />
Das funktioniert nur, wenn wir auch noch jemand haben,<br />
der mit den Jugendlichen arbeitet, die die Regeln nicht<br />
einhalten können. Das ist unser Spannungsfeld und ich<br />
bin neugierig, wie ihr damit umgeht.<br />
Ralf Jonas: Klare Regeln sind absolut wichtig. Sie sind<br />
die einzige Chance zum Ausgleich in Konfl ikten zwischen<br />
Jugendlichen und Senioren. Meistens geht es ja um<br />
belanglose Sachen: dass Jugendliche die Füße auf die<br />
Tische legen, der Klassiker, oder die Musik aus dem Saal<br />
zu laut ist, also richtig große Konfl ikte habe ich persönlich<br />
noch nicht erlebt. Bei diesen Kleinigkeiten ist es wichtig,<br />
dass man schnell ins Gespräch kommt, dass man Jugendliche<br />
und Senioren konfrontiert, sie sich auch gegenseitig<br />
anschreien lässt. Man sollte sie die Sache auf den Punkt<br />
bringen lassen. Teilweise ist es auch witzig, was dabei<br />
rauskommt, denn unsere Senioren machen zum Beispiel<br />
auch Musik, die ganz schrecklich ist, also mir ist der Hip<br />
Hop lieber. Wenn die Jugendlichen dann sagen, dass sie<br />
die Quetschkommode der Senioren auch furchtbar fi nden.<br />
Die Leute müssen in ein direktes Gespräch mit einander<br />
kommen, was ja schwer ist, weil das nicht über Beziehungen<br />
zwischen Einzelnen geht. Aber durch ein gutes<br />
Beziehungsgefl echt geht das. Und ganz klare Regeln <strong>für</strong><br />
alle, nicht nur <strong>für</strong> die Jugendlichen, das ist wichtig.<br />
Ralf Jonas: Jedes Jahr organisieren wir ungefähr vier<br />
Punkte, an denen Jugendliche oder Kinder im Haus auftreten.<br />
Das führte deutlich zu einer erhöhten Akzeptanz<br />
gegenüber den Jugendlichen. Ein normaler deutscher<br />
Senior guckt erst mal schief, wenn da vier Hip Hopper<br />
reinkommen, aber wenn sie die mal auf der Bühne erlebt<br />
haben oder nach dem Auftritt mal persönlich kennen lernen,<br />
lösen sich Vorbehalte oft in Luft auf. Meine Erfahrung<br />
ist, dass gerade diese Jugendlichen ausgesprochen<br />
höfl ich zu älteren Menschen sind.
TN: Du sagtest, wenn sich Beziehungen zwischen den<br />
Älteren und den Jüngeren entwickeln, dann wird die Situation<br />
anders. Schafft ihr gezielt Möglichkeiten, dass sich<br />
Alte und Junge treffen und austauschen können und ggf.<br />
sogar etwas miteinander machen? Oder ist das ganz strikt<br />
und säuberlich getrennt?<br />
Ralf Jonas: Das passiert leider nicht oft genug, aber es<br />
passiert an bestimmten Punkten. Wir haben zum Beispiel<br />
mal ein Projekt gemacht, wo unsere Senioren-Theatergruppe<br />
mit der Jugendtheatergruppe und mit den<br />
Breakdancern zusammen ein Stück gemacht hat. Das<br />
war ganz, ganz schwierig und hat mich viele Nerven und<br />
graue Haare gekostet. Es war unglaublich anstrengend,<br />
aber es war wirklich so, dass die Jugendlichen mit älteren<br />
Leuten in die Disco gegangen sind. Das hätte ich mir nie<br />
vorstellen können.<br />
TN: Das ist eine echte Erfolgsmeldung.<br />
Ralf Jonas: Die Jugendlichen haben einen Kreis gebildet,<br />
als eine 70-jährige Frau getanzt hat, um sie sozusagen zu<br />
beschützen. Das ist sehr gut, aber das passiert natürlich<br />
nur punktuell. Schwierig ist auch, Sachen zu fi nden, die<br />
man da zusammenbringen kann.<br />
Herbert Scherer: Wir sehen uns jetzt erst einmal den Film<br />
an.<br />
<br />
Stephan Preschel: Dieser Film ist das Endprodukt eines<br />
Prozesses, der in Oberschöneweide durch eine Krisensituation<br />
entstanden ist. Verschiedene Institutionen waren<br />
darin involviert, zum Beispiel eine Grundschule, eine<br />
Volkshochschule. Dann kommt dazu das Grünfl ächenamt,<br />
das Sportamt, die haben dort Kinderspielplätze und<br />
Sportplätze. Und das Mehrgenerationenhaus KES, was<br />
vielleicht vergleichbar ist mit den Häusern des <strong>Verband</strong>es<br />
<strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong>, nur eben kommunal, also wie<br />
ein Nachbarschaftsheim. Die haben auf einmal wahnsinnig<br />
Stress auf diesem Platz gehabt. Das ist ein Areal, auf<br />
dem Kinder und Jugendliche auf unterschiedliche Weise<br />
ihre Freizeit verbringen. Das ist öffentlicher Raum und sie<br />
stören da eben. Die Situation hat sich über einen gewissen<br />
Zeitraum zugespitzt.<br />
Daraufhin haben sich verschiedene Versuche entwickelt,<br />
wie man dieser Situation in irgendeiner Form Herr werden<br />
könnte. Es wurde die Polizei verschärft eingesetzt,<br />
aber auch private Sicherheitsdienste. Aber alle Beteiligten<br />
haben mit der Zeit gemerkt, dass das keine Lösung<br />
ist und man etwas <strong>für</strong> die Kinder und Jugendlichen tun<br />
müsste. In diesem Kontext kam Outreach, wir waren dort<br />
anwesend und haben Angebote unterbreitet. Unsere Kollegen<br />
haben mit den Kindern gearbeitet, wir hatten dann<br />
den Kontakt zu den Jugendlichen. Wir haben uns mit den<br />
Kollegen aus den anderen Institutionen an einen Tisch<br />
gesetzt und versucht Ideen zu entwickeln. Was kann man<br />
machen?<br />
Steffen Kindscher: Es gibt dort einen Schulhof, einen<br />
Spielplatz, nebenan ist ein Sportplatz, Jungs, die Fußball<br />
spielen, aber auch andere Gruppen, die auf den Fußballplatz<br />
gehen, um dort zu saufen. Jugendliche, die sich auf<br />
dem Kinderspielplatz verkrümeln, sich da verstecken und<br />
dort kiffen und andere Sachen machen. Andererseits ist<br />
toll an dem Platz, dass man von jedem Passanten gesehen<br />
werden kann, der Platz ist absolut zentral, deshalb<br />
wurde er sehr „in“. In diesem Jahr zum Beispiel ist auf<br />
diesem Platz gar nichts mehr los. Diese Phänomene kann<br />
man schwer erklären.<br />
Die vielen Besucher sorgten natürlich <strong>für</strong> entsprechende<br />
Lärmbelästigung. Die Nachbarschaft hat da mitgemacht,<br />
sie haben nachts die Fenster aufgerissen und mit ihrer<br />
Musik eine Gegenbeschallung gestartet, also es waren<br />
richtig absurde Zustände. Die Nutzer der Volkshochschule<br />
fühlten sich gestört, weil da Jugendliche rumhingen. Es<br />
kam nie zu Übergriffen, aber es gab ein subjektives Unsicherheitsgefühl.<br />
Die Institutionen sprangen natürlich im<br />
Dreieck. Der Direktor der Grundschule hatte auch zwei<br />
persönliche Attacken erfahren, es wurde in dem Jahr<br />
zweimal von ehemaligen Schülern eingebrochen in die-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 27
28<br />
Workshop Jugend - Herausforderungen<br />
ser Schule. Beim ersten Mal haben sie die Schule mit<br />
Feuerlöschern dekoriert, sodass der Schulbetrieb zwei<br />
Tage gestört war, der zweite Einbruch fand im September<br />
statt.<br />
Elke Ostwaldt: Die Schule musste tatsächlich zwei Tage<br />
lang geschlossen werden. Das hat natürlich verständlicherweise<br />
<strong>für</strong> so viel Aufruhr und Furore gesorgt, dass<br />
der Direktor der Grundschule gesagt hat, dass sie einen<br />
Zaun um ihren Schulhof bauen. Dieser Schulhof war bislang<br />
immer frei zugänglich gewesen, die Kollegen von<br />
unserem Kinderteam haben dort Angebote <strong>für</strong> die Kinder<br />
gemacht. Aufgrund dieses Einbruchs stand dann nach<br />
den Sommerferien der Zaun. Auch wir durften den Schulhof<br />
nicht mehr betreten.<br />
Das war auch eine Kritik an mir, denn wir wussten ja, wer<br />
die Bösewichte waren und hätten schon beim Einbruch<br />
eingreifen müssen, um das zu bearbeiten. Da aber drumherum<br />
so viel Stress war, sind wir dort nicht eingeschritten.<br />
Meine Sicht ist die der Regionalleitung, eine andere<br />
Sicht ist diejenige der Kollegen, und so tauschen wir uns<br />
im Team auch immer aus. Es gibt unterschiedliche Perspektiven:<br />
die der Kinder und Jugendlichen, aber auch<br />
die Perspektive der Anwohner.<br />
Steffen Kindscher: Dieses Gelände war seit Jahren eine<br />
Dauerbaustelle, die schlecht abgesichert war. Die Kinder<br />
und Jugendlichen sind auf Baugerüsten herumgeturnt.<br />
Die Dozenten der VHS haben manchmal vergessen, die<br />
Fenster zu schließen, was die Jugendlichen gemerkt<br />
haben und in den Räumen drin waren. Es kam zu ständigen<br />
Beschmierungen, also die Schule hatte eine Wand<br />
geweißt und eine Woche später war sie wieder mit Graffi -<br />
tis beschmiert. Das alles waren Gründe <strong>für</strong> den Schuldirektor,<br />
so restriktiv zu reagieren.<br />
Stephan Preschel: Von der Grundschule wurde dieser<br />
Schulhof <strong>für</strong> das Gemeinwesen und den Sozialraum<br />
geöffnet, fi nanziert aus EU-Mitteln. Das ist die eine Seite,<br />
es wurde entsprechend Geld <strong>für</strong> Materialien <strong>für</strong> die Umgestaltung<br />
zur Verfügung gestellt. Nicht bedacht wurde<br />
dabei nach meiner Meinung: wenn dieser öffentliche<br />
Raum zur Verfügung gestellt wird, dann muss er auch von<br />
den Institutionen, die herum sind, getragen werden, wo<strong>für</strong><br />
es Angebote und Personal geben muss.<br />
Ab einem bestimmten Zeitpunkt hat das den Schuldirektor<br />
so genervt, dass er es vorzog, den Schulhof zu schließen,<br />
damit es nicht mehr zum Vandalismus kommt.<br />
Steffen Kindscher: Dann passierte natürlich, was immer<br />
passiert: Es bilden sich Interessengruppen und runde<br />
Tische, wo sich die erbosten Eltern und Lehrer einfi nden<br />
und das Problem letztendlich auf die Jugendlichen zentrieren.<br />
Die allgemeine und beste Lösung erschien in dem<br />
Moment, die Polizeipräsenz zu erhöhen, einen Wachschutz<br />
zu engagieren und einen Zaun zu bauen. Der Einzige, der<br />
an dieser Sitzung etwas <strong>für</strong> die Jugendlichen gesagt hat,<br />
war der Jugendbeauftragte der Polizei. Er meinte, wenn<br />
wir darüber nachdenken, sollten wir die Jugendlichen mit<br />
einbeziehen. Ein kluger Satz, meine ich.<br />
Die erbosten Eltern, die ja nie auf den Spielplatz gehen<br />
konnten, die trafen wir aber bei unseren Streetwork-Rundgängen<br />
komischerweise nie im Kiez, die nutzten auch<br />
diesen Spielplatz nicht oder haben das auch gar nicht<br />
probiert. Aber man hat dieses Forum benutzt, um erst mal<br />
verbale Angriffe zu starten. Am Ende saßen dann wieder<br />
die üblichen Verdächtigen in einer Vernetzungsrunde, die<br />
Mitarbeiter von Outreach, die Mitarbeiter von der VHS, des<br />
Seniorenzentrums, eine engagierte Lehrerin, die Konrektorin<br />
der Schule. In diesem Rahmen haben wir versucht,<br />
kreativ mit dieser Situation umzugehen. Die Leiterin der<br />
VHS kam dann auf eine ganz tolle Idee, weil sie meinte,<br />
wir sollten mal was Positives machen. Sie hat ein Projekt,<br />
das Junge VHS heißt, aber sie hatte das Problem, dass<br />
wenige Besucher kamen, weil die Jungen einfach keine<br />
Lust haben, in die VHS reinzugehen.<br />
So hat man dann mit materiellen Ressourcen der VHS<br />
angefangen. Die hatten auch einen professionellen Kameramann,<br />
zwei Theaterpädagogen, eine Tanzlehrerin. Der<br />
absolute Clou war, dass wir den deutschen amtierenden<br />
Meister im Beatboxen dabei hatten, der war natürlich wie<br />
ein Magnet <strong>für</strong> die Jugendlichen. Wir haben unsererseits<br />
noch unsere Multiplikatoren ins Spiel gebracht, den Künstler<br />
<strong>für</strong> urbane Lebensweltgestaltung, also einen Sprayer.
Unsere Multiplikatoren waren dann letztendlich <strong>für</strong> die<br />
Jugendlichen viel wichtiger als die Ideen der Theaterpädagogen,<br />
weil sie aus dem Hip Hop-Bereich kamen. Die<br />
haben eine Hip Hop-Gruppe im Kiez, die nennt sich SOH,<br />
Sound of History. Wir stehen mit ihnen schon seit mehreren<br />
Jahren im Kontakt und es haben sich gute Beziehungen<br />
entwickelt, die Jungs sind vernünftig.<br />
Stephan Preschel: Wobei man dazu noch sagen muss,<br />
dass diese Jungs auch Jugendliche sind, mit denen<br />
mein Kollege und ich in der Einzelfallsituation arbeiten,<br />
das heißt, es sind sehr stark gewachsene Beziehungen,<br />
sodass wir sie da<strong>für</strong> auch begeistern konnten. Durch<br />
diese dreijährige Beziehungsarbeit und die Bindung, die<br />
zwischen diesen Jungs und unserer <strong>Arbeit</strong> entstanden<br />
war, haben sie sich völlig verändert, sodass diese Crew<br />
als Multiplikatoren und als Seminarleiter im Rahmen<br />
dieses Workshops das, was sie selber gelernt haben, an<br />
Kleinere bzw. Kinder weitergegeben haben.<br />
Elke Ostwaldt: Ich meine, die Eltern haben sich wegen<br />
des Spielplatzes zu Recht gesperrt, weil bis zu 60 Kids<br />
manchmal dort waren, manchmal bis in die Nachtstunden,<br />
Mädchen wie Jungen, die den Platz bevölkert haben.<br />
Das kennen wir aus unserer <strong>Arbeit</strong>: Jugendliche nehmen<br />
sich ihren Raum. Ab einem gewissen Alter sind Jugendliche<br />
auch ziemlich raumgreifend und so haben sie sich<br />
diesen Platz erobert. Für Eltern und ihre Kinder war dann<br />
kein Platz mehr da. Peu a peu, über diesen Film, auch<br />
über andere Sachen, ist es uns gelungen, dass Eltern<br />
und Kinder diesen Platz wieder benutzen konnten, weil<br />
die Jugendlichen einen anderen bekommen haben. Es ist<br />
wichtig, aus unterschiedlichen Perspektiven hinzusehen.<br />
Natürlich hatten die Eltern ein Recht sich zu beschweren,<br />
natürlich hatte die Volkshochschule ein Recht, sich<br />
zu beschweren, und natürlich hatte die Schule ein Recht,<br />
sich zu beschweren. Nur dass der Großteil der Erwachsenen<br />
gesagt hat, dass sie diese Jugendlichen weg haben<br />
wollten ...Ich besuche selber Volkshochschulkurse und<br />
möchte dort auch nicht angepöbelt werden, aber diese<br />
Jugendlichen haben erst mal nichts gemacht. Sie standen<br />
einfach da, es war eine gefühlte Bedrohung, denn wenn<br />
40 Jugendliche vor der Volkshochschule stehen, dann<br />
möchte man als Erwachsener da nicht unbedingt reingehen.<br />
Es kam eben darauf an zu gucken, auch mit der<br />
Volkshochschule zu überlegenen, was man tun kann.<br />
Die Volkshochschule war der Partner, der gesagt hat:<br />
Okay, wir haben Mittel zur Verfügung, die geben wir euch<br />
gerne. Wir haben gute Leute zur Verfügung, die geben wir<br />
euch auch, aber welche Räumlichkeiten sind da? In der<br />
Volkshochschule selber wäre es ein bisschen schwierig<br />
gewesen – verständlicherweise, weil dann hätten sich die<br />
Jugendlichen die ganze Volkshochschule angeeignet. Das<br />
wollte die Volkshochschule natürlich nicht. Also haben wir<br />
nach Räumlichkeiten gesucht. Da hatten wir – Gott sei<br />
Dank – einen guten Jugendclub, das Inhouse, der uns<br />
diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Das<br />
Inhouse steht leider im Moment kurz vor der Schließung,<br />
aber das ist bis jetzt <strong>für</strong> uns eine unheimlich gute Ressource<br />
im Sozialraum, die wir nutzen können.<br />
Steffen Kindscher: Der Jugendclub steht jetzt einigermaßen<br />
unter Druck. Der Bezirk wird dort wahrscheinlich<br />
Geld rausziehen. Der junge Hip Hopper, der vor drei Jahren<br />
noch Jugendliche von dem Haus weggehalten hat,<br />
hat über eine Internetcommunity, über die Jugendliche<br />
sehr viel kommunizieren, die Nachricht rausgegeben:<br />
Jugendliche, macht euch auf ins Inhouse, das muss<br />
gerettet werden! Da kamen sogar Jugendliche aus Alt-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 29
30<br />
Workshop Jugend - Herausforderungen<br />
glienicke, einem ganz anderen Stadtteil. Was macht ihr<br />
denn hier? Na ja, wir sollen den Jugendclub retten. Das<br />
ist einfach eine Qualität, die man dann auch wieder in den<br />
Sozialraum geben kann, indem man diese Beziehungen,<br />
die man zu den Jugendlichen hat, auch <strong>für</strong> alle anderen<br />
öffnet und den Jugendlichen auch Möglichkeiten gibt,<br />
selber Kontakte zu knüpfen. Das tun diese Jugendlichen<br />
mittlerweile. Sie organisieren sich selber, sind jetzt zum<br />
zweiten Mal auf einem Stadtteilfest, das wir jedes Jahr<br />
haben, auf einer Bühne aufgetreten, ohne dass es zu<br />
irgendwelchen Konfl ikten kam. Ein schöner Nebeneffekt<br />
dabei war: Dieses Stadtteilfest war früher <strong>für</strong> Jugendliche<br />
nicht attraktiv. Seitdem diese Hip Hop-Crew dort ist, kommen<br />
sie und gucken sich friedlich ein Konzert an. Das<br />
hat natürlich auch eine Qualität <strong>für</strong> den Veranstalter, der<br />
freut sich darüber.<br />
Stephan Preschel: Aber der Veranstalter ist vor zwei<br />
Jahren noch nicht selber auf die Idee gekommen, dass<br />
man so etwas auf so einer Veranstaltung installieren<br />
könnte, um so ein Fest <strong>für</strong> Jugendliche attraktiver zu<br />
machen. Das entstand durch unsere aufsuchende<br />
mobile Streetwork-<strong>Arbeit</strong>. Es geht nicht nur darum, dass<br />
wir durch den Kiez laufen und gucken, wo die Jugendgruppen<br />
sind, sondern unsere <strong>Arbeit</strong> beinhaltet auch<br />
Kontaktpfl ege zu den verschiedenen Institutionen bzw.<br />
verschiedenen Schnittstellen, wie in dem Fall dieser<br />
Veranstalter. Über unseren Kontakt können wir Unterstützung<br />
geben, damit die miteinander in Kontakt kommen,<br />
damit es zu so einer positiven Situation kommen<br />
kann.<br />
Herbert Scherer: Was lehrt uns dieses Beispiel? Oder<br />
welche Fragen tauchen da auf? Man könnte die These<br />
aufstellen: Das strenge Vorgehen des Direktors, dass er<br />
da einen Zaun hingestellt hat, hat einen Prozess in Gang<br />
gesetzt, der letztendlich positiv war. Vorhin ist gesagt<br />
worden, es ist wichtig, wenn solche Regeln bestimmte<br />
Jugendliche ausschließen, dass dann jemand da ist, der<br />
das auffängt, sodass sie nicht als Menschen verdrängt<br />
werden, sondern nur aus dem Raum. Seht ihr das mit<br />
dem Direktor jetzt anders? Ihr wart ja wahrscheinlich<br />
ziemlich sauer über dessen Reaktion, oder?<br />
Elke Ostwaldt: Ihr habt ja im Film gesehen, es sind Kinder<br />
und Jugendliche – und <strong>für</strong> die Kinder ist das Abschotten<br />
des Schulhofs fatal, weil sie dort einen geschützten<br />
Raum hatten, Schulhöfe bieten das ja. Die Jugendlichen<br />
sind dort nicht so ohne weiteres hingekommen, aber die<br />
Kinder konnten wirklich wunderbare Spiele dort spielen,<br />
und zwar wirklich spielerisch, Hüpfespiele usw. haben sie<br />
da gemacht. Aber dieser Raum ist defi nitiv weg. Das ist<br />
wirklich sehr, sehr schade. Deswegen waren wir natürlich<br />
mehr als wütend, zumal sich dann alles auf dem Spielplatz<br />
gedrängt hat. Da haben sich die Kinder gedrängt,<br />
die Jugendlichen auch, also das war <strong>für</strong> uns nicht positiv,<br />
sondern das war <strong>für</strong> uns wirklich ein riesiges Problem.<br />
Und wir haben auch nach wie vor große Schwierigkeiten<br />
dort in der Kooperation mit dem Schuldirektor. Das ist<br />
nicht einfach.<br />
Steffen Kindscher: Der zweite Einbruch hatte noch einen<br />
anderen Hintergrund. Das waren Schwellen-Jugendliche,<br />
also eine ganz eigenartige Gruppe, der Jüngste ist 13, der<br />
Älteste 19, Fußball ist ihr Leben, und irgendwie haben die<br />
alle einfach einen Brast – wir kennen die Gruppe ganz<br />
genau – auf ihren ehemaligen Direktor. Sie dachten, dass<br />
sie ihm wieder mal eins auswischen, alle Pädagogen sind<br />
gerade beim Stadtteilfest, also sind sie in die Schule ein-
gestiegen. Was sie nicht wussten, war, dass diese Räume<br />
zu der Kinder-, Eltern- und Senioreneinrichtung gehörten,<br />
die sie bei der Schule angemietet hatte. In einem Raum<br />
waren Gegenstände von einer Seniorengruppe gelagert,<br />
die einbrechenden Jugendlichen fanden z.B. einen Ghettoblaster<br />
und mehrere Kisten mit Sekt.<br />
Die Leiterin dieser Kinder-, Eltern- und Senioreneinrichtung<br />
ist eine sehr gute Pädagogin, beim öffentlichen Träger<br />
angestellt, aber sehr kommunikationsbereit und uns<br />
sehr zugewandt. Wir haben es geschafft, über das Team<br />
von Elke, Stephan und Steffen, diese Jugendgruppe, die<br />
dort eingestiegen ist, so zu beackern, dass die bereit<br />
waren, sich zu entschuldigen, was eine riesengroße Geste<br />
war. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis es zu diesem Termin<br />
gekommen ist, bis die endlich mal erschienen sind.<br />
Jetzt kommt der Hintergrund dieser Geschichte, warum<br />
die Senioren und Ines, die Leiterin, so erbost waren: Die<br />
Sektfl aschen hatten eine rituelle Bedeutung, weil das<br />
eine Seniorengruppe von krebskranken Patienten war.<br />
Wenn ein Mitglied aus der Gruppe gestorben war, haben<br />
sie eine Sektfl asche geöffnet. Als den jungen Menschen<br />
das erklärt wurde, waren sie sehr schwer betroffen. Damit<br />
hatte niemand gerechnet, dass da so ein Hintergrund sein<br />
könnte. Das hat bei denen so viel bewegt, dass sich alle<br />
Beteiligten mittlerweile in die Augen schauen können, sie<br />
grüßen sich freundlich, also da ist einfach Beziehungsarbeit<br />
passiert, weil die Schwellen abgebaut wurden. Das<br />
kann man fördern und das ist auch Stadtteilarbeit, nämlich<br />
den Kiez zu entanonymisieren.<br />
Stephan Preschel: Im Rahmen dieses Prozesses hatten<br />
wir außer diesem Film noch ein paar andere Ideen. Es<br />
gab zum Beispiel im Rahmen des runden Tisches die<br />
Idee eines Subotniks. Ein Subotnik ist ein freiwilliger<br />
<strong>Arbeit</strong>seinsatz. Mit den Kindern, den Jugendlichen und<br />
den verschiedenen Institutionen gemeinsam sollten an<br />
einem bestimmten Tag auf diesem Areal der Müll und die<br />
Schmierereien beseitigt werden. Das wurde auch erfolgreich<br />
durchgeführt.<br />
Stephan Preschel: Das Tolle war, dass die Rentner der<br />
Senioreneinrichtung da <strong>für</strong> die Jugendlichen gegrillt und<br />
Kuchen gebacken haben. Und nach diesem <strong>Arbeit</strong>seinsatz<br />
haben sie alle gemeinsam gegessen und miteinander<br />
geredet. Das war eigentlich das Schönste an diesem<br />
Tag, weil er das gebracht hat, was wir wollten, nämlich<br />
Kommunikation.<br />
Elke Ostwaldt: Das waren nicht Unmengen von Menschen,<br />
es waren auch nicht wahnsinnig viele Jugendliche,<br />
aber es war eine kleine Sache, die uns alle sehr<br />
zusammengeführt hat. Stand der Dinge heute: Dieser<br />
Platz wird im Moment von Jugendlichen überhaupt nicht<br />
genutzt, die Eltern und Kinder haben den Spielplatz wieder<br />
erobert, auf dem Sportplatz wird ganz normal Fußball<br />
gespielt. Das geht in der Regel ziemlich gut, weil da<br />
die albanischen Väter auch mal <strong>für</strong> ein bisschen Ruhe<br />
sorgen. Und der Schulhof fehlt den Kindern, das muss<br />
man sagen. Die VHS war von dieser Zusammenarbeit so<br />
begeistert, dass sie eine Kollegin von uns, die in einem<br />
Schülerclub arbeitet, darum gebeten haben, zu kooperieren.<br />
Also insgesamt ist dieser Konfl ikt ganz gut ausgegangen.<br />
Aber im letzten Jahr um diese Zeit war es dort<br />
sehr heiß, und normalerweise ist diese Gegend ziemlich<br />
konfl iktbelastet.<br />
TN: Wo sind die Jugendlichen jetzt? Sie haben berichtet,<br />
wo alle anderen sind, aber die Jugendlichen fehlen.<br />
Elke Ostwaldt: Bei den Jugendlichen ist es ganz unterschiedlich.<br />
Es heißt ja immer: Integriert sie – im Notfall<br />
stellen wir euch auch einen Bus zur Verfügung, damit sie<br />
bleiben. Das hat natürlich gar nicht funktioniert. Aber es<br />
gibt andere Plätze, insofern ist das nur eine Verlagerung.<br />
Wenn die Jugendlichen sich jetzt nicht mehr auf dem<br />
„Harry Potter“ treffen und chillen, dann gehen sie in die<br />
Wuhlheide. In der Wuhlheide gibt es im Moment Treffen<br />
von über 150 Jugendlichen. Das sind oft Verlagerungen.<br />
Einige gehen dann in Jugendclubs, andere machen zum<br />
Beispiel dann Hip Hop-Musik, einige machen Graffi ti, also<br />
das ist ganz unterschiedlich. Und man kann jetzt nicht<br />
sagen, dass der ganze <strong>sozial</strong>e Raum befriedet ist, es geht<br />
im Moment einfach nur um diesen Platz, um den herum<br />
eine Entspannung erreicht wurde.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 31
32<br />
Workshop Jugend - Herausforderungen<br />
Stephan Preschel: Die Jugendlichen, die Multiplikatoren,<br />
die in diesem Hip Hop-Workshop waren, verbringen jetzt<br />
mehr Zeit auf diesem Sportplatz und spielen dort Fußball.<br />
Dadurch ist die Situation entstanden, dass sich die Kinder<br />
und Jugendlichen im Rahmen des Fußballs selbst organisieren,<br />
und zwar fast schon regelmäßig in den letzten<br />
Wochen. Sie treffen sich Samstagnachmittag und spielen<br />
kleine Turniere, sodass sie eine gewisse Sensibilität da<strong>für</strong><br />
haben, dass sie auch etwas dazu beitragen können, dass<br />
sie in ihrem Kiez glücklich sind.<br />
TN: Meine Frage geht an Ralf Jonas aus Bremen. Worin<br />
sehen Sie die Vorteile, dass unterschiedliche Altersstufen<br />
in einem Haus sind? Was bringt das den Einzelnen?<br />
Ralf Jonas: Ein Vorteil ist das gegenseitige Lernen voneinander,<br />
vor allen Dingen auch das Kennenlernen. Ein<br />
durchschnittlicher Senior kennt in der Regel kaum einen<br />
Jugendlichen richtig und urteilt nur über Äußerlichkeiten,<br />
was häufi g in Vorurteilen endet. Solche Vorurteile kann<br />
man teilweise – bestimmt nicht komplett – ein bisschen<br />
durchbrechen, auch gegenseitige Vorurteile. Das hängt<br />
nur ein Stück davon ab, was man <strong>für</strong> Senioren und<br />
Jugendliche hat. Wenn man zum Beispiel einen tollen<br />
Opa hat, der früher Jazzmusiker war und mit den Kindern<br />
über Musik ins Gespräch kommt, den Hip Hoppern<br />
erzählt, dass es teilweise ganz ähnliche Rhythmen sind,<br />
dann kommen natürlich auch Gespräche zustande.<br />
Ich würde das gar nicht so auf die Einrichtung beziehen.<br />
Eine Einrichtung kann auch ohne Jugendliche existieren.<br />
Oder nur mit einer Gruppe kann es toll und gut funktionieren,<br />
aber ein Bürgerhaus oder ein Zentrum kann eben<br />
auch ein Ort sein, wo beginnende Konfl ikte schon im Vorfeld<br />
gelöst werden und sich Prozesse entwickeln, in denen<br />
sich die Zustände verändern. Damit rettet man nicht die<br />
Welt, aber man kann in bestimmten kleinen Punkten positive<br />
Dinge erzielen.<br />
Stephan Preschel: Es gibt so etwas wie Domino-Effekte,<br />
sowohl im Negativen wie im Positiven. Die eine alte Frau,<br />
die von jungen Menschen begeistert ist, erzählt das ihrer<br />
Freundin, usw., so kommuniziert sich etwas Positives und<br />
auch etwas Schlechtes. Deswegen fi nde ich auch gerade<br />
diese kleinen Aktionen wichtig, wie will man sonst anfangen?<br />
Das Ganze kann man vielleicht nicht fassen, aber<br />
zwei Leute kann man konkret zusammenführen.<br />
TN: Oberschöneweide gilt ja nicht unbedingt als angenehmer<br />
Bezirk. Ihr seid schon länger vor Ort. Was <strong>für</strong> eine<br />
Entwicklung nimmt der Stadtteil im Moment?<br />
Stephan Preschel: Der Stadtteil hat natürlich seine<br />
Bereiche, wo er stark belastet ist. Das hat meine Kollegin<br />
vorhin schon geschildert, dass im Bezirk aus den ehemaligen<br />
<strong>Arbeit</strong>erstrukturen nun Problemlagen <strong>für</strong> das Wohnen<br />
und Leben geworden sind. Auf der anderen Seite kann<br />
man in den letzten drei Jahren beobachten, wie Häuser<br />
saniert werden, sich das Straßenbild an bestimmten Stellen<br />
im Stadtteil verändert. Dazu kommt, dass Oberschöneweide<br />
früher Schöneweide hieß. Das war eigentlich der<br />
Verbund von Oberschöneweide und Niederschöneweide.<br />
Dieser Verbund bestand bis zum letzten Jahr nicht mehr,<br />
weil die Fußgängerbrücke, die diese beiden Stadtteile verbunden<br />
hatte, vor 1945 weggebombt worden war. Diese<br />
Brücke haben sie jetzt wieder gebaut, insofern wachsen<br />
diese beiden Stadtteile auch wieder fühlbar zusammen.<br />
Es kommt jedenfalls Bewegung in den Stadtteil.<br />
TN: Die alten Industriebrachen, die bei dem Film noch zur<br />
Verfügung standen, werden doch auch immer weniger,<br />
oder?<br />
Stephan Preschel: Die stehen leer.<br />
Elke Ostwaldt: Teilweise stehen sie leer, teilweise werden<br />
sie genutzt. Vieles wird <strong>für</strong> Ateliers von Künstlern genutzt,<br />
also es wird schon ein bisschen bunter und ist nicht mehr<br />
so öde. Aber es ist total voneinander separiert, es gibt<br />
gut situierte Familien, es gibt Familien, die sich sehr einbringen,<br />
aber es gibt genauso bestimmte Straßen, die<br />
sind so hoch belastet, da leben viele Familien und Kinder<br />
mit gravierenden Problemen. Die Schwierigkeit ist, dass<br />
sich nichts mischt. Die einen leben so, die anderen leben<br />
anders, aber es gibt keine Brücke.
TN: Unser Schwerpunkt ist die <strong>Arbeit</strong> mit Kindern und<br />
Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen und Senioren.<br />
Dass es zwischen allen Berührungspunkte geben soll, ist<br />
offensichtlich wünschenswert, weil dadurch ganz viele<br />
Vorurteile abgebaut werden. Weil Erfahrungen weitergegeben<br />
werden können, weil die Leute voneinander lernen<br />
und eben auch Beziehungen außerhalb der Familie entstehen<br />
können, sodass man sich auch manchmal unterstützen<br />
kann oder einfach nur grüßt. Das ist die präventive<br />
<strong>Arbeit</strong>.<br />
Wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht wie in<br />
Bremen. Neben diesen Sachen, die nebeneinander<br />
hergehen, da kann schon viel passieren, indem man<br />
die Leute miteinander konfrontiert oder miteinander<br />
ins Gespräch bringt. Aber die größte Herausforderung<br />
ist das Umsetzen der generationenübergreifenden Projekte.<br />
Das klang eben auch schon so an, in der persönlichen<br />
und individuellen Begegnung zwischen der<br />
Seniorengruppe und den Jugendlichen passiert ja am<br />
allermeisten. Ich erlebe diese gewöhnlichen Begegnungen<br />
als wahnsinnig wertvolle <strong>Arbeit</strong>. Wir haben<br />
mehrere Zeitzeugenprojekte, auch Projekte zum Thema<br />
Mauerfall, wo Jugendliche mit Erwachsenen und Älteren<br />
ins Gespräch kommen und deren persönliche Erfahrungen<br />
mitkriegen. Darüber passiert ganz viel. Das ist<br />
aber wahnsinnig aufwändig. Ich fi nde, das ist noch ein<br />
spannendes Thema: Welche Wege zu einander gibt es?<br />
Wir können Berührungspunkte nur an den Stellen herstellen,<br />
wo wir Ressourcen bzw. eine Projektförderung<br />
haben. Das geht bei uns im Haus immer nur dann, wenn<br />
wir jemanden haben, der sich dahinter klemmt und<br />
dieses Projekt betreut. Zum Beispiel die Theatergruppe<br />
mit Jugendlichen erlebe ich als eine große Herausforderung,<br />
die Leute zu motivieren, weil sie sich nicht von<br />
alleine treffen. Die Jugendlichen wären mit der Seniorengruppe<br />
nicht von alleine ins Gespräch gekommen,<br />
sondern dazu gehört ungeheuer viel Motivationsarbeit,<br />
man muss passende Themen fi nden, Konzepte fi nden,<br />
beide oder mehrere Zielgruppen begeistern, man muss<br />
das auch am Leben erhalten, ganz viel vermitteln. Wie<br />
kann man das befördern?<br />
Herbert Scherer: Eine Frage würde ich gerne in die Runde<br />
geben: Muss das denn sein? Was wir hier kennen gelernt<br />
haben, ist ja ein in Gang gebrachter Kommunikationsprozess,<br />
aber nicht unbedingt eine Zwangsvereinigung im<br />
Rahmen von Projekten.<br />
Ralf Jonas: In Bremen-Gröpelingen war ein Punkt die<br />
Auseinandersetzung mit dem Amt. Jugendliche, Mädchen<br />
wie Jungen, die eigentlich ins Heim sollten, wurden<br />
von uns Mitarbeitern gegenüber den zuständigen<br />
Politikern argumentativ unterstützt, indem wir sagten:<br />
Wir wollen <strong>für</strong> unsere <strong>Arbeit</strong> mit den Jugendlichen mehr<br />
Geld haben, dann könnt ihr euch die Heime ersparen.<br />
Das ist eigentlich der Punkt. Als das Geld weniger<br />
wurde, haben wir mit allen Leuten aus dem Haus eine<br />
Demonstration auf einer Kreuzung vorbereitet. Darüber<br />
gibt es ein Video. Drittens ist aktuell, das läuft zum 11.<br />
oder 12. Mal, im ganzen Bezirk Gröpelingen ein großes<br />
Stadtteilfest. Alle Gruppen, Kindergärten, Schulen kommen<br />
und bereiten das vor, inzwischen sind das 1.000<br />
Leute.<br />
Herbert Scherer: Hier wird immer von Senioren und Kindern<br />
und Jugendlichen geredet, aber irgendwie fehlt da<br />
was zwischen den Generationen.<br />
TN: So ähnlich wäre meine Frage auch. Jetzt haben wir<br />
viel über den generationenübergreifenden Ansatz gespro-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 33
34<br />
Workshop Jugend - Herausforderungen<br />
chen. Ich komme selber aus der Jugendarbeit, gewinne<br />
dem natürlich was ab. Aber das Thema war – Mehrgenerationenhaus<br />
ja oder nein? Mit oder ohne Jugend? Ich kann<br />
mir vorstellen, dass es doch erheblich anstrengender ist,<br />
verschiedene Generationen in einem Haus zu haben und<br />
da<strong>für</strong> zu sorgen, dass sie sich da alle mit einander wohl<br />
fühlen. Warum macht man das denn? Ich kann mir vorstellen,<br />
dass es hier andere Sichtweisen gibt, die sagen,<br />
nee, das ist nicht zwangsläufi g. Ich würde gerne noch die<br />
andere Position kennen lernen.<br />
Herbert Scherer: Timm, du könntest die andere Position<br />
einnehmen, aber fühlst dich vielleicht auch provoziert?<br />
Timm Lehmann: Das schon, ja, aber erst mal eine Nachfrage.<br />
Du redest von Jugendlichen, die eigentlich ins Heim<br />
müssten oder sollten. Das ist ein ganz anderer Ansatz<br />
als offene Jugendarbeit und noch mal was ganz anderes<br />
als geschlossene Angebote, die kostenpfl ichtig sind. In<br />
meiner Wahrnehmung kriege ich da etwas nicht zusammen.<br />
Ich glaube, ein Zirkusprojekt oder Kulturarbeit <strong>für</strong><br />
Kinder und solche Gruppenangebote <strong>für</strong> Jugendliche, die<br />
in Notsituationen sind oder ins Heim müssen, das sind<br />
zwei Welten.<br />
Ralf Jonas: Durch diese Zirkusarbeit ist etwas bewirkt worden.<br />
Da sind Kinder und Jugendliche dabei gewesen, bei<br />
denen schon sechs Brüder im Knast saßen usw., die dann<br />
über die Zirkusarbeit, verbunden mit ganz viel Wochenenden,<br />
ganz vielen Ferienfahrten und auch ganz viel<br />
Freizeitgestaltung und Schularbeitshilfe, was geschafft<br />
haben. Das ist eine Generation gewesen, die täglich im<br />
Bürgerhaus war. Die sind zwar als 30-Jährige immer noch<br />
im Haus, aber es hat danach eine Veränderung gegeben,<br />
dass wir mehr auf einzelne Gruppen umgestiegen sind.<br />
Das war eine veränderte Bedarfslage. Wir orientieren<br />
uns an den Bedarfslagen des Stadtteils. Es gab – ähnlich<br />
wie bei euch – diese hardcore Jugendlichentruppe,<br />
die berüchtigt war wegen Schlägereien. Inzwischen ist es<br />
so, dass ganz viele normale Kinder in das Bürgerhaus<br />
kommen.<br />
TN: Ich spiele mal ein bisschen den Anwalt der Kinder<br />
und Jugendlichen. Dieses verkopfte <strong>sozial</strong>arbeiterische<br />
Getue der generationsübergreifenden <strong>Arbeit</strong>, die ganz<br />
wichtig ist <strong>für</strong> die Kinder und Jugendlichen, die geht<br />
einem ziemlich auf den Senkel. Aus meiner Perspektive,<br />
wie ich meine Sozialisation refl ektiere, wenn ich da von<br />
Sozialarbeitern immer bespielt worden wäre, ich hätte<br />
von Senioren immer vorgelesen bekommen und hätte<br />
mich mit denen austauschen müssen, also da würde ich<br />
heute gar nicht hier sitzen. Die Lebenswelten von Kindern<br />
und Jugendlichen organisieren sich ja im Wesentlichen in<br />
ihrer Gruppe, was in dem Film auch ganz gut rüberkam.<br />
Diese Industriebrachen sind <strong>für</strong> mich ein Symbol <strong>für</strong> Freiräume.<br />
Freiraum insofern, dass nicht immer Erwachsene<br />
und Pädagogen da sind und sagen, ihr müsst das so oder<br />
so machen. Das fi nde ich ein sehr starkes Bild.<br />
Sind wir nicht etwas zu schnell bei diesem generationsübergreifenden<br />
Thema?<br />
Georg Zinner: Natürlich kann man keine Zwangsbeglückung<br />
machen, keine Zwangsintegration. Aber man kann<br />
Häuser schaffen, in denen verschiedene Gruppen, egal,<br />
ob jung, alt, Deutsche, Ausländer, behindert, nicht behindert,<br />
Platz haben, wo sich alle aus der Nachbarschaft treffen.<br />
Früher hielt man eigene Orte <strong>für</strong> jede <strong>sozial</strong>e Gruppe<br />
<strong>für</strong> notwendig. Aber der Ort muss ihnen nicht dauerhaft<br />
gehören, es kann auch sein, dass er ihnen nur <strong>für</strong> drei<br />
Stunden gehört, danach gehört er jemand anders. Es<br />
geht gar nicht darum, ob das Haus nur <strong>für</strong> Jugendliche<br />
ist. Es gab schon eine Kritik der Nachbarschaftszentren<br />
in den 70er und 80er Jahren an den politisch, fachlich<br />
und gesellschaftlich gewollten getrennten Institutionen,<br />
die in dieser Zeit großfl ächig aber eben zielgruppenorientiert<br />
geschaffen wurden: den Seniorentreffpunkten,<br />
den Kindertagesstätten, den Jugendzentren, den Einrichtungen<br />
<strong>für</strong> die verschiedenen Gruppen Behinderter, usw.<br />
Das war alles schön separiert und fachlich spezialisiert.<br />
Heute sollte ein Haus eher <strong>für</strong> alle geöffnet sein, <strong>für</strong> die<br />
gesamte Nachbarschaft.<br />
In den Jugendzentren, die wir übernommen haben, sind<br />
heute, ohne dass irgendwelche Jugendlichen dadurch<br />
Nachteile erfahren haben, mehr Kinder und Jugendliche
als je zuvor - aber eben auch Erwachsene, auch Selbsthilfegruppen,<br />
auch Senioren, auch Mütter mit Kindern. Das<br />
Haus hat im Stadtteil an Vertrauenswürdigkeit gewonnen,<br />
damit auch einen Kredit bei Eltern, die ihre Kinder selbstverständlich<br />
in dieses Haus gehen lassen, während wir<br />
von vielen Eltern bei den früheren Jugendzentren gehört<br />
haben: da schicke ich meine Tochter nicht hin, die darf da<br />
nicht hingehen, das ist mir zu undurchschaubar.<br />
Diese Häuser können offen stehen – das ist meine Vorstellung.<br />
Wenn Senioren spazieren gehen, warum sollen<br />
die sich nicht in der benachbarten Kindertagesstätte im<br />
Garten auf die Bank setzen und Kaffee trinken und vielleicht<br />
mitgebrachten Kuchen essen, ganz selbstverständlich?<br />
Eine Kindertagesstätte kann auch Begegnungsort<br />
<strong>für</strong> Senioren oder Familien sein. Die Kinder verlassen die<br />
Schulen und kehren nie wieder zurück. Was ist das <strong>für</strong><br />
ein komischer Zustand? Warum können Schulen nicht<br />
auch Orte sein, wo sich die Nachbarschaft dauerhaft<br />
aufhält? Es wäre schön, wenn die Schulen auch von der<br />
Nachbarschaft besucht werden könnten. Dabei ist auch<br />
der Aspekt von Bedeutung, dass die Nachbarschaft wieder<br />
Verantwortung <strong>für</strong> die Infrastruktur übernimmt, also<br />
eben auch <strong>für</strong> ihre Schule. Jetzt wird immer noch alles<br />
delegiert, an den Staat, an die zuständige Verwaltung. Wir<br />
wissen: Irgend jemand ist zuständig, aber wissen auch,<br />
dass sie diese Zuständigkeiten nicht mehr tragen und,<br />
dass sich mehr Leute denn je <strong>für</strong> z. B ihre Schule engagieren<br />
können und wollen.<br />
Herbert Scherer: Du hast von einer gemeinsamen Nutzung<br />
gesprochen, aber nicht davon, alles gemeinsam<br />
zu machen und durcheinander zu mischen. Das ist vielleicht<br />
ein Anspruch, den die Mehrgenerationenhäuser<br />
spüren, dass sie ständig so etwas machen müssen, was<br />
man zumindest auf dem Foto als aktuelle Begegnung<br />
ansieht.<br />
Renate Wilkening: Stichwort: Verantwortung übernehmen<br />
und Orte. Ich will drei Beispiele nennen, eins, bei<br />
dem die Mehrgenerationenarbeit schief gegangen ist,<br />
einmal ist es fast schief gegangen und einmal klappte es.<br />
Ein wichtiger Punkt <strong>für</strong> mich sind Orte, die <strong>für</strong> alle da sind,<br />
und wo die, die sie nutzen, auch die Verantwortung übernehmen,<br />
egal, wie alt sie sind und woher sie kommen.<br />
Wir haben einen ehemaligen Kinderclub vom öffentlichen<br />
Dienst übernommen. Er war ausschließlich <strong>für</strong> Kinder von<br />
6 bis 14 konzipiert. Wir haben ein Konzept <strong>für</strong> Mehrgenerationenarbeit<br />
abgeliefert, wir öffnen den Club <strong>für</strong> alle,<br />
Familien, Nachbarn, wunderbar, das wird ganz toll. Alle<br />
waren begeistert und wir haben uns frisch und fröhlich an<br />
die <strong>Arbeit</strong> gemacht. Die Konfl ikte der Generationen, die<br />
auftauchten, waren nicht zwischen ganz Alten und ganz<br />
Jungen, das klappte wunderbar. Es kommen Senioren,<br />
die haben ihren Computerclub und die 12-jährigen Jungs<br />
machen mit ihnen nachmittags Kurse, wo sie den Alten<br />
etwas am PC zeigen.<br />
Der Konfl ikt entbrannte zwischen Kindern und Jugendlichen.<br />
Freitags hatten wir den Club bis 18 Uhr <strong>für</strong> Kinder<br />
geöffnet, danach sollten die Jugendlichen kommen. Wir<br />
hatten auch die tolle Idee, dass die Jugendlichen früher<br />
rein könnten, sie sollten sich aber um die Kinder kümmern<br />
und mit ihnen Hausaufgaben und all die anderen schönen<br />
Dinge machen. Das ist derartig in die Hose gegangen, weil<br />
die Jugendlichen keine Lust hatten, was mit den Kindern<br />
zu machen, sie hatten völlig andere Bedürfnisse. Sie wollten<br />
sich sehr gerne treffen und ihre Sachen machen, sie<br />
wollten in Ruhe gelassen werden. Sie haben sich leider<br />
nicht an die gemeinsam erarbeiteten Regeln gehalten,<br />
dass zum Beispiel um 22 Uhr die Fenster zu sein müssen.<br />
Wir hatten ständig Polizeieinsätze, dann kamen die Nachbarn,<br />
wir haben zusammen am runden Tisch gesessen<br />
mit allen Beteiligten. Alle haben gesagt: Wir schwören,<br />
es wird besser. Aber zwei Wochen später lief die gleiche<br />
Geschichte. Diesen Konfl ikt zwischen diesen Kindern und<br />
Jugendlichen haben wir nicht lösen können. Das Haus ist<br />
offen, der Platz ist zu klein. Das ist ein ganz wichtiger<br />
Punkt, dass der Platz <strong>für</strong> alle Bedürfnisse zu klein ist. Es<br />
geht einfach nicht. Er liegt in einer voll besiedelten Ecke,<br />
wo die Leute arbeiten und sagen, abends will ich meine<br />
Ruhe haben. Mein Wunsch und die Idee wäre natürlich<br />
weiter die Rücksichtnahme zu transportieren und weiter<br />
daran zu arbeiten, aber an diesem Punkt ging es nicht.<br />
Ein gutes Beispiel: Senioren und Familien, die den Club<br />
am Wochenende <strong>für</strong> sich nutzen, das sind die Familien,<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 35
36<br />
Workshop Jugend - Herausforderungen<br />
deren Kinder dort hingehen, das läuft gut. Das andere<br />
geht nicht. Die Jugendlichen sitzen jetzt in dem Jugendkeller,<br />
wo ausschließlich Jugendliche sind, in einer Brennpunktsiedlung,<br />
fühlen sich da sauwohl, machen ihre<br />
Sachen untereinander, oben drüber – etwas separiert – in<br />
einem großen Haus sitzen die Erwachsenen und machen<br />
ihre Sachen.<br />
Wo es fast schief gegangen ist, das ist mit Outreach in<br />
Lichtenrade. Wir teilen uns einen Nachbarschaftstreff-<br />
punkt. Wir haben von der Evangelischen Kirche ein altes<br />
Waschhaus gekriegt, das wir mit Outreach zusammen<br />
renoviert und alles schön gemacht haben. Wir haben die<br />
Vereinbarung, Outreach und deren Jugendliche nutzen<br />
punktuell den Club, abends oder nachmittags, wenn sie<br />
ihn brauchen und wir nutzen ihn am Morgen. Die Differenzen<br />
entstanden wieder nicht zwischen den Alten und<br />
den Jugendlichen, sondern zwischen den Jugendlichen<br />
und den jungen erwachsenen Müttern, die mit ihrer Pekip-<br />
Gruppe am Morgen kommen und den Sauhaufen vorfi nden,<br />
den Outreach hinterlassen hat. Der Konfl ikt ist gelöst<br />
worden. Die Beteiligten haben sich an einen Tisch gesetzt,<br />
die Rücksichtnahme klappt, weil der Kollege von Outreach<br />
bereit war, eine Putzfrau zu engagieren. Die Jugendlichen<br />
wollten nicht selber putzen, aber das war mir egal, Hauptsache<br />
Outreach putzt. Also ist jetzt der Raum morgens sauber<br />
und die Pekip-Mütter sagen: okay, es ist sauber, dann<br />
haben wir nichts gegen sie. Sie sind freundlich miteinan-<br />
der, das ist klar, aber den Dreck von Outreach wollen diese<br />
Mütter nicht haben, was ich auch <strong>für</strong> verständlich halte.<br />
Dort sind die Räume größer und können gut gemeinsam<br />
genutzt werden. Aber der Punkt ist die Rücksichtnahme.<br />
Das hätte ziemlich eskalieren können, aber man muss<br />
einen Weg fi nden, auch <strong>für</strong> kleine Konfl ikte. Eine Lösung<br />
fi nden, mit der alle zufrieden sind.<br />
Ganz gut gegangen ist es in unserer Kita Luckeweg. Wir<br />
haben ein 2.500 qm großes Grundstück mit Garten und<br />
wir hatten eine Jugendbande, die Kinder waren 12, 13,<br />
15, die da regelmäßig alles zerstört haben. Wir haben sie<br />
einmal erwischt und gesagt: entweder Polizei oder aufräumen,<br />
da war natürlich die Entscheidung <strong>für</strong> das Aufräumen.<br />
Wir haben mit denen folgenden Deal: sie dürfen den<br />
Garten ab 18 Uhr <strong>für</strong> sich nutzen, auch am Wochenende,<br />
wenn sie die Regeln einhalten. Sie achten selber auf<br />
Lärmschutz, weil darüber Menschen wohnen, sie hinterlassen<br />
den Garten sauber, und sie kommen gelegentlich<br />
zu den Festen in die Kita und helfen uns. Da<strong>für</strong> kriegen sie<br />
nicht nur den Garten, es gibt auch einen frei zugänglichen<br />
Raum, da können sie sich ohne irgendeinen Erwachsenen<br />
treffen. Das ist genau das, was du auch schon sagtest:<br />
man hat als Jugendlicher keine Lust, dass immer<br />
ein Sozialpädagoge anwesend ist. Was wir haben, das ist<br />
ein Hausmeister. Mit dem verstehen die sich gut, der ist<br />
sozusagen <strong>für</strong> diese Jugendlichen Ansprechpartner und<br />
Autorität. Das geht seit zwei Jahren gut.<br />
Miriam Ehbets: Ich komme aus dem Rabenhaus in Köpenick.<br />
Wir sind eine ganz kleine Einrichtung und haben über<br />
die Jahre immer versucht, auch generationsübergreifende<br />
Projekte bei uns zu machen. Meine Erfahrung ist, wenn<br />
man eine Kraft hat, die das mit unterstützt, dann geht<br />
das auch, aber es ist sehr anstrengend. In dem Moment,<br />
wo eine solche Kraft nicht da ist, passieren manchmal<br />
Begegnungen von alleine. Das sind dann die Sachen, die<br />
halten und bleiben. Ich halte viel mehr von ganz kurzen,<br />
temporären Gemeinsamkeiten, über die man sich kurz<br />
kennen lernt und Ängste abbaut. Dann entwickelt sich<br />
etwas. Alles, was organisiert war mit irgendwelchen Programmen<br />
endete in dem Moment, wo die Programmbegleiter<br />
weg waren.
Ich möchte auch noch mal <strong>für</strong> die Jugendlichen sprechen.<br />
Wenn man ein ganz großes Haus und eine große Anlage<br />
hat, dann kann man auch Jugendliche mit einer offenen<br />
Jugendarbeit integrieren. Aber die müssen – bitte schön<br />
– wirklich Räume <strong>für</strong> sich selbst haben, und nicht <strong>für</strong> drei<br />
Stunden oder so, sondern das müssen ihre Räume sein.<br />
Wenn man das nicht hat, dann ist es ganz schwer, die<br />
zwischen der Mütter- und Seniorenarbeit zu integrieren.<br />
Ich halte das <strong>für</strong> Blödsinn.<br />
Hella Pergande: Ich arbeite <strong>für</strong> Outreach mit Kindern,<br />
Jugendlichen und Eltern in Schöneberg. Ich denke, man darf<br />
nichts verallgemeinern. Es gibt Familien mit 30 Enkelkindern<br />
und der einzige Opa kann nicht lesen. Für die ist es toll, wenn<br />
jemand vorliest. Das ist in jedem Stadtteil anders, auch die<br />
Gruppen melden ihre Bedürfnisse anders. Ich glaube, dass<br />
es immer wichtig ist, dass es Teams gibt, die genau hingucken,<br />
Experimente wagen und Verhandlungen machen.<br />
Wenn es nicht klappt, geht man wieder einen Schritt zurück,<br />
macht ein neues Experiment – das ist der Weg und nicht ein<br />
standardisiertes generationsübergreifendes Programm.<br />
Herbert Scherer: Ich glaube, es gibt niemanden, der<br />
generationsübergreifende <strong>Arbeit</strong> kategorisch ablehnt und<br />
nicht will. Aber es gibt ganz viele, die damit Schwierigkeiten<br />
haben. Deswegen haben wir über einige Lösungswege<br />
von Schwierigkeiten was gehört. Da ist, glaube ich,<br />
die Mentalität von den Nachbarschaftshaus-Leuten und<br />
die Mentalität von den Outreach-Leuten durchaus kompatibel,<br />
weil sie mit einer ähnlichen Grundhaltung rangehen,<br />
nämlich ausgehend von dem, was die Menschen wollen<br />
und nicht so sehr, was eine Ordnungsvorstellung will. Aber<br />
es gibt eben sehr unterschiedliche Erfahrungen, Renate<br />
hat davon einige dargestellt.<br />
TN: Ich habe gerade beobachtet, welcher Drive plötzlich<br />
entstand, als das Thema generationsübergreifend richtig<br />
aufkam. Ich fi nde schon, dass es noch ein ziemlich ambivalentes<br />
Thema ist. Ganz kurz zur Ehrenrettung der Mehrgenerationenhäuser:<br />
Auf gar keinen Fall soll alles immer<br />
generationsübergreifend sein, und schon gar nicht mit<br />
Zwang, also das will keiner.<br />
TN: Ich glaube, es sind alle soweit, dass sie in der Praxis<br />
das tun wollen, was den Zielgruppen nutzt. Da würde ich<br />
schon sagen: so klein diese Momente der Verständigung<br />
auch sein mögen, <strong>für</strong> den Einzelnen sind das manchmal<br />
wertvolle Momente, wenn man sich auf der persönlichen<br />
Ebene begegnet. Das ist wichtig, dass wir dazu Möglichkeiten<br />
schaffen. Mit Kindern geht das relativ leicht. Mit<br />
Jugendlichen ist es schwieriger. Man muss gucken, wo<br />
man steht, welche Zielgruppen man hat, was brauchen<br />
sie? Da gibt es schon Kinder, die nur auf die erwachsenen<br />
Bezugspersonen sehen, bei manchen gibt es keine Großeltern,<br />
manche Kinder freuen sich, wenn einfach mal ein<br />
Mann da ist. In einem unserer Projekte sind auch Männer<br />
mit den Kindern dabei, die kleben regelrecht an denen,<br />
weil das in ihrem persönlichen Umfeld fehlt.<br />
Herbert Scherer: Bevor wir jetzt allzu schnell die Jugendlichen<br />
aus dem generationsübergreifenden Kontext ausklammern,<br />
nämlich als die Gruppe, die das gar nicht will,<br />
es sind zwei Menschen hier, die genau an der Stelle mit<br />
Jugendlichen arbeiten, auch ganz zentral in einem generationsübergreifenden<br />
Kontext. Es gibt unter den Mehrgenerationenhäusern<br />
in Deutschland nur drei, die aus<br />
Jugendzentren heraus den Mehrgenerationengedanken<br />
entwickelt haben oder entwickeln mussten. Eins davon<br />
ist in Zehlendorf, deshalb ist Timm Lehmann ein wichtiger<br />
Zeuge da<strong>für</strong>, ob das funktionieren kann. Deshalb hatte<br />
ich auch Ralf Jonas eingeladen, weil es bei ihm gerade<br />
um Jugendliche geht. Das heißt, auch bei Jugendlichen<br />
in einem Mehrgenerationenhaus muss irgendwas funktionieren<br />
können.<br />
Timm Lehmann: Ich glaube, dass es tatsächlich wenige<br />
Nachbarschaftshäuser gibt, in denen offene Jugendarbeit<br />
stattfi ndet. Da es davon nur wenige gibt, glaube ich, dass<br />
es ein Thema <strong>für</strong> uns ist. Ich empfi nde es jedenfalls als<br />
Auftrag, dass die Begegnung mit Jugendlichen in unserer<br />
Gesellschaft irgendwo stattfi ndet. Die wird auch eingefordert.<br />
Das, was ich mache, würde ich nicht als allgemeingültiges<br />
Modell sehen. Aber ich glaube, ich muss einen Ort<br />
organisieren, wo Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene,<br />
Erwachsene und Senioren zusammenkommen und einen<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 37
38<br />
Workshop Jugend - Herausforderungen<br />
Prozess, der in der Gesellschaft immer weniger selbstverständlich<br />
wird, als Institution anbieten und organisieren.<br />
Mein Projekt ist eben nicht – wie vorhin vorgeschlagen<br />
– ein kurzes Projekt, sondern es besteht darin, jeden Tag<br />
den Alltag zu organisieren und die Begegnungen möglich<br />
zu machen.<br />
Ich glaube, es fi ndet ein gesellschaftlicher Wandel<br />
statt. Ganz viele von unseren Jugendlichen suchen den<br />
direkten Kontakt im Zweiergespräch, im Dreiergespräch<br />
zu den Älteren, zu den Erwachsenen, also in einer relativ<br />
intimen Begegnung, weil die bei ihnen in der Familie nicht<br />
mehr stattfi ndet. Das Projekt ist dann z.B., dass ich eine<br />
Seniorin habe, die am Tresen im offenen Treff steht und<br />
mit den Jugendlichen über ihren Alltag redet.<br />
Und das muss aus beiden Richtungen geboten werden,<br />
weil wir den demografi schen Wandel haben, ein großer<br />
Teil der Bevölkerung ist über 60, hat aber wahnsinnige<br />
Kapazitäten und Ressourcen. Und die will ich nutzen<br />
– und die Menschen wollen die auch nutzen. Deshalb<br />
organisiere ich das, was die Menschen wollen, wenn ich<br />
die Begegnungen organisiere.<br />
Ralf Jonas: Ich fi nde diese Begegnungen wichtig, aber<br />
noch wichtiger ist, dass man nach gemeinsamen Interessenlagen<br />
guckt, das fi nde ich entscheidend. Wo kann<br />
man Interessen von verschiedenen Generationen zusammenbringen?<br />
Nach meiner Erfahrung geht das am bes-<br />
ten über <strong>kulturelle</strong> Aktivitäten, über konkrete Sachen wie<br />
Theaterspiel, Zirkus, Musik. Die meisten Leute verbringen<br />
ja ihre Freizeit in den Einrichtungen, das darf man nicht<br />
vergessen, sie wollen sich ja nicht therapieren lassen.<br />
Über gemeinsame Interessen kriegt man auch Begegnung<br />
hin.<br />
Was vollkommen klar ist, wir können nicht <strong>für</strong> die gesamte<br />
Bevölkerung solche Häuser anbieten. Natürlich wünschen<br />
wir uns große und freie Plätze, wo Jugendliche ihren Parcours<br />
machen können, ohne dass ihnen ständig jemand<br />
auf dem Schlips steht, aber die Städte werden immer<br />
enger. In Berlin mag das vielleicht noch anders sein, aber<br />
Bremen ist unglaublich eng, da gibt es überhaupt keinen<br />
Platz mehr <strong>für</strong> Jugendliche. Den muss es aber natürlich<br />
auch geben, das fi nde ich genauso wichtig wie ein Mehrgenerationenhaus.<br />
Damit auch weiterhin selbst organisierte<br />
Geschichten möglich bleiben. Alles andere wäre ja<br />
furchtbar, wenn wirklich alles pädagogisiert wäre.<br />
Torsten Wischnewski: Wir vom Pfefferwerk haben in<br />
einem Nachbarschaftshaus, das dann später Stadtteilzentrum<br />
geworden ist, sechs Jahre lang offene Jugendarbeit<br />
betrieben, bis die Förderung durch das Bezirksamt<br />
eingestellt wurde. Das war immer konfl iktträchtig. Der<br />
Nachteil war, dass sich immer die Wege junger Mütter mit<br />
ihren Kindern und Jugendliche, die rauchen und vielleicht<br />
auch mal ein Bier vor der Einrichtung trinken, kreuzten.<br />
Das ging alles, sie haben das miteinander ausgehandelt<br />
und hingekriegt, aber es war nicht entspannt. Ich denke,<br />
dass viel an der Methode hängt. Wenn ich tatsächlich<br />
Zirkusarbeit mache und ich habe unterschiedliche Generationen,<br />
die Lust und Interesse daran haben, dann kann<br />
ich die an dem Thema auch begeistern und habe ein<br />
gemeinsames Thema, wo Kinder unterschiedlichen Alters<br />
teilnehmen können.<br />
Barbara Rehbehn: Ich wollte noch erzählen, wie wir das<br />
hier im Bürgerhaus Am Schlaatz machen. Das ist ein<br />
Haus, was aus einem FDJ-Jugendclub entstanden ist.<br />
Wir haben hier auch einen großen, offenen Jugendclub,<br />
der kommunal mit zwei Sozialpädagogen gefördert wird.<br />
Der ist räumlich stark getrennt. Konfl ikte gibt es zum Bei-
spiel vormittags, zum Beispiel wenn die Potsdamer Tafel<br />
die Räume nutzt, da beschweren sich die Jugendlichen<br />
darüber, dass die Erwachsenen ihren Müll da lassen. Wir<br />
haben im Haus relativ viele Jugendgruppen, die sich in<br />
irgendeiner Form selbst organisiert treffen. Es gibt einen<br />
Verein, der macht Streetdance, die treffen sich hier und<br />
tanzen. Es gibt eine Kickbox-Gruppe, die sich hier in dem<br />
Raum trifft, im Wechsel mit Senioren. Die nutzen einfach<br />
den Raum, der da ist. Man muss Räume so gestalten,<br />
dass sie vielfältig nutzbar sind, insofern ist es egal, ob da<br />
Jugendliche tanzen oder Senioren tanzen.<br />
Herbert Scherer: Ich habe im Mehrgenerationenhaus in<br />
Salzgitter etwas sehr Interessantes gelernt, dass man<br />
Gelegenheiten dadurch schafft, indem man Ressourcen<br />
knapp hält. Sie sagten: wir kaufen nicht <strong>für</strong> jede Gruppe<br />
eine bestimmte Geräteausstattung. Das bedeutete, sie<br />
müssen über die Geräte mit einander verhandeln. „Weniger“<br />
ist da eine gute Methode.<br />
Elke Ostwaldt: Ich arbeite seit 10 Jahren bei Outreach<br />
und bin absoluter Mehrgenerationen-Fan. Der Steffen<br />
kommt aus einem Projekt, das nennt sich „Die Querdenker“.<br />
Die Querdenker kamen aus Altglienicke, hatten<br />
einen eigenen Jugendclub, und zwar selbst verwaltet. Es<br />
gab eine sehr starke Ressource, nämlich die Rentner aus<br />
Altglienicke, die diesen Jugendclub, den es nach wie vor<br />
seit 12 Jahren gibt, in jeder Hinsicht unterstützt haben.<br />
Das heißt: Erwachsene, Rentner, haben sich <strong>für</strong> Jugendliche,<br />
die selbst verwaltet etwas in ihrem Kiez gemacht<br />
haben, eingesetzt, bis dahin, dass sie Outreach so unterstützt<br />
haben, dass wir unseren kleinen Jugendcontainer<br />
erhalten konnten. Das war eine ganz neue Qualität. Die<br />
Jugendlichen hatten ihren Club, hatten gemeinsam mit<br />
uns den kleinen Container aufgebaut und versuchten, der<br />
Nachbarschaft zu vermitteln, was sie dort machen. Die<br />
überwiegend älteren Herren ab 70 Jahren waren dort <strong>für</strong><br />
uns die Brücke. Die haben mit den Nachbarn gesprochen.<br />
Dann kam mal Herbert Scherer zu den Jugendlichen, das<br />
werde ich nie vergessen, weil die Jugendlichen mich nachher<br />
gefragt haben: „Was war das denn?“ Es war Winter,<br />
es gab dort keine Heizung und war wirklich sehr kalt.<br />
Herbert hat zu den Jugendlichen gesagt: „Ja, der Mangel<br />
macht’s.“ Aber Thomas Koch, einer der Jugendlichen, der<br />
u.a. jetzt auch bei uns beim Projekt arbeitet, hat neulich<br />
zu mir gesagt: Ja, ich werde dem Herbert sagen, wir waren<br />
wirklich sehr tätig, wir haben unheimlich viel geschafft.<br />
Wir haben das damals nicht begriffen, aber wir waren<br />
unheimlich aktiv und haben uns sehr eingesetzt. Das ist<br />
die Perspektive der Jugendlichen, aber die Unterstützung<br />
der Senioren war <strong>für</strong> uns sehr wertvoll. Ich bin den älteren<br />
Herren nach wie vor sehr dankbar, dass sie sich so eingesetzt<br />
haben.<br />
Herbert Scherer: An solch einem optimistischen Punkt<br />
sollten wir <strong>für</strong> heute enden.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 39
Input:<br />
Workshop<br />
Integrations-Perspektiven<br />
„Eingeborene“ begegnen Migranten<br />
Hüseyin Yoldas Gangway Straßen<strong>sozial</strong>arbeit<br />
(Schöneberg)<br />
Enver Sen Stadtteilverein Schöneberg<br />
Kadriye Karci (Senatsverwaltung <strong>für</strong> Stadtentwicklung)<br />
Moderation: Petra Sperling<br />
Petra Sperling: Wir sind heute alle in der Rolle von Zeitzeugen<br />
hier, egal in welchem Alter wir sind. Alle haben<br />
den Mauerfall miterlebt, <strong>für</strong> jeden war das etwas unterschiedlich.<br />
Wie war das <strong>für</strong> Menschen mit einem migrantischen<br />
Hintergrund? Was haben die Nachbarschaftseinrichtungen<br />
erlebt? Gab es Veränderungen?<br />
Wir haben drei Gäste: Hüseyin Yoldas von Gangway,<br />
Straßen<strong>sozial</strong>arbeit, Wanderer zwischen Ost und West;<br />
Kadriye Karci von der Senatsverwaltung <strong>für</strong> Stadtentwicklung,<br />
die spontan zugesagt hat, uns als Impulsgeberin in<br />
die Rückerinnerung zu führen. Sie hat ab 1985 im ehemaligen<br />
Osten gelebt. Und dann begrüße ich ganz herzlich<br />
Enver Sen aus dem Stadtteilverein Schöneberg, der seine<br />
persönliche Perspektive einbringt.<br />
Hüseyin Yoldas: Mit dem Titel „Eingeborene begegnen<br />
Migranten“ hatte ich meine Schwierigkeiten, weil ich mich<br />
selber auch als Eingeborenen und die Ossis als Migranten<br />
empfand. Vor 20 Jahren, als die Mauer fi el, dachte ich<br />
wirklich, dass wir als Eingeborene denen begegnen. Es<br />
war ein Gefühl, dass jetzt neue Deutsche kommen, die<br />
aber anders sind. Eigentlich hatten wir uns auch gefreut,<br />
weil wir an der Grenze in der Nähe der Warschauer Brücke<br />
aufgewachsen sind. An der Mauer gab es den Kanal und<br />
eine Lieblingsbeschäftigung der Migranten war, Reste<br />
von selbst gebackenem Brot an die Enten im Kanal zu<br />
verfüttern. Jedenfalls wurden wir immer gewarnt, dass<br />
wir nicht so nahe an den Kanal gehen sollten, weil wir<br />
reinfallen könnten. Wenn das passiert, dann würden die<br />
Grenzwachen einen erschießen. Mit dieser Sichtweise bin<br />
ich aufgewachsen.<br />
Aber auf der anderen Seite waren wir auch Kinder der<br />
68er-Generation. Obwohl die meisten unserer Eltern Analphabeten<br />
waren, kannten sie Lenin oder Karl Marx oder<br />
Sozialisten, wo ich dachte: alle Achtung, ohne Fernsehen<br />
oder ohne schreiben zu können, kannten sie sich damit<br />
aus. Deshalb hatten wir Kinder auch alle komischerweise<br />
solche Jacken mit der DDR-Flagge drauf, die waren schön<br />
warm und immer ein bisschen größer als das Kind, damit<br />
die Jacke über Jahre zu tragen waren. Es gab immer eine<br />
merkwürdige Identifi kation mit den <strong>sozial</strong>istischen Deutschen,<br />
damit verbanden wir Sehnsüchte.<br />
Als ich eines Tages, es war 1989 und ich war in der 8.<br />
Klasse, von der Schule kam, sah ich meine Mutter mit<br />
Nachbarn und Tanten herumlaufen, mit Teekannen und<br />
Sandwiches, weil auf der Straße eine große Menschenschlange<br />
stand. Die ging vom Schlesischen Tor bis zu uns<br />
am Görlitzer Park, also eine beachtliche Strecke. Ich sah<br />
also, wie sie die Leute mit Tee und Kaffee bedienten. Das<br />
hat uns gefallen. Wir Kinder haben dann ein paar Stunden<br />
mitgeholfen, totale Freudenstimmung, alles okay. Danach<br />
wurde uns in der Schule erzählt, was passiert war. Dann<br />
fanden die ersten organisierten Begegnungen statt. Da<br />
stellte sich <strong>für</strong> uns zum ersten Mal unser Selbstbild in<br />
Frage. Aus heutiger Sicht sind wir Migranten, aber ich<br />
zähle mich nicht zu den Migranten, ich bin ein Kreuzberger<br />
Junge, das sagt viel über meine Identifi kation aus.<br />
Ich hatte jedenfalls damals das Gefühl, irgendwas war<br />
schief gelaufen. Was ist denn mit denen los? Bringen die<br />
da das Vorurteil zwischen Wessis und Ossis und wir waren<br />
irgendwo dazwischen. Das könnt ihr doch nicht machen,<br />
wir gehören doch zu euch, wieso macht ihr überhaupt so
etwas? Natürlich gehört ihr doch alle zusammen, wir sind<br />
doch alle gemeinsam hier in Deutschland ... Also irgendwie<br />
standen wir in einer Vermittlerrolle dazwischen.<br />
Es kam zu Begegnungen, wo wir uns allerdings - vielleicht<br />
aus diesem <strong>sozial</strong>istischen Gedankengut heraus - am<br />
Anfang eher mit den Ostdeutschen identifi ziert haben,<br />
weil wir meinten, naja, ein bisschen sind die auch unterdrückt,<br />
eigentlich sind sie auch Migranten und welche von<br />
uns.<br />
Die ersten Differenzen kamen, als das mit den Übergriffen<br />
auf die Asylbewerberheime in Rostock und Hoyerswerda<br />
losging, teilweise auch Übergriffe auf Migranten,<br />
die noch dort waren. Die Angriffe gab es auch vor dem<br />
Mauerfall, besonders in Berlin, aber nicht in diesem Ausmaß,<br />
nicht, dass Häuser abgebrannt wurden. Wir dachten,<br />
so was darf es in einem <strong>sozial</strong>istischen Land doch gar<br />
nicht geben, deswegen hatten wir Schwierigkeiten, das zu<br />
verstehen, weil Sozialismus, Kommunismus und Nationalismus<br />
passten <strong>für</strong> uns irgendwie nicht zusammen.<br />
Dann gab es natürlich zu diesem Thema Begegnungen<br />
mit Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen<br />
Schulen im Osten, was unsere Sozialisation mit geprägt<br />
hat. Ich wurde neugierig, war in der 10. oder 11. Klasse<br />
und wollte dann im Osten wohnen, wollte selbstständig<br />
sein. Das war in unserer Familienstruktur ein bisschen<br />
schwierig, dass einer auszieht, um selbstständig zu sein.<br />
Ich habe leider versucht, mich in Treptow niederzulassen,<br />
also im Bezirk Schöneweide hatte ich eine Wohnung<br />
gefunden. Im Nachhinein musste ich einsehen, dass das<br />
ein Fehler war, weil Treptow eine Hochburg der rechtsradikalen<br />
Szene ist. Da war ich ein bisschen blauäugig.<br />
Danach bin ich in den Bezirk Prenzlauer Berg (Osten)<br />
gezogen, da war die Welt etwas anders, da gab es dann<br />
Freunde <strong>für</strong> mich. Später bin ich dann nach Kreuzberg<br />
(Westen) gezogen, heute lebe ich in Pankow (Osten). Insofern<br />
bin ich immer gewandert.<br />
Dabei wurde man immer wieder mit der Frage konfrontiert:<br />
zu welcher Zeit waren wir besser integriert? Waren<br />
wir überhaupt jemals integriert? Auch mit meinen Eltern<br />
und deren Generation habe ich später Gespräche darüber<br />
geführt, wann es uns besser ging. Die einzige Aussage,<br />
die alle machten: Vor dem Mauerfall war alles ganz<br />
anders – positiv ganz anders. Ich verstehe diese Aussage<br />
nicht. Eine 2-Raum-Wohnung mit 12 Personen, Außentoilette,<br />
wenn ich darüber nachdenke, da kann es einem<br />
nicht gut gegangen sein. Aber meine Eltern sehen das so,<br />
dass die Phase vor dem Mauerfall <strong>für</strong> sie komischerweise<br />
besser war, dass sie sich integrierter gefühlt haben. Ich<br />
habe dann gefragt: Woran lag das? Sie meinten dann:<br />
Ganz einfach, wir waren am Anfang als Gastarbeiter hier,<br />
da hatte man eine Aufenthaltsgenehmigung von einem<br />
oder von zwei Jahren. Anfang der 80er Jahre gingen<br />
einige aus der Familie wieder zurück. Wo ist der Punkt,<br />
warum ihr euch integriert gefühlt habt? Da meinten meine<br />
Eltern, mein Onkel, meine Tante usw.: als wir auch Geld<br />
vom <strong>Arbeit</strong>samt kriegen durften. Das war richtig, Mitte<br />
der 80er Jahre bekamen Gastarbeiter eine unbefristete<br />
<strong>Arbeit</strong>serlaubnis, damit brauchten sie keine Angst mehr<br />
zu haben, dass sie bei <strong>Arbeit</strong>slosigkeit wieder zurück in<br />
die Heimat gehen mussten. Sie hatten zwar noch nicht<br />
das Wahlrecht, aber die gleichen Rechte in Bezug auf<br />
Wohnverhältnisse, Anspruch auf Sozialhilfe, Anspruch auf<br />
<strong>Arbeit</strong>slosengeld. Erst von da an fühlten sie sich dieser<br />
Gesellschaft zugehörig.<br />
Es wurde dann <strong>für</strong> sie Mitte der 90er Jahre etwas schwieriger,<br />
als sie vom <strong>Arbeit</strong>smarkt verdrängt wurden. Die Integration<br />
war <strong>für</strong> die erste Generation sehr stark mit <strong>Arbeit</strong><br />
verbunden, <strong>Arbeit</strong> gleich Integration. Aus heutiger Sicht<br />
würde ich sagen, dass <strong>Arbeit</strong> nur ein wichtiger Faktor<br />
unter anderen ist. Aber ich glaube, dass die erste Generation<br />
durchaus die Integration mit <strong>Arbeit</strong> verbunden hat.<br />
Die Auswirkungen der Vereinigung waren <strong>für</strong> sie durch<br />
den enger werdenden <strong>Arbeit</strong>smarkt schwieriger.<br />
Petra Sperling: Ich fand spannend, dass du den Titel<br />
dieses Workshops anders verstanden hast, weil du dachtest,<br />
ihr gehört zu den Einheimischen, während diejenigen,<br />
die neu dazukommen, die Migranten sind. Das hat<br />
verdeutlicht, wie das gewirkt haben muss. Aber du hast<br />
ja auch beschrieben, dass ihr euch als integriert erlebt<br />
habt.<br />
Hüseyin Yoldas: Wir haben das auch an den Schulen<br />
gemerkt. Früher haben sich die Schulen mehr auf die<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 41
42<br />
Workshop Integrations - Perspektiven<br />
Belange der Migranten eingelassen, es gab Integrationsklassen,<br />
Hausaufgabenhilfe. Es gab Träger, die sich nur<br />
um Gastarbeiterkinder gekümmert haben. Vor dem Mauerfall<br />
waren auch alle Migranten in Berlin irgendwie tätig,<br />
es gab Jobs, man wollte die.<br />
Petra Sperling: Wurden die Ostdeutschen als Konkurrenz<br />
erlebt?<br />
Hüseyin Yoldas: Ich glaube – eher nein. Es ging eher in<br />
die Richtung zu sagen: hier sind wir - und ihr seid auch<br />
hier. Ich glaube, die Ablehnung ging nicht unbedingt<br />
gegen unsere Ostbürger. Das war keine Angst oder Hassgefühle<br />
oder Konkurrenz, eher Verbitterung, über die vielen<br />
Ausschreitungen, die sich dort häuften. Die gab es<br />
auch in Mölln usw., aber diese Bilder von Rostock und<br />
Hoyerswerda waren im ersten Augenblick <strong>für</strong> uns als 12-<br />
oder 13-Jährige schon heftig, weil wir fühlten, dass auch<br />
unser Haus hätte brennen können. Das war kein Hass,<br />
eher eine Art Panik. Es gab aber auch sportliche Begegnungen<br />
und Spiele untereinander, auch Fahrten, in denen<br />
es zu Begegnungen kam. Da gab es so Phasen von gegenseitiger<br />
Feindseligkeit.<br />
TN: Sie sind schon früh zu Hause weg und in einen Ostbezirk<br />
gezogen. Ich kenne das ganz anders von türkischen<br />
und arabischen Jugendlichen, dass sie den Osten gemieden<br />
haben wie die Pest, weil sie aufgrund der dortigen<br />
Vorfälle einfach Angst hatten.<br />
Hüseyin Yoldas: Ich glaube, dass es einige Migranten<br />
gab, die wirklich Angst hatten und den Osten gemieden<br />
haben. Wir kamen aus einer sehr armen Familie. Unsere<br />
Freizeit haben wir mit der Familie am Hermannplatz verbracht,<br />
wenn es dort Rummel gab. Sieben Kinder, plus<br />
Vater, wir durften pro Kind höchstens 5 Mark ausgeben.<br />
Natürlich wollten alle Autoscooter fahren, Geisterbahn<br />
usw., höchstens einmal oder zweimal durften wir fahren,<br />
dann war Schluss. Aber nach dem Mauerfall waren<br />
es vor allem Ältere, die waren 17 oder 18 Jahre alt, die<br />
hatten den Osten <strong>für</strong> sich als attraktiven Platz erobert.<br />
Es kam ja nicht sofort der Geldumtausch in D-Mark,<br />
also war es im Osten billiger. Sie waren hier mit dem<br />
Geld nichts, aber dort konnten sie damit ein bisschen<br />
angeben. Eine Attraktion war zum Beispiel, dass wir die<br />
Schlüssel von den Besitzern bekamen, haben dann 10<br />
D-Mark bezahlt und durften den ganzen Tag Autoscooter<br />
fahren, also dieses Gefühl, dass man mit wenig Geld<br />
dort viel mehr machen konnte. Dass es viele waren, die<br />
den Osten gemieden haben, das glaube ich nicht. Es gab<br />
einige, aber es gab auch eine große Gruppe, zumindest<br />
von denen, die in Kreuzberg wohnten, die bewusst ihren<br />
Aufenthaltsort am Alexanderplatz usw. gesucht haben.<br />
Ich war in der 11. Klasse und machte Abitur, sah mich<br />
auch als Sozialist, links, vielleicht von den 68er-Eltern<br />
ein bisschen geprägt, und sagte mir: okay, bevor ich<br />
jetzt im Westen in einem kapitalistischen System lebe,<br />
gehe ich mal zu meinen Genossen und werde dort mit<br />
ihnen gemeinsam leben. Ich habe damals nicht richtig<br />
mitbekommen, dass die dort gar keine Sozialisten mehr<br />
waren. Ich hatte meine politische Überzeugung, aber<br />
mit ihr lag ich etwa sieben oder acht Jahre zurück.<br />
TN: Wir sitzen mit dem Verein Otur ve Yasa, Leben und<br />
Wohnen, im Nachbarschaftshaus Centrum genau in<br />
dem Kreuzberg, das du beschrieben hast. Der Verein<br />
wurde in den 80er Jahren gegründet, weil die Probleme<br />
der türkischen Migranten zu dieser Zeit um das Wohnen<br />
und Leben kreisten. Wie komme ich mit meinem<br />
Vermieter klar? Was mache ich gegen einen drohenden<br />
Rausschmiss? Der Geschäftsleiter des Nachbarschaftshauses<br />
hatte mal die Zusammenhänge erklärt, nämlich<br />
dass mit dem Fall der Mauer die Berlinzulage weggefallen<br />
ist. Die Industrie wanderte aus Berlin ab, womit<br />
die <strong>Arbeit</strong>splätze, <strong>für</strong> die die Gastarbeiter ja hergeholt<br />
worden waren, auch wegfi elen. Heute kümmert sich<br />
Otur ve Yasa immer noch um die Themen Wohnen und<br />
Leben, aber in erster Linie geht es um Sozialberatung.<br />
Wie komme ich mit den Hartz IV-Leistungen klar? Das<br />
ist vielleicht eine Antwort darauf, wie es zu dem subjektiven<br />
Empfi nden der Migranten kam, dass es ihnen<br />
vor der Wende besser ging, weil sie damals noch <strong>Arbeit</strong><br />
hatten.
TN: Stimmt das eigentlich wirklich, dass sich die Migrantinnen<br />
und Migranten früher mehr integriert gefühlt<br />
haben? Von anderer Seite, also von deutscher Seite<br />
akzeptiert waren? Wie war das eigentlich?<br />
TN: Damals gab es diesen Begriff Gastarbeiter und sonst<br />
nichts. Das bedeutete, es sind Gäste da und irgendwann<br />
gehen sie wieder, also gab es keine politischen Bemühungen<br />
um das Erlernen der deutschen Sprache.<br />
TN: Es gab natürlich eine gewisse Zufriedenheit, weil man<br />
gearbeitet hat. Aber man hat sich nicht zugehörig gefühlt.<br />
Das gab es nicht. Es gab Situationen, wo die Gastarbeiter<br />
gewerkschaftlich viel erreicht haben. Z.B. in der IG Metall<br />
im Ruhrgebiet waren 70 bis 80 % der Gastarbeiter organisiert,<br />
von den deutschen Kollegen waren es nicht mal<br />
die Hälfte.<br />
TN: Es gab mehr Zufriedenheit vor dem Mauerfall?<br />
TN: Dass die damaligen Gastarbeiter die Ostdeutschen<br />
als Konkurrenz wahrgenommen haben, das würde ich<br />
eher bejahen. Ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen,<br />
wir lebten im Grenzschutzgebiet, als die Mauer fi el,<br />
es kamen viele aus den östlichen Ländern zu uns. Einer<br />
der Gründe, warum Gastarbeiter angeworben worden<br />
waren, war ja der Bau der Mauer, denn dadurch fehlten<br />
<strong>Arbeit</strong>skräfte im Westen. Demzufolge entstand durch den<br />
Mauerfall ein veränderter Zustand. Gastarbeiter in den<br />
Fabriken berichteten, dass sie nie wirklich Kontakt zu<br />
Deutschen hatten, jeder lebte in seiner Community, wie<br />
das auch heute ist. Natürlich frühstückt man vielleicht<br />
mal an einem Tisch, aber nach dem Mauerfall beobachteten<br />
viele aus ihrer subjektiven Wahrnehmung, dass sie<br />
eher noch mal eine Stufe herabgesetzt worden sind. Es<br />
kamen die ostdeutschen <strong>Arbeit</strong>er hinzu, irgendwann existierte<br />
eine Klassifi zierung. Man brauchte die Gastarbeiter<br />
nicht mehr, eigentlich müssten sie gehen. Es gab Mitte<br />
der 80er Jahre eine Rückwanderungswelle, besonders<br />
von türkischstämmigen Gastarbeitern, die da<strong>für</strong> bezahlt<br />
wurden, indem sie Anreize geboten bekamen, dass sie<br />
ihre Rente ausgezahlt bekommen, wenn sie mit ihrer<br />
Familie in die Türkei gingen. Das ging bis Ende der 90er Jahre.<br />
Als die Mauer fi el, da war ich 12 oder 13 Jahre alt. Ich<br />
gehöre zu der Generation, die Mölln, Solingen oder Hoyerswerda<br />
direkt mitbekommen haben, auch wie sich<br />
rechtsradikale Parteien und Organisationen vermehrt<br />
haben. In der Familie und in der älteren Generation war<br />
die Wahrnehmung, dass das durch den Mauerfall kommt,<br />
weil sehr viele solcher Strömungen sich im Osten angesiedelt<br />
haben. In Schleswig-Holstein gab es die auch, aber<br />
man lebte mit denen. Es gab immer Lehrer, die sich zur<br />
DVU oder sonst was bekannt haben, damit wurde ich als<br />
Kind immer wieder konfrontiert, angefangen von Kümmeltürke<br />
bis was weiß ich. Ich war das einzige türkische<br />
Migrantenkind. Egal wo du warst, wurdest du mit deiner<br />
Nicht-Zugehörigkeit konfrontiert.<br />
Ich, aus der zweiten Generation, bin integrierter als meine<br />
Eltern oder Ältere, was nicht bedeutet, dass wir kulturell<br />
integriert sind. Sondern wir sind eher sprachlich und was<br />
die Bildung angeht besser integriert. Durch die <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
steigen die Probleme bei der ersten Generation,<br />
dadurch auch die gegenseitige Ablehnung. Auch meine<br />
Eltern und deren Freunde haben immer wieder zu spüren<br />
bekommen, dass man sie nicht braucht, dass sie hier<br />
überfl üssig sind.<br />
Man wechselte dann von dem Wort Gastarbeiter zu Ausländer,<br />
erst vor sechs Jahren wurde aus dem Amt der Ausländerbeauftragten<br />
das des Integrationsbeauftragten.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 43
44<br />
Workshop Integrations - Perspektiven<br />
Diese begriffl ichen Abstufungen kommen von außen und<br />
man sollte sich damit auseinandersetzen.<br />
Als ich nach Berlin kam, habe ich mich nicht in den Osten<br />
getraut. Als ich das erste Mal nach Brandenburg gefahren<br />
bin, ertappte ich mich, wie ich nach rechts und links<br />
guckte, ob man an mir etwas erkennen könnte, was auf<br />
meine türkischstämmige Herkunft verweist. Es ist immer<br />
noch so, dass man in Diskussionen von „national befreiten<br />
Zonen“ hört. Ich war vor zwei Jahren in der Sächsischen<br />
Schweiz, davon hatten mir vorher alle abgeraten, dorthin<br />
zu fahren. Warum wohl? Das ist eine der Hochburgen der<br />
Faschos, der Rechten. Wir sind trotzdem hingefahren.<br />
Ich entspreche äußerlich nicht den gängigen Vorurteilen,<br />
aber ich ertappe mich dabei, dass es mir unangenehm<br />
ist, mich in so einer Umgebung zu bewegen, auch weil ich<br />
mit diesen Erfahrungen aufgewachsen bin. Ich habe auch<br />
Bekannte afrikanischer Herkunft, die sich noch nicht mal<br />
nach Marzahn oder Lichtenberg trauen.<br />
Meine Eltern fanden den Mauerfall total positiv, weil sie<br />
anfangs Gleichgesinnte in den Ostdeutschen gesehen<br />
haben. Aber irgendwann kippte das eben um. Allerdings<br />
weiß ich nicht, wann das war.<br />
TN: Mein Mann kommt aus Afrika, er ist 1 ½ Jahre vor<br />
dem Mauerfall nach Berlin gekommen. Vor dem Mauerfall<br />
wurde er als Amerikaner gesehen, nach dem Mauerfall<br />
als Ausländer. Das war natürlich eine Rückstufung. Ich<br />
erinnere mich, dass in der ersten Zeit sehr schnell so<br />
eine Art Konkurrenzgefühl da war. Ich habe im November<br />
oder Dezember 1989, also ganz frisch, Schularbeitenhilfe<br />
gemacht in Neukölln. Ein kleines Mädchen, vielleicht<br />
sieben Jahre alt, hat gesehen, wie die Leute alle zu<br />
uns rüberkamen, um das Begrüßungsgeld zu holen oder<br />
die Apfelsinen von Kaisers. Sie meinte plötzlich: Die stinken.<br />
Sie hat gleich den Neuen, die kamen, eine negative<br />
Zuweisung gegeben, weil sie schon als kleines Mädchen<br />
das Gefühl hatte: da passiert jetzt was, da ist eine Konkurrenz,<br />
wir werden verdrängt.<br />
TN: Du sagtest, du hast nach dem Mauerfall den Osten<br />
gemieden.<br />
TN: 1997 bin ich nach Berlin gekommen, um zu studieren.<br />
Ich wurde nicht nur von Freunden darauf hingewiesen,<br />
nicht unbedingt dorthin zu fahren, sondern habe einfach<br />
gemerkt, dass ich diese Art von Bedenken habe. Aber ich<br />
bin dann trotzdem hingefahren.<br />
TN: Wo war dein Bewegungsradius in Berlin?<br />
TN: Ich war im ersten Jahr im Studentenwohnheim Eichkamp<br />
in Charlottenburg, dann im Wedding, Kreuzberg,<br />
eigentlich überall.<br />
TN: Unser Bewegungsradius war vom Schlesischen Tor<br />
höchstens bis zum Görlitzer Bahnhof. Ich kann mich an<br />
den 20. April 1989 erinnern, da war die Mauer noch da.<br />
Das war der Tag, wo Neonazis zum 100. Geburtstag von<br />
Hitler überall publik gemacht haben, dass sie Ausländern<br />
eins auf den Deckel schlagen. Da wurden Mahnwachen<br />
gemacht, wo linke Leute teilnahmen, auch die SPD. Wir<br />
hatten aber auch Schwierigkeiten, nach Zehlendorf zu<br />
fahren, weil wir dort auch mit Rechtsradikalen konfrontiert<br />
waren.<br />
TN: Es geht ja darum, dass Gastarbeiterfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit,<br />
auch vor 1989 existierte. Ich sage<br />
nur, dass die Migranten, insbesondere die große Mehrheit<br />
der türkischstämmigen Migranten, in ihrer Wahrnehmung<br />
erlebt haben, dass nach dem Mauerfall die Formen dieser<br />
Gastarbeiter- und Ausländerfeindlichkeit zugenommen<br />
haben. Mölln, Solingen, usw., das war alles nach 1989.<br />
Es muss gar nicht damit zusammenhängen, das hängt<br />
wahrscheinlich auch gar nicht zusammen. Die Medien mit<br />
ihren Schlagzeilen haben natürlich heftig dazu beigetragen,<br />
die Anschläge und die Bilder davon, und dann eine<br />
repräsentative Umfrage: welches Bild habt ihr von den<br />
ostdeutschen Bundesländern? Wie stehen Sie zu Ausländern<br />
oder zu Migranten? Da werden alle sagen: Wir haben<br />
eher eine distanzierte Haltung.<br />
Petra Sperling: Wir lassen das einfach so stehen und<br />
wenden unseren Blick auf den östlichen Teil.
Kadriye Karci: Ich war seit 1985 in der DDR und zwar<br />
in Ost-Berlin. Westdeutschland habe ich erst 1989 bzw.<br />
1990 gesehen. Ich bin als Delegierte der Kommunistischen<br />
Partei der Türkei in die DDR gekommen, weil ich<br />
mein Land als politischer Flüchtling verlassen musste.<br />
Aber ich war eine privilegierte Person in der DDR. Nach<br />
der Wende, als ich meine Aufenthaltserlaubnis in der Ausländerbehörde<br />
verlängern musste, habe ich erst erfahren,<br />
dass ich ein politischer Flüchtling in der DDR war.<br />
Ich habe mich – im wahrsten Sinne des Wortes – in der<br />
DDR als Gast gefühlt und ich bin auch als Gast behandelt<br />
worden.<br />
Ich habe ungefähr zehn Monate in Wismar bzw. in Greifswald<br />
die deutsche Sprache gelernt. Für mich war schon<br />
von vornherein alles geregelt, es war klar, wo ich wohnen<br />
werde, wo ich die deutsche Sprache lerne, woher ich Geld<br />
bekommen, wer mich betreut, wer mein Ansprechpartner<br />
in der Schule ist, an wen ich mich wenden sollte, wenn<br />
es Probleme gibt. Das war ein geregeltes Leben <strong>für</strong> mich.<br />
Nach meinem Sprachkurs bin ich 1986 nach Ostberlin<br />
gekommen. Ich begann gleich mein Philosophiestudium,<br />
das ich trotz meiner sprachlichen Schwierigkeiten mit<br />
einem Diplom abgeschlossen habe. Diesen Kraftakt<br />
geschafft zu haben, darauf bin ich stolz.<br />
Während dieser ganzen Jahre hatte ich mit anderen<br />
Gästen aus Vietnam oder Kuba fast überhaupt keinen<br />
Kontakt. Später habe ich erfahren, dass diese<br />
Menschen, die durch einen Staatsvertrag in die DDR<br />
gekommen waren, in bestimmten Wohnheimen bzw. in<br />
bestimmten Gebieten lebten. So wie ich auch. Ich hatte<br />
nur Kontakte mit einigen wenigen Deutschen, aber das<br />
waren nicht sehr enge Kontakte, man musste immer<br />
einen bestimmten Abstand halten. Ich durfte zum Beispiel<br />
an den FDJ-Sitzungen oder SED-Sitzungen nicht<br />
teilnehmen, ich gehöre ja nur zu einer Schwesterpartei.<br />
Ich hatte überhaupt keine Kontakte zu Westberlinern<br />
oder zu Westdeutschen. Auch nicht mit Kommunisten<br />
von der Kommunistischen Partei der Türkei. Besucht<br />
habe ich die auch nicht. Ehrlich gesagt, hatte ich erst<br />
mal nicht daran gedacht, ob ich nach Westberlin oder<br />
Westdeutschland gedurft hätte. Finanziell gesehen,<br />
hätte ich die Möglichkeit gehabt, aber die Frage hat sich<br />
mir nie gestellt. Sondern mein Ziel war, dass ich mehr<br />
die anderen <strong>sozial</strong>istischen Länder sehe. Von denen<br />
habe ich einige besucht.<br />
Für die Diskussion ist es vielleicht wichtig, dass ich erst<br />
mal von den Problemen in den <strong>sozial</strong>istischen Ländern,<br />
auch in der DDR, nichts mitbekommen habe. Das kann<br />
man vielleicht vor dem Hintergrund verstehen, dass ich<br />
aus der Türkei kam. Als politisch Verfolgte wurde man<br />
dort wegen seiner Ideale ins Gefängnis gesteckt. Ich kam<br />
in der DDR in eine von mir gewünschte Gesellschaftsform,<br />
die ich als System immer haben wollte. Es war eine<br />
<strong>sozial</strong>istische Gesellschaft, was die <strong>Arbeit</strong> betrifft, keine<br />
<strong>Arbeit</strong>slosigkeit in den Betrieben, ein gutes Gesundheits-<br />
und Sozialsystem. Ich bin immer noch bereit, darüber zu<br />
diskutieren, aber kritisch und nicht negativ.<br />
TN: Ich habe das noch nie gehört. Hat die DDR damals<br />
politische Flüchtlinge aus westlichen Ländern aufgenommen?<br />
Kadriye Karci: Nicht nur aus der Türkei, sondern aus<br />
Palästina, Syrien, Libanon, Afghanistan, Brasilien, Griechenland<br />
oder zum Beispiel aus Chile.<br />
Als ich in die DDR gekommen war, hat man mir gesagt,<br />
dass ich nach dem Studium das Land verlassen müsste.<br />
Wohin, das wusste ich nicht. Aber eigentlich wollte ich<br />
auch wieder zurück in die Türkei, um dort politisch aktiv<br />
zu arbeiten. Aber dazu kam es nicht mehr.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 45
46<br />
Workshop Integrations - Perspektiven<br />
1989 war ich im vierten Studienjahr, ich war noch nicht<br />
fertig mit dem Studium und ich wollte es auch nicht unterbrechen,<br />
um in die Türkei zurückzukehren, weil es dort<br />
keine ökonomischen Grundlagen <strong>für</strong> mich gab. Ich wollte<br />
mein Studium beenden. Ab 1990 galten nicht mehr die<br />
DDR-Gesetze, sondern die Gesetze der BRD, deswegen<br />
musste ich eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.<br />
Das habe ich gemacht, weil ich mein Studium abschließen<br />
wollte. Aber wie Sie alle sehen, bin ich immer noch<br />
hier.<br />
1991 gab es dann tausende ABM-Stellen in der ehemaligen<br />
DDR, damals hat man diese Maßnahmen besser<br />
gestaltet, nach einer ABM-Maßnahme konnte man<br />
<strong>Arbeit</strong>slosengeld beantragen. Nach dem Studium war ich<br />
arbeitslos und suchte eine <strong>Arbeit</strong>, über Kontakte zu Leuten<br />
in Ostberlin. Sofort nach der Wende und Anfang der<br />
90er Jahre hat man in der ehemaligen DDR begonnen,<br />
überall Vereine zu gründen, um Projekte zu beantragen.<br />
So etwas war in der DDR total unbekannt. 1990 wurde<br />
in Lichtenberg auch der Verein gegründet, bei dem ich<br />
gearbeitet habe. Dieser Verein hatte ein ABM-Projekt, das<br />
war ein <strong>sozial</strong>es Beratungsprojekt. Und ich sollte dieses<br />
Projekt leiten.<br />
Aber ich wusste gar nicht, was <strong>für</strong> eine Beratung ich<br />
durchführen sollte. Soziale Beratung, das ist gut, aber<br />
was genau? Das war meine erste Berufserfahrung. Ich<br />
wollte Kontakte mit den anderen Vereinen aufnehmen,<br />
die schon seit Jahren in diesem Bereich Erfahrungen<br />
gesammelt haben. Das war keine allgemeine Sozialberatung,<br />
sondern <strong>für</strong> diejenigen, die keine Deutschen waren.<br />
Damals waren das ja nur ehemalige Vertragsarbeiter aus<br />
Vietnam, Mosambik, Kuba.<br />
Im Staatsvertrag zwischen der DDR und der BRD gab es<br />
eine Regelung <strong>für</strong> diese Menschen, aber darüber hinausgehend<br />
war das alles unsicher und ein großer Kraftakt,<br />
eine Aufenthalts- und <strong>Arbeit</strong>serlaubnis zu bekommen. Es<br />
war nicht sofort klar, ob man das Ausländergesetz öffnen<br />
wollte, um den ehemaligen Vertragsarbeitern Möglichkeiten<br />
zu schaffen. Das war ein großes Problem, aber da<br />
hat man mit diesen Vereinen in Ost und West zusammen<br />
im Sinne solcher Forderungen gearbeitet. Das war eine<br />
schöne und solidarische Aktion, weil das nicht nur eine<br />
politische Forderung von den Vereinen im Osten war,<br />
sondern auch von denen aus dem Westen. Zum Beispiel<br />
gab es damals im Haus der Demokratie große Veranstaltungen<br />
über dieses Thema mit Teilnehmern aus Ost und<br />
West. Da hat man keine Unterschiede gesehen, sondern<br />
man hat diese Menschen unterstützt und es hat geklappt.<br />
Für mich war das eine schöne, Impuls gebende gemeinsame<br />
Aktion, bei der man ein gemeinsames Ziel hatte.<br />
Bei diesem Projekt habe ich angefangen, die Vertragsarbeiter/innen<br />
zu beraten. Zunächst musste ich mich aus-<br />
bzw. fortbilden, wobei ich Unterstützung vom Flüchtlingsrat<br />
und dem Türkischen Bund Berlin-Brandenburg, der<br />
damals noch anders hieß, bekommen habe.<br />
Es gibt zwei Sachen, die mir merkwürdig vorkamen.<br />
Dieser Verein versuchte, sich auf die Probleme der Migranten<br />
zu spezialisieren, aber es gab ja nicht so viele<br />
Migrantinnen und Migranten im Ostteil der Stadt. Gut,<br />
die Vertragsarbeitnehmer und einige Türken wie ich. Ich<br />
kontaktierte einen türkischen Verein, weil es <strong>für</strong> uns im<br />
Osten überhaupt keine Erfahrungen mit der Ausländerproblematik<br />
und dem Zusammenleben gab. Der Verein<br />
war in Lichtenberg, in der Nähe vom S-Bahnhof Lichtenberg.<br />
1989/1990 war da auch eine Gruppe von Rechtsextremisten<br />
in der Nähe. In den ersten Jahren war das so<br />
extrem, dass man sich als Andersaussehender nicht im<br />
S-Bahn-Bereich aufhalten konnte.<br />
Ich habe zweimal während meiner Tätigkeit bi-nationale<br />
Schülerreisen organisiert. Aus West- und Ost-Schülern
oder -Studenten habe ich eine Gruppe gebildet und bin<br />
mit dieser Gruppe zum Austausch in die Türkei gefahren.<br />
Das zweite Mal waren wir in der Westtürkei, West-Anatolien.<br />
Sie mussten einige Tage einen Job ausüben und<br />
konnten dann 6 Tage Urlaub machen. Im Nachhinein<br />
kann man sagen, dass das alles positiv war. Aber ich hatte<br />
wirklich große Schwierigkeiten gehabt, dass die Schüler<br />
aus Ost und West zusammenkommen und miteinander<br />
reden konnten.<br />
TN: Gab es damals in Ostberlin eine ähnliche Infrastruktur<br />
wie in Westdeutschland bei den damaligen Ausländern,<br />
dass sie ihre eigenen Läden hatten oder als Arzt<br />
arbeiten konnten? Hier braucht man sich ja durch die<br />
türkische Infrastruktur kaum noch die deutsche Sprache<br />
anzueignen.<br />
TN: Sie erwähnten, dass Sie die Möglichkeit gehabt hätten,<br />
nach Westdeutschland bzw. Westberlin Kontakt aufzunehmen<br />
und auch zu reisen. Das wäre richtig genehmigt<br />
worden, Sie hätten es machen können. Warum haben Sie<br />
das nicht gemacht?<br />
Kadriye Karci: Von meiner Seite gab es keinen Wunsch<br />
dazu. Ich kam ja aus der Türkei, also kannte ich von daher<br />
auch westliches Leben.<br />
TN: Nach dem Studium haben Sie überlegt, wieder in die<br />
Türkei zurückzugehen. Wäre das denn möglich gewesen,<br />
weil Sie doch politischer Flüchtling waren?<br />
Kadriye Karci: Unter den damaligen Bedingungen glaube<br />
ich das nicht, aber ich wollte es.<br />
TN: Ich habe damals an der Freien Universität studiert,<br />
wollte aber mein Studium an der Humboldt-Universität<br />
abschließen. Wir haben einen Antrag gestellt, der wurde<br />
zunächst genehmigt, später aber abgelehnt, weil die<br />
Westberliner das nicht wollten, dass ich in Westberlin<br />
wohnen bleibe, aber im Osten studiere. Und das war ein<br />
Problem <strong>für</strong> viele aus der Dritten Welt. Im Osten war das<br />
Studium viel besser als in Westdeutschland. So kam es<br />
auch, dass viele arabischstämmige Studenten wechselten.<br />
Ich kenne auch etliche Studenten, die nach Russland<br />
gegangen sind. Sie haben dort gearbeitet und sind nach<br />
der Wende zurückgekommen. Die DDR war <strong>für</strong> Palästinenser<br />
das ideale Land, weil sie nie eine Heimat hatten.<br />
Und dort wurden sie einfach so aufgenommen und haben<br />
studiert. Sie hatten ein schöneres Bild von der DDR als<br />
von der BRD. Man wusste natürlich, dass die BRD damals<br />
nicht so gerne Palästinenser aufgenommen hat, weil sie<br />
gegen Israel gerüstet haben. So kam das positive Bild der<br />
DDR zustande, dort hatte man eine andere politische Meinung<br />
über Zionismus bzw. über den Staat Israel.<br />
Kadriye Karci: Ich denke, das ist vielleicht <strong>für</strong> euch<br />
schwer zu verstehen, aber wir kommen aus anderen Verhältnissen.<br />
Ich bin zwar als Student nach Deutschland<br />
gekommen, aber der Hintergrund war, dass die Türkei<br />
<strong>für</strong> mich eng geworden war, also ich konnte dort nicht<br />
mehr so frei leben. Man kommt dann aus Verhältnissen,<br />
die Westeuropa sich damals nicht vorstellen konnte, also<br />
Unterdrückung, Erpressung und Verfolgung. Und ein Land<br />
öffnete die Tür und hieß einen willkommen. Diese Situation<br />
muss man begreifen. Nach 20 Jahren setzt man sich<br />
hin und redet ohne weiteres über Fehler von damals, aber<br />
das ist zu leicht. Ich glaube, wir müssen die Geschichte<br />
nicht nur in Weiß oder Schwarz sehen, denn es gab auch<br />
noch andere Farben.<br />
TN: Ich habe es so verstanden, dass der Anlass <strong>für</strong> Ihr<br />
positives DDR-Bild weniger der Status des Flüchtlings war,<br />
sondern stark dadurch ausgelöst wurde, dass Sie sich als<br />
Genossin fühlten, insofern auch ein Stück Solidarität zu<br />
spüren bekamen.<br />
Kadriye Karci: Ja, klar. Es gab in der DDR gewerkschaftliche<br />
Organisationsformen. 1989/90 hat man angefangen,<br />
Organisationsformen der BRD zu übernehmen,<br />
was ich problematisch fi nde. Um das zu verdeutlichen,<br />
habe ich dieses ABM-Projekt so ausführlich erzählt, also<br />
dass unser Projekt vom <strong>Arbeit</strong>samt nur mit diesem Inhalt<br />
genehmigt wurde, nämlich <strong>für</strong> Ausländerinnen und Ausländer<br />
in Lichtenberg. Es gab ja gar nicht so viele Auslän-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 47
48<br />
Workshop Integrations - Perspektiven<br />
der und Ausländerinnen. Also man hat dieses westliche<br />
Problem ohne kritisches Hinsehen in den Osten transportiert.<br />
Man hätte aber dort andere Bedingungen voraussetzen<br />
müssen.<br />
Petra Sperling: Wir sollten den Fokus noch mehr auf die<br />
Gemeinwesenarbeit oder Nachbarschaftsarbeit richten,<br />
welche Auswirkungen die Wende hatte bzw. bis heute<br />
hat.<br />
Enver Sen: Es wurde gesagt, dass es ohne die Mauer<br />
nicht so viele Gastarbeiter im Westen gegeben hätte.<br />
Das ist mir unverständlich, weil ich denke, es hätte auf<br />
jeden Fall so viele gegeben. Man hat in Deutschland aufgebaut,<br />
ob in Ost oder West, insofern brauchte man natür-<br />
lich Gastarbeiter. Die haben auf jeden Fall viel geleistet<br />
in diesem Land und wir haben ein Recht darauf, von<br />
den Deutschen angenommen zu werden und uns hier<br />
zu Hause zu fühlen. Leider ist das noch nicht der Fall,<br />
weder vor dem Mauerfall noch danach. Darüber müssen<br />
wir diskutieren, wie es dahin kommen kann, dass sich<br />
die Leute, die seit Jahrzehnten hier leben, endlich mal zu<br />
Hause fühlen können.<br />
Das wird auch nicht durch Nachbarschaftsheime gelöst,<br />
dass dort alle Kulturen miteinander umgehen. Die Menschen<br />
kennen sich, sie werden miteinander auch einen<br />
Weg fi nden, damit umzugehen. Aber als gesellschaftliche<br />
Linie gibt es diese Gemeinschaft nicht. Wir Migranten<br />
versuchen, Gemeinsamkeiten zu fi nden, aber natürlich<br />
müssen auch die Unterschiede anerkannt werden.<br />
Was hat der Mauerfall mit den Migranten gemacht? Etwa<br />
ein halbes Jahr danach kamen Leute zu uns, weil sie entlassen<br />
worden waren und da<strong>für</strong> Ostdeutsche eingestellt<br />
wurden. Das war kein Einzelfall, sondern das fand massenhaft<br />
statt. Deswegen hat man sich wirklich als Mensch<br />
dritter Klasse gefühlt. Das wurde auch in vielen Betrieben<br />
gesagt, dass sie uns, also die Migranten, jetzt nicht mehr<br />
brauchen. Das Gefühl vom geteilten Deutschland war<br />
nicht mehr da, sondern das gefühlte Großdeutschland<br />
war wieder da. Das haben vor allem in Berlin die Leute,<br />
die hier seit Jahren gearbeitet hatten, deutlich gemerkt.<br />
Dadurch ist natürlich eine Kluft entstanden, als viele Ostdeutsche,<br />
z.B. <strong>Arbeit</strong>er aus Lichtenberg, bei Siemens in<br />
Siemensstadt angestellt wurden. So meinte man dann,<br />
wegen der Ostdeutschen seien sie arbeitslos geworden.<br />
Da entstand diese Sichtweise: ohne Ostdeutsche haben<br />
wir besser gelebt, weil wir <strong>Arbeit</strong>sstellen gehabt haben.<br />
Aber meine Einschätzung ist, dass die <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
nicht entstanden ist, weil die Mauer nicht mehr existierte,<br />
sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, das auch<br />
ohne Mauerfall entstanden wäre.<br />
Diese Vorurteile gegenüber den neuen Bundesländern<br />
sind in vielen Punkten nachvollziehbar, an Beispielen wie<br />
Hoyerswerda, Rostock, aber auch in Westdeutschland. Ich<br />
glaube, dass es ein allgemeines gesellschaftliches Problem<br />
ist, dass die Migranten nur als Fremde angesehen<br />
werden. Ich bin mit 19 hierher gekommen, gleich nach<br />
meinem Abitur. Jetzt bin ich seit 35 Jahren hier, ob ich<br />
noch immer Migrant bin, weiß ich nicht. Wir müssen einen<br />
Weg fi nden, wie wir uns hier zu Hause fühlen können.<br />
Ich denke, wir alle, die wir in Deutschland leben, haben<br />
es verpasst, nach dem Mauerfall eine neue Verfassung<br />
<strong>für</strong> Deutschland zu machen, die uns alle beinhaltet, auch<br />
unsere verschiedenen Kulturen.<br />
Ich gebe mal ein kleines Beispiel, wie Jugendliche sich<br />
heute fühlen. Es geht um meinen Sohn. Mit 3 oder 4 Jahren<br />
wurde er gefragt, was er ist. Er meinte, er sei halb Kurde,<br />
halb Türke und auch Deutscher. Er ist in Berlin geboren.<br />
Und dieser Mensch muss mit seinem 16. Lebensjahr von
der Ausländerbehörde eine Aufenthaltsgenehmigung<br />
beantragen. Dann fühlt er, dass er doch nicht Berliner und<br />
auch kein Deutscher ist. Ich denke, über diese Problematik<br />
muss man gründlicher diskutieren und nicht darüber,<br />
ob Hoyerswerda noch ausländerfeindlicher ist als Kreuzberg,<br />
weil uns das nicht weiter bringt.<br />
Petra Sperling: Hatte das konkrete Auswirkungen auf die<br />
Nachbarschaftszentren? Was können wir daraus lernen?<br />
Enver Sen: Wir haben erlebt, dass viele gesagt haben,<br />
dass sie arbeitslos geworden sind, keine Wohnungen<br />
mehr kriegen, dass sie als Menschen zweiter oder dritter<br />
Klasse behandelt werden, obwohl sie so viel hier mitgeholfen<br />
haben.<br />
Petra Sperling: Hat das Nachbarschaftszentrum Angebote<br />
verändert? Gab es auf der strukturellen Ebene<br />
etwas, was auf diese Betroffenheit der Nachbarschaft<br />
bzw. der Menschen reagiert hat?<br />
Hüseyin Yoldas: Ich habe das in einem Haus erlebt, das<br />
damals eine Jugendeinrichtung war. Aufgrund der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
der Eltern haben sich <strong>Arbeit</strong>sgruppen speziell auf<br />
die Einbeziehung von Müttern konzentriert. Auf einmal gab<br />
es dort eine Vätergruppe, in der gemeinsam gekocht wurde;<br />
und man sah sich zusammen einen Film an, was <strong>für</strong> uns<br />
vorher unvorstellbar war. Man versuchte, den Müttern, die<br />
Analphabetinnen waren, zuerst das Lesen und Schreiben<br />
beizubringen. Darüber versuchte man sie in den Schulen<br />
zu integrieren. Die Hoffnung der Nachbarschaftsheime<br />
war, dass man durch die Mütter die Integration der Kinder<br />
in den Schulen schafft. Die Nachbarschaftsheime haben<br />
sich viel mehr um die Eltern gekümmert, insbesondere um<br />
die der ersten Generation, die vorher keine Rolle gespielt<br />
haben. Vorher ging es nur um die Jugend- und Kinderarbeit,<br />
zumindest war das meine Beobachtung. Aber danach<br />
war es in meiner Umgebung so, dass auf einmal Erwachsene<br />
in den Clubs auftauchten, wo wir dachten: Aber das<br />
war doch unser Club! Das war, weil sie einfach arbeitslos<br />
waren und mehr Zeit hatten und wollten dann irgendwas<br />
tun. Ich fand das damals süß.<br />
TN: Ich denke, die Wirtschaftskrise gab es schon vor der<br />
Maueröffnung, da fi ng das an, dass die <strong>Arbeit</strong> nicht mehr<br />
als Integration wirkte, weil es zunehmend <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
gab. Durch die Maueröffnung hat sich dann das Interesse<br />
konzentriert und umgedreht. Die Nachbarschaftshäuser<br />
hinken ja, wie die Gesellschaft auch, immer ein bisschen<br />
hinter den gesellschaftlichen Entwicklungen her. Mit dieser<br />
ganzen Integrationsdebatte tauchten dann auch alle<br />
Probleme auf, die eigentlich ganz stark über die <strong>Arbeit</strong>slosigkeit<br />
ausgelöst worden waren. Dann haben sich die<br />
Angebote in Richtung Elternarbeit geändert.<br />
TN: Ich würde dem zustimmen, im Prinzip war das Problem<br />
schon vor der Maueröffnung da. Zum Gründungsmythos<br />
von Gangway gehört natürlich auch, dass große<br />
Gruppen von arabischen und türkischen Jugendlichen<br />
in Kreuzberg und Wedding aufgetaucht sind, bis zu 300<br />
Leuten stark. Sie wurden von Jugendhäusern und Sozialinstitutionen<br />
oder Schulen im Prinzip gar nicht mehr<br />
angesprochen. Natürlich haben die Gruppen als Refl ex<br />
auf diese Ausgrenzungsprozesse, die vorher schon stattgefunden<br />
haben, reagiert. Das kam zeitlich mit dem<br />
Mauerfall zusammen. Da kann man alles mit reinpacken,<br />
wahrscheinlich ist an allem irgendwas wahr. Da hat sich<br />
auch eine Menge hochgespielt. Die <strong>sozial</strong>e <strong>Arbeit</strong> hat<br />
manchmal völlig hilfl os darauf reagiert, was ich eigentlich<br />
ein gutes Beispiel fi nde, auch wenn das im konkreten<br />
Fall nicht stimmt, um mal die Tabugrenzen der <strong>sozial</strong>en<br />
<strong>Arbeit</strong> zu thematisieren. Kann man mit Jugendarbeit oder<br />
Elternarbeit etwas erreichen? Das wird auch theoretisch<br />
viel zu wenig entwickelt.<br />
Die Übernahme von Strukturen im Osten: In Ostberlin gab<br />
es das Drogenproblem, das es in Westberlin gab, überhaupt<br />
nicht. Aber innerhalb kürzester Zeit gab es dort ein<br />
Drogenberatungsteam. Man hat dann gewartet, bis das<br />
Drogenproblem auch ankam. Das lag an den Interessen<br />
von den Trägern, von Interessengruppen, da können wir<br />
uns unter Umständen an bestimmten Punkten an die<br />
eigene Nase fassen, wie die Sachen funktioniert haben.<br />
Die großen Träger haben sich natürlich auch in Bezug auf<br />
Migrantengruppen bestimmte Themen aufgeteilt, wer <strong>für</strong><br />
wen zuständig ist.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 49
50<br />
Workshop Integrations - Perspektiven<br />
TN: Ich will noch was zu den Nachbarschaftshäusern<br />
sagen. Wir arbeiten ja im gleichen Verein und 1989 waren<br />
wir gerade ein Stadtteilzentrum geworden. Wir waren ein<br />
Selbsthilfeprojekt, ein Stadtteilprojekt <strong>für</strong> Migranten und<br />
hatten die Aufgabe, auch die Deutschen mit in unsere<br />
<strong>Arbeit</strong> zu integrieren. Das war <strong>für</strong> uns eine Herausforderung,<br />
denn Deutsche suchten gar nicht solche Treffpunkte.<br />
Wir hatten Gruppen <strong>für</strong> Mütter, <strong>für</strong> Väter, Deutschkurse,<br />
Alphabetisierungskurse, wir hatten einen Jugendtreff,<br />
haben eine Jugendzeitung gemacht, bei uns gehörte alles<br />
Mögliche immer dazu. Wir haben auch in dieser Zeit, weil<br />
wir um unsere Einrichtung schon von Anfang an kämpfen<br />
mussten, als Verein eine gewisse Stärke entwickelt. Also<br />
unser Verein hat sich dadurch verändert und ist inzwischen<br />
ein inter<strong>kulturelle</strong>r Verein, auch weil wir nicht zu<br />
einer Randgruppe werden wollten. Wir mussten uns ganz<br />
schön anstrengen, dadurch haben wir den Hintern hochgekriegt.<br />
Inzwischen ist das Nachbarschaftshaus das<br />
Leitprojekt des Vereins geworden.<br />
Das ist eine Entwicklung, die in den einzelnen Nachbarschaftseinrichtungen<br />
und Stadtteilzentren sehr<br />
unterschiedlich gelaufen ist. Aber bei uns gab es in der<br />
gesamten <strong>Arbeit</strong> eine klare Ausrichtung auf inter<strong>kulturelle</strong><br />
Strukturen. Ich arbeite auf unterschiedlichen Ebenen mit<br />
den Teams zusammen, also es gibt nicht das Migrantenprojekt,<br />
wie es das bei vielen gibt. Sondern es gibt Projekte<br />
über bestimmte Sachthemen, an denen Leute mit<br />
unterschiedlicher Herkunft zusammen arbeiten. Das ist<br />
vielleicht ein wichtiger Unterschied. In Westberlin gab es<br />
so in den 80er Jahren schon eine richtige Zäsur mit dem<br />
Lummer-Erlass.<br />
TN: Zuzugsperre?<br />
TN: Nein, die Zuzugsperre war früher, in den 70er Jahren.<br />
Das hieß, man durfte als Migrant nicht mehr nach Kreuzberg<br />
ziehen, durfte aber noch in den Wedding oder nach<br />
Schöneberg, wo die Mieten noch bezahlbar waren. Der<br />
Lummer-Erlass sah vor, dass Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz<br />
hatten und arbeitslos waren, weg sollten,<br />
die kriegten mit 18 Jahren keine Aufenthaltserlaubnis<br />
mehr. In der Rückschau war das <strong>für</strong> mich das erste Mal,<br />
dass ich erlebt habe, und ich war schon lange in dieser<br />
<strong>Arbeit</strong> engagiert, dass sich Migranten richtig zurückgestoßen<br />
fühlten, ausgegrenzt und gefährdet. Bis dahin war<br />
es so, man wollte hier eine Aufenthaltserlaubnis haben<br />
und bleiben, hat sich so in einem Status Quo eingerichtet.<br />
Aber dann sollten plötzlich die Kinder weg.<br />
Damals wurde von migrantischen Linken die Position vertreten,<br />
dass wir keine Identität als Deutsche hätten. Das<br />
war ein großes Problem. Wir haben mit Leuten zusammengearbeitet,<br />
die sagten: ich bin Türke oder Kurde oder<br />
sonst was und waren auch noch stolz darauf.<br />
TN: Mit der Wende gab es plötzlich Deutsche, die es als<br />
selbstverständlich ansahen Deutsche zu sein. Die waren<br />
anders drauf, das hat die Debatte in Deutschland total<br />
verändert.<br />
TN: Wir sind in diese Wende reingerasselt und waren<br />
plötzlich Deutsche und wir sind ein Land. Ja, was denn <strong>für</strong><br />
ein Land? Diese Zugehörigkeit zu dem größeren Deutschland<br />
war sehr ambivalent. Die Migranten wollten nicht<br />
hier assimiliert werden, darum ging damals die Debatte.<br />
Multi<strong>kulturelle</strong> Gesellschaft oder Assimilation, das war<br />
eine Alternative. Es gab 1987 einen Kongress in der FU,<br />
Kultur im Wandel, wie muss sich Kultur verändern? All<br />
diese Fragen waren plötzlich weggewischt.<br />
Die Stadtteilzentren sind winzig kleine Orte der Begegnung.<br />
Dort begegnen sich die Leute, die da aktiv und<br />
engagiert sind. Und das sortiert sich auch in den Stadtteilen.<br />
Es gibt kein Stadtteilzentrum, das von sich behaupten<br />
könnte, es erreiche überall alle Leute. Man erreicht<br />
in verschiedenen Projekten eine Menge verschiedener<br />
Leute, die wollen sich gar nicht unbedingt begegnen.<br />
Wenn wir in unserem Stadtteil eine Begegnung zwischen<br />
den Deutschen, die dort wohnen, und den ausgegrenzten<br />
Migranten organisieren wollen, dann kriegen wir das nie<br />
hin. Wir können nur da<strong>für</strong> sorgen, dass es Chancen gibt,<br />
sich mal über den Weg zu laufen, und die werden immer<br />
weniger. Dieses Wir-Gefühl, wir gehören dazu, das ist das<br />
Entscheidende. Die deutsche Gesellschaft, die sich erst<br />
als deutsche Gesellschaft aufbauen musste, entwickelte<br />
plötzlich dieses Ausgrenzungsphänomen, dass die Mig-
anten nicht dazugehören sollten. Das führt auch dazu,<br />
dass die Ausländer, die bisher so locker in die <strong>Arbeit</strong> der<br />
Nachbarschaftshäuser eingebunden waren, sehr viel<br />
schwieriger geworden sind als das Klientel, das wir vorher<br />
hatten.<br />
TN: Ich war das erste Mal in Berlin-Schöneberg in einem<br />
Nachbarschaftsheim, mit einer Theatergruppe, die wir<br />
dort gegründet haben. Damals gab es eine Flüchtlingswelle<br />
aus dem Libanon und da hatten sich in dem Nachbarschaftsheim<br />
ziemlich viele Gruppen gebildet. Man hat<br />
sie zwar mit Türken oder Iranern verwechselt, aber da war<br />
plötzlich eine Gruppe, die vorher nie existiert hat, außer<br />
ein paar Studenten oder Intellektuellen, die in der Stadt<br />
waren. Da sind <strong>für</strong> mich die Nachbarschaftsheime sozusagen<br />
erst eine Adresse geworden. Ich bin dann öfter ins<br />
Nachbarschaftsheim Schöneberg gegangen und im Wedding<br />
auch. Damals war ich noch Student, da wurden wir<br />
angerufen, ob wir nicht ehrenamtlich übersetzen könnten,<br />
deswegen haben viele in diesen Nachbarschaftsheimen<br />
gearbeitet. Da haben wir unterschiedliche Erfahrungen<br />
gemacht. Ich habe zum Beispiel die Erfahrungen in Ostberlin<br />
oder in der ehemaligen DDR ganz anders gesehen<br />
als vielleicht andere. Ich erinnere mich daran, dass ich<br />
mit einer Jugendgruppe in Ostberlin war. Wir wurden dort<br />
nicht bedient, als wir Pommes kaufen wollten, weil wir alle<br />
schwarze Haare hatten.<br />
Das waren die ersten Erfahrungen <strong>für</strong> uns im Ostteil der<br />
Stadt, an der Grenze zu Ostberlin. Mit der Gewerkschaft<br />
Erziehung und Wissenschaft habe ich dann angefangen, in<br />
der DDR Schulen zu besuchen, da habe ich ungefähr 1.000<br />
Schulen besucht. Ich bin immer in die Klassen gegangen, wo<br />
ich wirklich als Exot gesehen wurde. Es gab nämlich Leute<br />
in der DDR, die noch nie einen Araber gesehen haben. Das<br />
Extreme war, als ich nach Hoyerswerda gefahren bin, um<br />
nach diesem Anschlag zu demonstrieren. Da hat man auch<br />
diese Angst gespürt, dass man angegriffen werden könnte<br />
als Ausländer. Man hat uns übrigens immer als Türken<br />
gesehen. Für die Leute in der DDR gab es nach der Wende<br />
als Ausländer aus dem Westen nur Türken.<br />
TN: Und Neger.<br />
TN: Genau, und Neger. Das Wort Neger wurde in den<br />
Klassen deutlich gesagt. Einmal in einer Schule in Leipzig,<br />
direkt nach dem Mauerfall, kamen plötzlich zehn oder<br />
zwölf Jugendliche mit Stiefeln in die Klasse rein, wo ich<br />
meinen Vortrag gehalten habe. Ich hatte zwar Angst, aber<br />
ich habe trotzdem weiter geredet, und die Lehrer haben<br />
sich nicht einmal eingemischt, die haben dieses Drohverhalten<br />
der Jugendlichen ohne ein Wort akzeptiert. Also es<br />
gibt auch solche Erfahrungen, das muss man sehen.<br />
Kadriye Karci: Wir sind uns ja darüber einig, dass es<br />
schlimm war oder immer noch schlimm ist, wenn es so<br />
weitergeht. Ich habe eine Idee. Es gab damals gleich nach<br />
der Wende große rechtsextremistische Organisationen<br />
und Gruppierungen in Lichtenberg, jetzt auch in der Sächsischen<br />
Schweiz. Nach 20 Jahren könnte man vielleicht<br />
anderes erhoffen, aber damals ist das <strong>für</strong> mich ja auch so<br />
gewesen, dass der Mauerfall und die Wiedervereinigung<br />
ein Wertewandel <strong>für</strong> diejenigen war, die in der DDR gelebt<br />
haben. Die <strong>sozial</strong>istischen Werte, die amtlichen Positionen<br />
und Einstellungen waren nichts mehr wert, man<br />
musste stattdessen etwas anderes haben. Aber welches<br />
die anderen Werte sein sollten, das war niemandem klar,<br />
welche Werte man übernehmen sollte oder welche Werte<br />
immer noch wertvoll sind, woran man sich orientieren<br />
konnte. Diese nationale Identität ist <strong>für</strong> mich auch eine<br />
falsche Entwicklung, man hat einen Punkt gefunden, wo<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 51
52<br />
Workshop Integrations - Perspektiven<br />
man angeblich eine Gemeinsamkeit <strong>für</strong> alle hat. Das war<br />
und ist eine gefährliche Entwicklung, man sollte diesen<br />
Wertewandel weiter beobachten.<br />
TN: Sind denn die Nachbarschaftseinrichtungen Orte,<br />
wo solche Werte-Debatten organisiert werden könnten?<br />
Das ist ja keine abstrakte Debatte, sondern sie betrifft<br />
uns zentral in unserer <strong>Arbeit</strong> und in unserem Selbstverständnis.<br />
Das fi nde ich spannend, auch wenn es nicht einfach<br />
ist. Da sind zum Beispiel die Fragen: Wie wollen wir<br />
eigentlich miteinander umgehen? Was sind pädagogische<br />
Werte? Was sind unsere Erziehungsziele? Wie gehen wir<br />
mit der Spannbreite von Werten um? Zum Beispiel kommt<br />
in der letzten Zeit die größte Einwanderergruppe in Berlin<br />
aus der ehemaligen Sowjetunion, die ganz andere<br />
Erfahrungen und Werte mitbringt. Von streng Gläubigen<br />
bis zu dem Denken, dass Religion Opium <strong>für</strong>s Volk ist,<br />
wie komme ich <strong>für</strong> diese ganze Spannbreite zu pädagogischen<br />
Prinzipien?<br />
Wir haben solche Fragen bei uns zwei Jahre lang diskutiert.<br />
Da ging es ans Eingemachte. Aber eigentlich müsste es<br />
darüber einen permanenten Diskussionsprozess geben.<br />
Ich habe das als positive Erfahrung empfunden.<br />
TN: Der Mauerfall war eine Zäsur in der Gesellschaft,<br />
wo sich das Fremdbild auch bei Migranten geändert<br />
hat, weil ein Wandel stattgefunden hat. Erst stand<br />
offiziell Ausländer in den Medien, später wurden sie<br />
dann Migranten, die Türken wurden dann zu Deutsch-<br />
Türken. Das Bild hat sich in der Öffentlichkeit geändert,<br />
dadurch aber auch das Selbstbild, nicht nur in<br />
der ersten Generation, sondern in der zweiten oder<br />
dritten Generation, die hier keine Migranten sind, weil<br />
sie hier geboren wurden. Man sagte dann auch Migrantenkinder.<br />
Dieser Prozess hat stattgefunden, wo<br />
wir uns durch die Begegnung und jetzt Ausgrenzung<br />
definieren mussten. Aber wir wurden auch damit konfrontiert,<br />
dass wir hierher gehören, denn die gleichen<br />
Ausgrenzungen, die wir hier haben, begegnen uns<br />
auch in unseren Herkunftsländern. Ich kann jetzt nur<br />
<strong>für</strong> die Türkei sprechen, aber dort gibt es den Begriff<br />
des Deutschtürken, manche sagen auch, wir seien<br />
die Türken der Deutschen. Das ist gar nicht mal so<br />
abwegig, es stimmt. Unsere Selbstwahrnehmung hat<br />
sich innerhalb der letzten 20 Jahre besonders in der<br />
zweiten und dritten Generation verändert, und das hat<br />
dazu geführt, dass wir mehr fordern. Das kann man<br />
weltweit beobachten, besonders in der dritten Generation,<br />
dass man sich wieder auf die Herkunftsländer<br />
der Großeltern zurückbesinnt, weil man sich mit dieser<br />
Ausgrenzung nicht abfinden kann. Dann gibt es diejenigen,<br />
die sagen: Nein, ich gehöre hierher, auch wenn<br />
ich nach außen hin nicht integriert bin. Ich falle aus<br />
der Statistik komplett raus. Ich bin unsichtbar. Also<br />
Araber, Kurden, Albaner, das sind alles Türken, weil<br />
Türke nicht nur eine Herkunft bezeichnet, sondern<br />
eine Art Stereotyp oder Sozialtypus geworden ist, wo<br />
alles reingepackt wird.<br />
Es ist die Aufgabe der Gemeinwesenarbeit und der <strong>sozial</strong>en<br />
<strong>Arbeit</strong>, darauf nicht nur zu reagieren, sondern zu<br />
beobachten, was sich da entwickelt. Inter<strong>kulturelle</strong> Kompetenz<br />
ist in den letzten Jahren viel zu spät entwickelt worden,<br />
denn Migranten bzw. Einwanderer gibt es seit den<br />
60er Jahren. Also sollte die Gesellschaft auch mit ihren<br />
Angeboten darauf reagieren. Ich höre oft in Gesprächen,<br />
dass heutzutage <strong>für</strong> Migranten was angeboten wird, aber<br />
sie nehmen es nicht an. Dann denke ich immer, dass<br />
man dann als Gemeinwesenarbeiter nicht die Migranten<br />
in Frage stellen sollte, sondern das Angebot. Was können<br />
wir als Nachbarschaftshäuser schaffen, die mehrheitlich<br />
„deutsch“ besucht sind, um Migranten reinzuholen und<br />
ihnen zu zeigen, dass das Häuser sind, die sie selber nutzen<br />
können. Man sollte nicht immer nur was anbieten,<br />
sondern aufzeigen, was sie alles gestalten können, dass<br />
es ein Ort <strong>für</strong> sie ist, den sie nutzen können, also dieser<br />
partizipative Aspekt.<br />
TN: Ich versuche, den Mauerfall als Chance zu sehen, als<br />
etwas zu sehen, wo auch neue Wege <strong>für</strong> Migranten geöffnet<br />
werden, hin zu neuen Freundschaften in neuen Regionen.<br />
Der Mauerfall bietet eine neue Perspektive in die<br />
Zukunft. Ich zähle mich jetzt nicht mehr zu den Migranten,<br />
weil ich mich als Deutscher in der Gesellschaft fühle.
TN: Ich war 12 oder 13 Jahre alt, als die Mauer fi el. Ich<br />
meine, dass nicht nur Migranten sich fremd fühlten, sondern<br />
auch die Ostkinder von damals. Ursprünglich komme<br />
ich aus Nordrhein-Westfalen, habe das alles ein bisschen<br />
anders erlebt. Wir hatten auch Schüleraustausch mit Ost-<br />
Jugendlichen. Damals waren wir sehr aufgeregt, weil jetzt<br />
andere zu uns reinkommen. Ich kann mich erinnern, dass<br />
ich sie nicht mochte – und sie mochten mich auch nicht.<br />
Auf jeden Fall denke ich, dass sie unsicher waren, weil sie<br />
so einen ähnlichen Identitätskonfl ikt hatten wie ich, zum<br />
Beispiel: Bin ich ein Deutscher? Bin ich kein Deutscher?<br />
Ich bin hier in Deutschland geboren, ich kann aber bis<br />
jetzt nicht sagen, dass ich eine Deutsche bin, ich bin auch<br />
keine Migrantin – weiß ich nicht -, aber ich bewege mich<br />
zwischen drei Kulturen, arabisch, türkisch und deutsch.<br />
Es kam einmal vor, dass ein Freund über mich sagte: Ja,<br />
das ist eine Deutsche. Da fühlte ich mich plötzlich beleidigt.<br />
Aber wenn jemand sagt: Das ist eine Türkin, dann<br />
fühle ich mich auch wieder beleidigt. Warum? Ich fühle<br />
mich erst einmal als Mensch.<br />
Ich bin total gerne in der Türkei, aber da muss man sich<br />
immer wieder behaupten. Als Kind habe ich mich als Gastkind<br />
gefühlt. Ich war aus der dritten Generation, meine<br />
Großeltern waren in Deutschland, meine Eltern sind es<br />
immer noch, und ich bin hier geboren. Das Wort Gastarbeiter<br />
fand ich als Kind total schön, weil in den türkischen<br />
und arabischen Familien Gäste etwas ganz Besonderes<br />
sind. Als Kind habe ich mich als etwas total Besonderes<br />
gefühlt. Und dann kam der Mauerfall, da war ich nicht<br />
mehr Gast wie als Kind oder Jugendliche, sondern eher<br />
eine Fremde, arabisch, türkisch. Ich denke, wir haben alle<br />
Vorurteile. Wir denken meistens an Unterschiede, aber<br />
ich denke an Gemeinsamkeiten. Wenn man sich überlegt,<br />
was wir gemeinsam haben, dann kann man sich besser<br />
orientieren.<br />
Ich habe in Holland studiert, da gibt es andere Sitten und<br />
andere Rituale. Alles, was anders ist, ist fremd. Zum Beispiel<br />
das Kind, das nach dem Mauerfall meinte, dass die<br />
Ossis stinken. Stinken bedeutet, dass die anders sind.<br />
Das drückt ein Gefühl von Angst vor dem Fremden aus.<br />
Deshalb fi nde ich in Berlin die Nachbarschaftshäuser<br />
total toll, Nachbarschaftszentren, davon habe ich das<br />
erste Mal im letzten Monat gehört. So etwas gab es zum<br />
Beispiel in Nordrhein-Westfalen nicht, zumindest sind<br />
diese Einrichtungen nicht so verbreitet.<br />
Seit sechs oder sieben Jahren werden die Begriffe Integration,<br />
Migranten oder Migrationshintergrund benutzt.<br />
Ich habe zum Beispiel immer noch einen türkischen Pass,<br />
obwohl ich hier geboren bin. Aber ich stelle mich einfach<br />
stur, obwohl meine Heimat hier ist.<br />
Zur Integration: Was auf Deutschland zukommt, das<br />
wurde vielleicht unterschätzt. Was heißt eigentlich Integration?<br />
Es gibt noch keine richtige Defi nition, habe ich<br />
gelesen, Sie können mich gerne widerlegen. Integration<br />
muss ja von beiden Seiten ausgehen.<br />
Petra Sperling: Das ist ein sehr großes Thema, das wir<br />
eigentlich extra behandeln müssten.<br />
TN: Okay. Zu Zeiten des Mauerfalls waren meine Eltern<br />
nicht zufrieden. Mein Papa hat als Vorarbeiter in einer<br />
Fabrik gearbeitet, aber nach dem Mauerfall war er wieder<br />
ein ganz normaler Mitarbeiter, insofern hat er sich nicht<br />
darüber gefreut, weil seine Stunden gekürzt wurden.<br />
TN: Ich möchte mich nicht integrieren, ich möchte ein Teil<br />
der Gesellschaft werden. Ich möchte, dass Emanzipation<br />
und Partizipation in der Gesellschaft stattfi ndet. Für mich<br />
bedeutet Integration eine Anpassung der Minderheiten<br />
an die Mehrheit. Und an wen soll ich mich anpassen?<br />
Leitkultur ist <strong>für</strong> mich nur ein Wort, in Wirklichkeit gibt es<br />
keine Leitkultur. Die Aufgaben der Nachbarschaftseinrichtungen<br />
sollte man wirklich nicht übertreiben, wir können<br />
nicht die Gesellschaftsprobleme lösen und sollten das<br />
auch nicht zu unserer Aufgabe machen. Wir können uns<br />
an der Straße, zu der wir gehören, mehr oder weniger<br />
orientieren, mit Leuten, die wir kennen, etwas tun und<br />
nicht mit der gesamten Gesellschaft. Deswegen muss<br />
uns klar sein, was wir machen können und wo unsere<br />
Grenzen sind.<br />
Petra Sperling: Mehr Austausch ist nötig, aber jetzt leider<br />
nicht mehr möglich. Vielen Dank.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 53
Input:<br />
Workshop<br />
Ost/West-Begegnungen<br />
Ossis - - - begegnen Wessis<br />
Birgit Weber ehem. Geschäftsführerin <strong>Verband</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
Gunter Fleischmann Jugendwohnen im Kiez<br />
Siegfried Kaschke Neues Wohnen im Kiez<br />
Gisela Hübner ehem. Geschäftsführerin<br />
Nachbarschaftsheim Mittelhof<br />
Moderation: Ingrid Alberding<br />
Gisela Hübner: Ich arbeitete 1989 im Nachbarschaftsheim<br />
Mittelhof – der Mittelhof liegt im Süden Berlins nahe<br />
an der damaligen Grenze zu Kleinmachnow und Teltow.<br />
Als die Mauer in der Nacht vom 9. zum 10. November fi el,<br />
kam ich in den Mittelhof und sagte: jetzt müssen wir am<br />
Wochenende die Türen unseres Nachbarschaftsheimes<br />
aufhalten und in unser Nachbarschaftsheim einladen. Wir<br />
liefen auf den Teltower Damm und verteilten Einladungen<br />
in den MITTELHOF. Der Teltower Damm – bis dahin eine<br />
eher ruhige Einkaufsstrasse – war voller Menschen, die<br />
mit der S-Bahn, mit Bussen und Autos kamen. Wir öffneten<br />
unser Cafe über die gewohnten Öffnungszeiten hinaus,<br />
kochten Unmengen Kaffee, besorgten Kuchen, Zeitungen<br />
und Bücher und freuten uns über die neuen Nachbarn,<br />
die zu einem ersten kurzen Besuch vorbei kamen..<br />
Über unsere Kindertagesstätten <strong>Arbeit</strong> - wir waren gut eingebunden<br />
in die Fachgruppenarbeit Kindertagesstätten<br />
des Paritätischen - hatten einige von uns lose, mehr per-<br />
sönliche Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen zu Kitas<br />
und Schulen in Ostberlin und angrenzenden Orten.<br />
Als ich Barbara Tennstedt vom FIPP (Fortbildungsinstitut<br />
<strong>für</strong> die pädagogische Praxis) in den nächsten Wochen traf<br />
– wir hatten beide private Kontakte nach Ostberlin, weil<br />
wir dort groß geworden sind, sagten wir uns: jetzt muss<br />
etwas passieren – wir müssen mit den Kolleginnen und<br />
Kollegen aus dem anderen Teil der Stadt ins Gespräch<br />
kommen. Wie macht man das in dieser aufgeregten<br />
Zeit?<br />
Wir beschlossen eine Einladung in Ostberliner Zeitungen<br />
aufzugeben. Der Mittelhof als Veranstaltungsort bot sich<br />
an. Das Problem war zunächst, dass von uns Westberlinern<br />
keine Anzeigen in den Ostberliner Zeitungen angenommen<br />
wurden, also schalteten wir Verwandte aus dem<br />
Ostteil der Stadt ein, die das <strong>für</strong> uns taten. Anfang Januar<br />
1990 gab es in der „Berliner Zeitung“ und in der „Neuen<br />
Zeit“ folgende Anzeige: „Erziehung in beiden Berlins, Einladung<br />
zum Frühstück und zum Kennenlernen“. Wir hatten<br />
uns auf 20 bis 30 Rückmeldungen eingestellt. Was dann<br />
passierte grenzte <strong>für</strong> uns an ein Wunder. Das Telefon im<br />
Mittelhof stand nicht mehr still, körbeweise kamen Karten,<br />
Briefe und Telegramme. „Wir haben einen Kieselstein ins<br />
Wasser geworfen. Die Wellen, die dieser Stein verursacht<br />
hat, haben uns fast überrollt“, sagte Barbara Tennstedt<br />
damals auf einer der Abschlussveranstaltungen dieses<br />
großen Tages. Innerhalb von 12 Tagen nach Erscheinen<br />
der Anzeige am 13. Januar hatten sich 1300 interessierte<br />
Fachleute aus Ostberlin und der DDR zu diesem ersten<br />
Treffen, das Ende Januar an einem Sonntag stattfand,<br />
gemeldet. Um diese Zusammenkunft zu ermöglichen,<br />
die einen kongresshaften Rahmen angenommen hatte,<br />
musste schnell und völlig ohne Auftrag „von oben“ zugepackt<br />
werden. Ohne großen technischen Aufwand, durch<br />
viel Mundpropaganda, beteiligten sich MitarbeiterInnen<br />
quer durch Verbände und Behörden innerhalb, aber meist<br />
auch außerhalb ihrer <strong>Arbeit</strong>szeit an den Vorbereitungen<br />
So fand das Treffen schließlich in zwei Zehlendorfer Kirchen,<br />
einer bezirklichen Kita, einer Schule, in mehreren<br />
Eltern-Kindertagesstätten und im Nachbarschaftsheim<br />
Mittelhof statt. Es kamen Frauen und Männer aus allen<br />
Berufszweigen der Kinder- und Jugendarbeit. Kindergar-
tenpädagogen ebenso wie Lehrer der verschiedenen<br />
Schulen, AusbilderInnen, HeimerzieherInnen und Sonderpädagogen,<br />
ehrenamtliche Mitarbeiter aus kommunalen<br />
Kommissionen, einzeln und in Gruppen – aus Ostberlin<br />
und vielen Städten der DDR.<br />
Was konnte mit einem solchen Treffen erreicht werden<br />
und wie ging es weiter? In 25 <strong>Arbeit</strong>sgruppen zu den<br />
verschiedenen berufl ichen und berufsübergreifenden<br />
Schwerpunkten, wie Kindergarten- und Horterziehung,<br />
Krippenpädagogik, Heimerziehung und Alternativen<br />
hierzu, Sonderpädagogik und Integration, Aus- und Fortbildung,<br />
Jugendarbeit und Stadtteil- und Kulturarbeit,<br />
- ergaben sich viele interessante Gespräche, wobei die<br />
Teilnehmer aus der DDR manchmal feststellen mussten,<br />
wie wenig sie selbst voneinander wussten. Anschriftenlisten<br />
von Kinder- und Jugendeinrichtungen und Schulen<br />
wurden ausgetauscht. Gewünscht wurden gegenseitige<br />
Hospitationen, Patenschaften zwischen Kitas, viele<br />
wünschten sich einen Austausch über Gewerkschaftsarbeit,<br />
über unterschiedliche pädagogische Konzepte, zu<br />
Bildungsprogrammen in Ost- und West.<br />
Viele Ideen, Wünsche und Träume wurden an diesem Tag<br />
zusammengetragen. Alle waren sich einig darin, dass<br />
die Zukunft nicht auf „Einbahnstrassen“ von West nach<br />
Ost oder umgekehrt verlaufen darf. Wir aus dem Westen<br />
haben bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung eine<br />
Struktur genutzt, die wir gern als Netzwerk ansehen, d.h.<br />
eine Struktur, die nicht hierarchisch ist, sondern diejenigen<br />
miteinander verknüpft, die in irgendeiner Weise etwas<br />
ähnliches wollen. Das erste grenzübergreifende Netzwerk<br />
zu bilden, war ein Sinn der Veranstaltung, ein Netzwerk,<br />
das zum Ziel haben sollte, die Entwicklungsmöglichkeiten<br />
und Lebensbedingungen der Heranwachsenden in beiden<br />
Deutschlands zu verbessern.<br />
Im Rückblick auf die letzten zwanzig Jahre fi nde ich,<br />
dass ausgehend von dieser Veranstaltung im Mittelhof<br />
im Januar 1990 uns einiges gelungen ist. Es wurden Formen<br />
der Zusammenarbeit, des offenen fachlichen Austauschs<br />
gepfl egt, weiter verfolgt und ausgebaut. Das sage<br />
ich besonders aufgrund meiner Erfahrungen als aktive<br />
Nachbarschaftsheim-Frau.<br />
Ingrid Alberding Bleiben wir mal bei dieser Euphorie.<br />
Wir sind alle Zeitzeugen und haben extreme Gefühlswallungen<br />
erlebt. Wie war das zu dieser Zeit, begegnete man<br />
sich auf Augenhöhe? Oder gab es auf der Veranstaltung<br />
eine Atmosphäre nach dem Motto: wir Wessis wissen<br />
alles und können euch darüber berichten? Oder war das<br />
eine gegenseitige Neugier? Oder war es so, dass die Ossis<br />
hören wollten, was da ist? Gab es eine Seite, die Sendungsbewusstsein<br />
hatte?<br />
Gisela Hübner: Ich glaube, dass es lange Zeit so war, dass<br />
die Ossis mehr Fragen an uns hatten als wir an sie. In meiner<br />
Erinnerung ist es so, aber wir stellten natürlich auch<br />
Fragen. Es ging immer darum, aus den Fragen kurze Aussagen<br />
zu machen und rückzufragen, wie seht ihr das, was<br />
ist euch wichtig? Aber der Stil war schon, wir wollen es<br />
wissen, wie habt ihr es gemacht, bei euch ist es anders.<br />
Die Ossis haben uns zum Beispiel ganz viel Material mitgebracht,<br />
ich habe Kinderbücher bekommen usw. Ich<br />
kriege diese Distanz gar nicht hin, aber ich glaube, dass<br />
wir in diesen ersten Wochen und Monaten auf Augenhöhe<br />
waren. Aber <strong>für</strong> uns veränderte sich ja zunächst einmal<br />
die Welt nicht so stark. Das Ganze wurde wirklich anders<br />
zu den Zeiten, als es dann die Anpassung gab, die Anerkennungsverfahren,<br />
wo was gelernt und gemacht wird.<br />
Aber daran waren wir nur indirekt beteiligt. Ich habe zwar<br />
auch an einer Nachqualifi zierung als Dozentin teilgenommen,<br />
aber das war anders.<br />
Ingrid Alberding Wir kommen jetzt zu dem, was daraus<br />
unmittelbar entstanden ist. Ich selber habe damals mit Gunter<br />
Fleischmann als Geschäftsführerin von „Jugendwohnen<br />
im Kiez“ zusammengearbeitet. Wir haben 16 Jahre lang wunderbar<br />
zusammengearbeitet. Zu der von dir geschilderten<br />
Veranstaltung konnte ich damals nicht mitgehen. Ich erinnere<br />
mich aber wie heute, wie Gunter zurückkam und vollkommen<br />
beseelt war, unglaublich, wir haben da Leute kennen<br />
gelernt... Aber das soll er jetzt selber erzählen.<br />
Gunter Fleischmann: Die Veranstaltung war in der Tat der<br />
Startschuss. Ich war auch schon vorher in Ostberlin und<br />
Potsdam unterwegs, aber eher privater Natur.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 55
56<br />
Workshop Ost/West Begegnungen<br />
Ich saß am 9. November mit einem Freund und Kollegen<br />
vor dem Fernseher und habe Schabowski sagen hören,<br />
dass die Grenze offen ist. Was hat der gerade gesagt?<br />
Hast du das auch so gehört? Ja. Wir wohnten, da wohne<br />
ich immer noch, in der Nähe der Oberbaumbrücke und<br />
sind sofort hingegangen und haben geguckt. Tatsächlich,<br />
da kamen die Leute rüber, mit eingezogenem Kopf, weil<br />
sie der Sache nicht getraut haben. Direkt an der Oberbaumbrücke<br />
war ein Projekt von uns. Die hatten aber<br />
gerade Teamfahrt, was wir einmal im Jahr machen, dass<br />
das gesamte Team <strong>für</strong> zwei oder drei Tage irgendwo ins<br />
Grüne fährt und Fortbildung macht und gleichzeitig auch<br />
Spaß hat.<br />
Diese Fortbildungsfahrt ging am 10. November los, weil<br />
alles geplant war, sind wir mit unseren Autos auch in Richtung<br />
Helmstedt gefahren. Wir sind im Stau stecken geblieben,<br />
haben viele Stunden bis Helmstedt gebraucht, sind<br />
dann abends dort angekommen und haben gesagt: Hey,<br />
was machen wir eigentlich in Helmstedt? Das geht doch<br />
gar nicht, wir kehren wieder um, wir müssen zurück. Dann<br />
sind wir alle, 50 Mann, wieder rein in die Autos, wieder<br />
sieben Stunden im Stau gestanden, am nächsten Morgen<br />
um 5 Uhr waren wir wieder in Berlin. Und dann haben wir<br />
gesagt: so, jetzt müssen wir unser Café im Grenzbereich<br />
aufmachen, weil die da alle rüberkommen. Dann haben<br />
wir das Café aufgemacht, so viel Kaffee konnten wir gar<br />
nicht beschaffen, wie wir da hätten verkaufen können. Wir<br />
haben eine Riesenkasse mit Ostgeld gehabt, mit dem wir<br />
überhaupt nichts anfangen konnten, dann sind uns noch<br />
die Tassen geklaut worden …<br />
So war die Bewegung ganz am Anfang. Dann kam dieser<br />
Workshop, wo ich an einer <strong>Arbeit</strong>sgruppe zum Thema<br />
„Alternativen zur Heimerziehung“ teilgenommen habe.<br />
Wir waren zu der Zeit als Westberliner schon im Widerspruch<br />
zur traditionellen Heimerziehung. In der <strong>Arbeit</strong>sgruppe<br />
waren wir vielleicht 30 Leute. Und bei diesem<br />
Workshop haben wir uns dann getroffen.<br />
Siegfried Kaschke: Am 9. November habe ich den Schabowski<br />
natürlich auch gehört und gesehen. Für mich als<br />
gelernten Ossi war das gar nicht vorstellbar, ich dachte<br />
erst, es gibt da Missverständnisse in Verwaltungsge-<br />
schichten und so, bis mir langsam ein Licht aufging. Ich<br />
bin erst am 10. über die Grenze gelaufen, an der Oberbaumbrücke<br />
habe ich mich durch diese ganz kleine Tür<br />
gequält. Stundenlang haben sich die Massen über die<br />
Brücke geschoben, bis ich dann durch dieses kleine Loch<br />
nach Kreuzberg gekommen bin. Kreuzberg kannte ich<br />
noch als Kind, das waren die Zeiten, wo man ohne Mauer<br />
noch rüber konnte. Ich habe mich staunend umgeguckt,<br />
das war kaum wieder zu erkennen.<br />
Ich bin überzeugter Ossi gewesen zu dem Zeitpunkt, war<br />
in der FDJ, ich war auch SED-Mitglied, hatte dort also auch<br />
eine Karriere in einem <strong>sozial</strong>istischen Betrieb. Damals<br />
war ich mit einer jüngeren Frau zusammen, die Studentin<br />
war, sie wollte Erzieherin werden. Dann haben wir diese<br />
Annonce in der Berliner Zeitung gelesen und haben die<br />
Kollegen aus ihrer Studiengruppe informiert. Zu viert sind<br />
wir dann, also die drei aus dieser Studiengruppe und ich,<br />
zum Mittelhof. Wir sind dort hingegangen, weil uns klar<br />
war, dass es die DDR so nicht mehr geben wird, und dass<br />
Studenten, wenn sie zu Ende studieren dürfen - man<br />
wusste ja nicht, wie sich das alles entwickelt - zusehen<br />
müssen, wie sie ihre <strong>Arbeit</strong>splätze oder wie wir unsere<br />
<strong>Arbeit</strong>splätze schaffen.<br />
Ingrid Alberding Das klingt ja so, als hättet ihr zu dem<br />
Zeitpunkt, also im Januar 1990 nach nur drei Monaten,<br />
schon einen ziemlichen Weitblick gehabt oder schon<br />
erfasst, was da auf euch zukommt?<br />
Siegfried Kaschke: Wir wollten einfach was Neues<br />
machen, was auch in die Zukunft gerichtet ist.<br />
Ingrid Alberding Also es war unklar, ob die Ausbildung<br />
beendet werden kann?<br />
Siegfried Kaschke: Ja, klar. Es war einfach abzusehen,<br />
dass es die DDR alten Stils so nicht mehr geben wird.<br />
Den sogenannten Kapitalismus kannten wir ja aus dem<br />
Parteileiterunterricht, der ja auch in den Schulen schon<br />
abgehalten worden ist. Da dachten wir eigentlich, wir<br />
müssen uns auf eine neue Gesellschaftsordnung einrichten.<br />
Also wollten wir gucken, was im Bereich Erzie-
hung so läuft, weil wir ja völlig ahnungslos waren.<br />
Wir sind einfach zum Mittelhof gegangen, um was zu<br />
erfahren und Fragen zu stellen. Wir haben unterschiedliche<br />
Facetten wahrgenommen, speziell in den Jugendwohngemeinschaften<br />
als mögliche Betreuungsform. Wir<br />
dachten, das könnte ja eigentlich auch was <strong>für</strong> uns sein.<br />
Ich wusste noch aus dem Fernsehen, dass in den 80er<br />
Jahren in Kreuzberg auch viele Häuser leer gestanden<br />
hatten. Daraus waren ja damals ganz viele alternative<br />
Projekte entstanden. Die kannten wir zum Teil aus der<br />
Berliner Abendschau. Und im Ostteil der Stadt standen<br />
ja auch hunderte von Häusern leer, die wir freigeräumt<br />
haben, weil die saniert oder zum Teil auch abgerissen<br />
werden sollten. Die wollten wir wieder aufbauen. So sind<br />
wir da bekannt geworden.<br />
Wir haben damals im Mittelhof gehört was läuft, ich weiß<br />
gar nicht mehr, wie viele Fragen wir gestellt haben. Jedenfalls<br />
haben wir vier uns hinterher mit Gunter verständigt,<br />
dass wir in Kontakt bleiben wollten. Wir wollten uns in<br />
ganz kleinem Kreis zusammensetzen, um zu gucken, was<br />
da gemeinsam gehen könnte.<br />
Gunter Fleischmann: Ich sagte ja schon, wir waren ja<br />
direkt in Opposition zur traditionellen Heimerziehung<br />
und auch nicht in allen Punkten mit dem kapitalistischen<br />
Gesellschaftssystem einverstanden, insofern sind wir da<br />
mit wenig Dünkel angetreten. Wir waren nicht die klügeren<br />
Wessis gegenüber den doofen Ossis oder so, sondern wir<br />
standen in Opposition zu den traditionellen Heimen, die<br />
es damals noch in relativ großer Zahl gab.<br />
Uns schien es so, dass es bei der Kommunalen Wohnungsbau<br />
AG Freiräume gab und man da vielleicht irgendwo ein<br />
Projekt in einem der Häuser machen könnte. Insofern war<br />
das natürlich <strong>für</strong> uns auch spannend, also wir hatten ein<br />
gegenseitiges Interesse.<br />
Wir haben uns tatsächlich mehrmals getroffen. Es war<br />
schon relativ bald klar, dass diese Initiative von vier<br />
Leuten und noch einigen anderen einen Verein gründen<br />
wollte. Das war auch meine Herangehensweise, also<br />
gleiche Augenhöhe, wir wollten nicht imperialistisch<br />
vorgehen, im Gegenteil. Es bestand natürlich ein Informations-<br />
und Kompetenzgefälle, was die westdeutsche<br />
Struktur angeht, das anzugleichen hat eine ziemlich<br />
lange Zeit gebraucht. Aber zunächst zur Vereinsgründung.<br />
Siegfried Kaschke: Wir sind in uns gegangen – machen<br />
wir diesen Verein oder nicht? Wir hatten völlig uneigennützige<br />
Hilfsangebote durch „Jugendwohnen im Kiez“. Dann<br />
haben wir die Jugendlichen – im wahrsten Sinne des<br />
Wortes – zusammengekramt, da waren noch die Eltern<br />
mit dabei, damit wir diese sieben Vereinsgründer haben.<br />
Wir haben den Verein gegründet, die Vereinssatzung<br />
haben wir von „Jugendwohnen im Kiez“ abgeschrieben,<br />
nur ein bisschen umformuliert. Dann haben wir überlegt,<br />
wie wir heißen wollen: Jugendwohnen im Kiez gibt es im<br />
Westen und „Neues Wohnen im Kiez“ dann im Osten.<br />
Wir wollten diese Namensnähe haben, um die sich entwickelnde<br />
Zusammenarbeit zum Ausdruck zu bringen.<br />
Im April 1990 haben wir diesen Verein gegründet. Ich<br />
glaube sogar, dass wir der erste Verein im Ostteil der<br />
Stadt waren, der Jugendwohngemeinschaften gründen<br />
wollte. Dann haben wir uns beworben, Geld aus diesem<br />
Fond zu bekommen, der aus den SED-Kassen gespeist<br />
worden ist. Und mit einem leer stehenden Haus in Friedrichshain,<br />
wo wir ein multifunktionales Wohn-, Jugend-<br />
und Beschäftigungsprojekt reinbauen wollten, hatten wir<br />
auch Zugang zu diesen ominösen 30 Millionen, die der<br />
damalige Bausenator Nagel großzügigerweise nach Ost-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 57
58<br />
Workshop Ost/West Begegnungen<br />
berlin geben wollte. Das war natürlich ein Tropfen auf den<br />
heißen Stein. Von diesem Geld hätten wir 1,3 Millionen<br />
<strong>für</strong> unser Projekt haben können, aber der Hausbesitzer<br />
wollte mehr Geld und das Haus <strong>für</strong> 1,7 Millionen verkaufen.<br />
Damit war das geplatzt.<br />
Dann haben wir die beiden Wohngemeinschaften in Friedrichshain<br />
aufgebaut – mit Hilfe von „Jugendwohnen im<br />
Kiez“. Wir haben die pädagogischen Konzepte geschrieben,<br />
haben vier Erzieher ausgewählt, wir hatten als Verein<br />
Mühe, diese Wohnung anmieten zu dürfen. Und auf dem<br />
Weg zum Oktober 1990, als wir dann auch grünes Licht<br />
<strong>für</strong> alles bekamen, kam dann die Währungsunion.<br />
Dann war es klar, dass es keine eigenständige DDR mehr<br />
geben wird. Diese besondere Lage – Westberlin/Ostberlin<br />
– führte ja dazu, dass Ostberlin im Grunde genommen<br />
keine eigene Regierung bilden konnte, wie das in Brandenburg<br />
oder Thüringen der Fall war, sondern wir wurden<br />
der Verwaltung Westberlins unterstellt. Irgendwann war<br />
dann die Hürde überwunden, aber da gab es intern noch<br />
einen Kampf, von dem wir gar nichts wussten. Darüber<br />
berichtet Gunter.<br />
Gunter Fleischmann: Wir haben große Mühe darauf verwandt,<br />
dass die alten Projekte, also die beiden Wohngemeinschaften<br />
in Friedrichshain, eine Förderung von der<br />
Senatsverwaltung <strong>für</strong> Jugend und Familie bekommen. Die<br />
waren irgendwie blockiert, was den Geldtransfer in den<br />
Osten der Stadt anging. Das Projekt startete im Oktober,<br />
also kurz nach der Wiedervereinigung, aber der Vorlauf<br />
war ja weit vorher. Die haben sich mit Händen und Füßen<br />
gegen eine Anerkennung bzw. eine Betriebserlaubnis<br />
gewehrt. Zu der Zeit brauchte es das ja noch nicht, weil es<br />
sowieso völlig unklar war in dieser Zwischenphase, ob sie<br />
zuständig waren, aber eigentlich wollten sie schon Geld <strong>für</strong><br />
den Betrieb geben. Das fanden die überhaupt nicht lustig,<br />
dass da ein neu gegründeter Ostberliner Verein plötzlich<br />
Westgeld kriegen sollte, um dort im Osten Einrichtungen<br />
zu betreiben. Das war so quer zu ihrem Denken, dass sie<br />
das nicht über das Herz gebracht haben.<br />
Ingrid Alberding Sie wollten das Geld da<strong>für</strong> lieber uns<br />
geben. Sie wollten auch, dass dort Wohngemeinschaften<br />
entstehen, aber sie wollten nicht, dass das ein Ost-Träger<br />
macht.<br />
Gunter Fleischmann: Richtig. Dann wollten sie uns die<br />
Verwaltung des Projekts machen lassen, weil sie dadurch<br />
keinen Stress mit der Abrechnung haben würden. Sie hatten<br />
die Be<strong>für</strong>chtung, dass das Geld da irgendwo in dunklen<br />
Kanälen verschwindet und sie darauf keinen Zugriff<br />
mehr haben würden. Wir haben alles Engagement und<br />
alles Gewicht da reingelegt und an die Moral appelliert<br />
und an die deutsche Brüderlichkeit und was weiß ich<br />
alles. Irgendwann haben sie dann gesagt: okay, gut, wir<br />
probieren es mal.<br />
Als die Wiedervereinigung kam, war das schon alles eingegliedert,<br />
da hatte der Verein schon das erste eigene<br />
Geld, womit gewirtschaftet werden konnte, damit diese<br />
Projekte loslegen konnten.<br />
Ingrid Alberding Mit der Aufl age, dass wir die Vereinsmitglieder<br />
schulen.<br />
Gisela Hübner: Bei den Nachbarschaftsheimen hatten<br />
wir das ein bisschen anders. Der damalige Senatsdirektor<br />
Dietmar Freier bekam den Auftrag, die Verwaltungsumgestaltung<br />
in Ostberlin zu machen. Das machte er so ab<br />
März 1990. Er hat die Nachbarschaftsheime immer aus<br />
der Überzeugung unterstützt, dass Bürgerengagement
und ehrenamtliche <strong>Arbeit</strong>, Mittun und Gestalten wichtig<br />
seien. Die Berliner Nachbarschaftsheime wurden zu dieser<br />
Zeit von der Senatsverwaltung <strong>für</strong> Jugend gefördert,<br />
aber die rührte sich überhaupt nicht. Aber die Sozialverwaltung<br />
<strong>für</strong> Soziales war ansprechbar und organisierte<br />
Geld zur Gründung von Nachbarschaftsheimen im Ostteil<br />
der Stadt – und zwar mit den dort neu gegründeten Vereinen.<br />
Der damals erste geförderte Verein war das Frei-<br />
ZeitHaus in Weißensee.<br />
Ingrid Alberding Das ist die Verbindung zu Frank Börner.<br />
Er sollte eigentlich hier sein und selbst erzählen. Ich habe<br />
es so verstanden, dass er ein vom Senat eingesetzter<br />
Scout war – über den <strong>Verband</strong> -, der schauen sollte, welche<br />
Initiativen es in Ostberlin gab. Sieben Einrichtungen<br />
sollten gefördert werden, er sollte herausfi nden, welche<br />
dazu geeignet wären.<br />
Birgit Weber: Ja, das war so: Ich bin 1992 zum <strong>Verband</strong><br />
gekommen, als ich anfi ng sagte man mir, dass ich auch<br />
einen Mitarbeiter in Berlin habe. Das war nicht Frank Börner,<br />
sondern das war Gudrun Israel. Und Frank Börner und<br />
Gudrun Israel haben sich das so ein bisschen aufgeteilt.<br />
Frank, der offi ziell beim Landesverband in Berlin angestellt<br />
war, hatte die Aufgabe, in Ostberlin zu gucken, wo<br />
sich etwas rührt, was eventuell ein Nachbarschaftsheim<br />
werden könnte, dort erste Austauschtreffen zu organisieren,<br />
miteinander reden, mal hinfahren. Gudrun hatte die<br />
gleiche Aufgabe, aber <strong>für</strong> den Rest der ehemaligen DDR.<br />
Ingrid Alberding Die beiden waren ost-<strong>sozial</strong>isiert, das<br />
fi nde ich wichtig.<br />
Gisela Hübner: Es kamen auch Anfragen aus Osteuropa,<br />
weil die Grenzen dort ja auch brüchig wurden, insofern<br />
gab es dann die ersten großen Tagungen. Warst du da<br />
schon dabei, Torsten?<br />
Torsten Wischnewski: Die großen Tagungen habe ich<br />
nicht so erlebt, weil ich sehr viel im Inneren vom Pfefferwerk<br />
agiert habe. Aber wir sind ab März 1991 gefördert<br />
worden. Wir hatten einen Antrag gestellt, zur Begutach-<br />
tung kam dann jemand vom Senat und vorher gab es<br />
eben ein paar Gespräche mit Herbert Scherer und auch<br />
mit Frank Börner. Das kann ich nachher noch mal kurz<br />
ausführen, wie das bei uns war, weil das jetzt so weit vom<br />
Thema wegführt.<br />
Ingrid Alberding Ich fände es ganz gut, wenn Birgit gleich<br />
weiter über das Hospitations-Projekt berichtet.<br />
Birgit Weber: Im <strong>Verband</strong> gab es so eine Atmosphäre,<br />
dass da Sachen möglich sind, die sonst nicht möglich<br />
waren. Es gab schon vor dem Mauerfall offi zielle und<br />
inoffi zielle Zusammenarbeiten zwischen Ost und West,<br />
das war diesem <strong>Verband</strong> schon vertraut und hatte mit<br />
der eigenen Entstehungsgeschichte zu tun. Ähnlich wie<br />
wir dann in den Osten marschiert sind, sind ja die Amerikaner<br />
bei uns reingekommen, da gab es Parallelen, wo<br />
es einfach eine Tradition gab, mit solchen Situationen<br />
umzugehen.<br />
Wir haben Ende 1992 dann überlegt, wie sich deutschlandweit<br />
ein fachlicher <strong>sozial</strong>er Austausch zwischen Ost<br />
und West in die Wege leiten ließe. In Berlin war das relativ<br />
einfach, weil hier die Wege nicht so weit waren. Es entstand<br />
die Idee, dass man eine Bewegung organisieren<br />
müsste, die nicht nur persönlich sein kann, aber auch<br />
nicht nur fachlich, weil es die gewünschte Augenhöhe gar<br />
nicht gab. Man konnte Projekte in Berlin nicht mit Projekten<br />
in Nordrhein-Westfalen vergleichen, die hatten zu<br />
unterschiedliche Strukturen. In Nordrhein-Westfalen war<br />
damals eine ganz starke GWA-Fraktion, in Berlin eher die<br />
Nachbarschaftsarbeit, also da ging sowieso schon alles<br />
durcheinander, und dann kam der Osten noch dazu.<br />
Wie kriegen wir unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche<br />
Leute zusammen? Die Idee war, Einrichtungen zu<br />
fi nden, die bereit waren, <strong>für</strong> zwei Wochen jemanden aus<br />
einer Einrichtung aus dem Osten aufzunehmen, während<br />
gleichzeitig ein Mitarbeiter aus dem Westen da<strong>für</strong> in den<br />
Osten ging. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, auf<br />
die sich gleich über 40 Einrichtungen aus dem Westen<br />
gemeldet haben. Im Osten habe ich mit Gudrun alle<br />
Adressen abgeklappert, die wir kannten, Volkssolidarität,<br />
Senioren-Veteranen-Clubs, Umwelthäuser, die gerade drei<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 59
60<br />
Workshop Ost/West Begegnungen<br />
Wochen alt waren, also es war ganz gemischt. Wir haben<br />
gesagt, wir gucken uns alles an und was sich dann irgendwie<br />
nicht wehrt, das ist dabei. Es war einfach unmöglich,<br />
dort Standards anzulegen. Sehr gut war, dass Gudrun<br />
sehr ost-<strong>sozial</strong>isiert war und eine bessere Verbindung<br />
hatte, als wenn ich als West-Frau alleine dort hingekommen<br />
wäre. Genauso ging es auch andersrum, insofern<br />
sind wir immer als Duo aufgetaucht, was an sich schon<br />
ein Ereignis war. Teilweise musste ich Gudrun fragen, was<br />
die Leute eigentlich gesagt haben, obwohl sie ja Deutsch<br />
sprachen, aber <strong>für</strong> mich war das teilweise schwer einzuordnen.<br />
Das war unheimlich gut, wir haben uns sehr gut<br />
ergänzt und ich konnte besser mit Sachen umgehen, die<br />
ich gehört hatte.<br />
Alle die wollten haben wir zu einem gemeinsamen Seminar<br />
eingeladen. Wir kannten ja schon alle so ein bisschen<br />
über die Querkontakte, wer zu wem passte, hatten uns<br />
kleine Spickzettel gemacht, dem Peter Stawenow habe<br />
ich dann gesagt, guck dir mal Wuppertal an, und in<br />
Wuppertal habe ich gesagt, wenn da ein Herr Stawenow<br />
kommt, dann guckt ihn euch an. Das Seminar haben wir<br />
dann zu einer Art Marktplatz gemacht. Im ersten Seminar<br />
hatten wir zwei Referentenzwei, einen aus dem Westen<br />
und einen aus dem Osten. Die beiden haben das total<br />
toll gemacht, sie haben das, was war, an ihren eigenen<br />
Biographien verdeutlicht. Das hatte den großen Vorteil,<br />
dass niemand sagen konnte, so war das nicht, weil beide<br />
sagten: so habe ich das erlebt. Das war eine unheimlich<br />
gute Sache <strong>für</strong> die Diskussion und damit war an diesem<br />
Tag schon das Eis gebrochen.<br />
Dann hatten wir noch mal einen Marktplatz, wo jeder seinen<br />
Stand hatte und erzählen musste, was er macht. Der<br />
andere kam als Besucher und fragte. Nach zwei Tagen<br />
war jeder versorgt und hatte Termine ausgemacht. Wir<br />
haben dann geschaut, ob alles klappt, ob er ein Bett hat,<br />
usw. Wir hatten vom Bundesministerium Geld zur Verfügung<br />
gestellt bekommen, so dass wir auch <strong>für</strong> die Unterkunft<br />
etwas beisteuern konnten.<br />
Auf der einen Seite ist auf einer persönlichen Ebene etwas<br />
passiert, weil man miteinander viel mehr und tiefer reden<br />
konnte, weil man zwei Wochen zusammen war. Auf der<br />
fachlichen Ebene war nirgends eine 1 : 1-Übersetzung<br />
möglich, weil gerade im Osten viele Leute in einer Soziokultur<br />
gelandet waren, wo sie noch gar nicht wussten,<br />
ob sie dort überhaupt sein wollten. Sie waren sehr damit<br />
beschäftigt sich zu orientieren.<br />
Es war sehr gut, dass die Wessis nicht wussten, wie<br />
Ossi-Land funktioniert, von daher dumm waren, und die<br />
anderen waren auch dumm, also das war eine total gute<br />
Ausgangsbasis. Vor Ort war das noch besser, weil sich auf<br />
die Art eine tolle Verbindung zwischen Praxis und Theorie<br />
ergab. Ich würde sagen, diese Austausch-Projekte sollte<br />
man viel öfter machen. Und diese Märchen?, man hätte<br />
keine Zeit, irgendwo <strong>für</strong> zwei Wochen rauszukommen, das<br />
ist Quatsch. Was man da mitkriegt, das ist viel mehr als<br />
man im Studium lernen kann. Das war eine tolle Sache.<br />
TN: Wir wollten wirklich <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> machen und<br />
unsere Teilnahme am Austausch-Projekt in Bremen brachte<br />
die letzte Entscheidung, dass wir ein Nachbarschaftshaus<br />
werden wollten. Das ist im Prinzip in Bremen entschieden<br />
worden. Es war wirklich eine intensive <strong>Arbeit</strong>, das kann man<br />
sich kaum vorstellen. Es gab so unglaublich viele Ebenen,<br />
auf denen man sich begegnet ist. Und es war eine echte<br />
Neugier aufeinander. Es gab nie einen Punkt, wo man<br />
gesagt hat, du bist schlauer, du bist dümmer, gar nichts.<br />
TN: Kanntet ihr euch schon vorher?<br />
TN: Nein, gar nicht. Wir waren auf dem Markt der Möglichkeiten<br />
gewesen.<br />
Ingrid Alberding Wie waren denn die Erwartungen?<br />
TN: Wir wollten schon gucken, wie passiert Nachbarschaftsarbeit<br />
woanders, wie funktioniert das, was kann<br />
man übernehmen, was kann man vom gesetzlichen<br />
Rahmen her machen, weil das nicht vollständig klar war.<br />
Natürlich wollten wir auch gucken, wie Menschen in diesen<br />
Einrichtungen miteinander umgehen. Das war eine<br />
Erfahrung, das ist kaum zu erklären, da muss man in den<br />
Tiefen dabei gewesen sein. Diese vielen verschiedenen<br />
Veranstaltungen dort, das war einfach faszinierend. Eine<br />
Spendenhilfe <strong>für</strong> russische Kinderhäuser fand gerade
statt, auf dem Weg nach Russland sind wir dann auch wieder<br />
zu Hause abgeworfen worden. Auch solche Sachen<br />
waren toll, diese Vielfalt zu erleben, wo sich Nachbarn<br />
auch immer wirklich darum kümmern, was das Haus selber<br />
macht und was die Menschen untereinander machen,<br />
das fand ich faszinierend.<br />
Für die Bremer war es seltsam, dass wir damals alle über<br />
ABM-Gelder oder sonstige Fördertöpfe fi nanziert wurden.<br />
Ich war zu der Zeit gerade arbeitslos, das haben die Bremer<br />
überhaupt nicht verstanden, wie ich da hinfahren<br />
kann, wenn ich doch nicht arbeite und gar nicht weiß, wie<br />
es weitergeht. Ich war aber relativ optimistisch und sicher,<br />
dass es irgendwie schon weitergehen wird, weil ich das<br />
sehr gerne umsetzen wollte, was ich in Bremen gesehen<br />
habe. Also das war wirklich sehr schön.<br />
Einer der Tagungsteilnehmer, Micha aus Köln, kam mich<br />
danach besuchen. Der war völlig überrascht, als er ankam,<br />
war ausgerechnet mein Geburtstag. Dann sind wir erst<br />
mal zusammen essen gegangen unter dem Motto: wir<br />
müssen erst mal was Nettes machen. Auf seiner Seite war<br />
sehr viel Neugier, was war die Stasi, wie stehst du dazu,<br />
usw. Neben der Neugier gab es viel Bestätigung: was ihr<br />
schon auf die Beine gestellt habt, das ist faszinierend. Wir<br />
haben zu diesem Nachbarschaftstreff in Köln auch heute<br />
noch Kontakt, wenn auch sporadisch, aber wenn wir uns<br />
sehen, fi nden wir es toll.<br />
Peter Stawenow: Ich konnte auch an diesem Hospitationsprojekt<br />
teilnehmen. Ich muss Birgit Weber erst mal ein<br />
Kompliment machen, weil sie mit einfachen Worten eine<br />
komplizierte Situation dargestellt hat. Es ist nach den<br />
Berichten auch von eurer Seite deutlich geworden, dass<br />
das eine sehr spannende Zeit gewesen ist, wo jeder auch<br />
<strong>für</strong> sich selber nachgedacht hat, ob die bisher vertretenen<br />
Werte noch gültig oder relevant sind und was sich alles<br />
verändert. Die Gespräche, die durch diesen Hospitationsaustausch<br />
stattgefunden haben, haben sehr schnell<br />
dazu geführt, auf beiden Seiten Vorurteile abzubauen, was<br />
auch auf einer persönlichen Ebene stattgefunden hat. Ich<br />
hatte die Chance, mir eine der Spitzeneinrichtungen der<br />
Nachbarschaftsarbeit in Wuppertal anzuschauen. Jeder<br />
aus der Szene weiß, dass das eine Super-Einrichtung ist.<br />
Gleichzeitig haben wir das Nachbarschaftszentrum „Bürger<br />
<strong>für</strong> Bürger“ in Mitte aufgebaut und standen damit<br />
ganz am Anfang, 50 Meter Luftlinie zur Bernauer Straße,<br />
der U-Bahnhof hatte Eingänge im Osten und im Westen.<br />
Dort habe ich gemerkt, dass ich nicht nur in der <strong>Arbeit</strong><br />
am Bildungsprozess bestärkt wurde, sondern auch <strong>für</strong><br />
mich persönlich eine Menge rausgeholt habe. Das war<br />
das Wertvolle daran. Es entstanden auch wertvolle Kontakte,<br />
u.a. zum <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong>. Dort<br />
konnte ich Fragen stellen, durch die ich die Leute dort<br />
auch angeregt habe, und durch die Antworten ist mir wiederum<br />
geholfen worden, in diesem Selbstfi ndungsprozess<br />
Bestätigung zu fi nden.<br />
Gisela Hübner: Wie ernst das gemeint war, das zeigt sich<br />
zum Beispiel daran, dass Peter später Mitglied im Bundesvorstand<br />
wurde, also die Augenhöhe stimmte, die Berliner<br />
Landesgruppe hat bewusst Kollegen aus dem Osten<br />
mit eingebunden hat, was ja bis heute noch gilt.<br />
Peter Stawenow: Über die Gespräche mit Gudrun Israel<br />
will ich bestätigen, was Birgit Weber über Gudrun gesagt<br />
hat. Es tut mir immer noch weh, dass sie nicht mehr lebt<br />
und nicht mehr bei uns ist. Das war eine ganz, ganz ehrliche<br />
Frau. So wie Birgit das geschildert hat.<br />
Aber es war immer noch ein Unterschied zwischen Berlin<br />
und den neuen Bundesländern, diesen Unterschied gab<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 61
62<br />
Workshop Ost/West Begegnungen<br />
es schon zu DDR-Zeiten, zwischen Berlin und dem Rest<br />
der DDR, weil es andere Bedingungen gab. In Berlin gab<br />
es die kurzen Wege, während es in den neuen Bundesländern<br />
eine ganze Zeit dauerte, bis Finanzmittel transferiert<br />
wurden, um voranzukommen. Das war nicht unbedingt<br />
eine Frage der Konkurrenz. Sondern der Selbstfi ndungsprozess<br />
war schwerer. In den ländlichen Gebieten ist es<br />
noch komplizierter gewesen, weil sich da alle von Angesicht<br />
zu Angesicht kannten.<br />
TN: Ich fi nde es toll, wie konfl iktfrei das bei euch gelaufen<br />
ist. Bei uns im Projekt, als wir die ersten Kollegen<br />
in Ostberlin eingestellt haben, die verstanden erst mal<br />
kein Wort. Ihnen fehlte diese Fähigkeit, ein minder gutes<br />
Ergebnis wahnsinnig gut zu verkaufen. Das konnte der<br />
Westler genial. Die ersten Diskussionen und Vereinssitzungen<br />
waren sehr schwierig, also wir kamen irgendwie<br />
nicht richtig zusammen. Man kann ja auch sagen, sorry,<br />
das hat nicht richtig geklappt. Die Westler sahen ständig<br />
alles extrem positiv, egal, was das war. Und wir wussten<br />
das auch so auszudrücken. Und die Ostler saßen da: Von<br />
was redet ihr? Wir verstehen euch nicht. So locker war das<br />
auch nicht, eher kopfschüttelnd, wir haben uns teilweise<br />
nicht verstanden.<br />
Die Kritik der Ostler war: Kannst du nicht mal ganz normal<br />
über die <strong>Arbeit</strong> reden und nicht so geschwollen?<br />
Wir machen hier <strong>Arbeit</strong> mit Jugendlichen, da kann man<br />
ganz normal reden. Ich weiß, wir haben eine lange Zeit<br />
gebraucht und da war auch immer so ein Ding drin, na, nur<br />
weil ich jetzt Ostler bin, bin ich blöd, oder was? Nein, nein,<br />
natürlich nicht. Also da schwang schon immer unter den<br />
Worten was mit, wo wir uns ganz schnell raufen mussten.<br />
Bis wir sagen konnten: Hey, jetzt entspannt euch mal, jetzt<br />
reden wir mal auf einer Augenhöhe. Aber in der Anfangszeit<br />
von 1992 bis 1995 gab es viele Missverständnisse<br />
dabei, auch verbale.<br />
TN: Es gab eine richtig unterschiedliche Sprache.<br />
TN: Völlig unterschiedliche Sprachen, nicht nur die Wörter<br />
an sich, auch der Habitus dabei, wie wir Realität darstellten,<br />
das wurde dann nur mit Kopfnicken quittiert.<br />
Elke Ostwaldt: Ich bin von Outreach, Mobile Jugendarbeit.<br />
Dirk und ich sind von Anfang an mit dabei, also seit 1992<br />
sind wir bei dem Projekt. Ich habe die erste Zeit in Schöneberg<br />
gearbeitet, 1996 bin ich dann in den Osten nach<br />
Altglienicke gegangen. Ich hatte das große Glück, Übersetzer<br />
und Übersetzerinnen zu fi nden, weil man wirklich keine<br />
gemeinsame Sprache hatte. Die eine Übersetzerin war <strong>für</strong><br />
mich Hella, mit der wir sehr eng zusammengearbeitet<br />
haben. Ich habe in Altglienicke in einem kleinen Container<br />
mit Jugendlichen Jugendarbeit gemacht. Wenn ich Unterstützung<br />
und Übersetzungshilfe brauchte, dann hat Hella<br />
mir sehr geholfen, wir haben uns sehr gut ausgetauscht.<br />
Der andere Übersetzer war ein junger Kollege, Steffen<br />
Kindscher. Wir haben oft zusammen gesessen und Steffen<br />
hat erzählt, wie er die DDR erlebt hat, während ich erzählt<br />
habe, wie ich in Kreuzberg lebe. So haben wir uns gegenseitig<br />
immer ausgetauscht. Er hat mir die ganzen Fachbegriffe<br />
in der DDR erklärt, die ich überhaupt nicht kannte.<br />
Dirk hat schon recht, es war zuerst keine Begegnung auf<br />
Augenhöhe. Aber jetzt mit Miriam bestimmt. Miriam und<br />
ich haben in Köpenick eine sehr gute Zusammenarbeit,<br />
wir moderieren mittlerweile Fachveranstaltungen zusammen.<br />
Ich glaube, da ist ein sehr gutes Netzwerk entstanden,<br />
aus der praktischen <strong>Arbeit</strong> heraus und obwohl wir so<br />
weit entfernt voneinander sind. Aber Hella kann vielleicht<br />
auch noch was dazu sagen.
Hella Pergande: Damals hätte ich das nicht gedacht, aber<br />
im Nachhinein denke ich, wir waren auf gleicher Augenhöhe,<br />
weil wirklich beide Seiten von einander gelernt<br />
haben. Aber als wir damals in der Situation waren, da war<br />
es schon so, dass wir uns auch ein bisschen über die Wessis<br />
lustig gemacht haben: Schön aufpassen und zuhören,<br />
die haben Kohle, die wollen wir auch. Aber heute würde<br />
ich behaupten: Doch, alle haben von unserer Zusammenarbeit<br />
profi tiert, gerade durch solche Reibereien.<br />
Vielleicht bin ich auch schon zu sehr Wessi und höre es<br />
nicht mehr, aber ich glaube, die Sprache ist <strong>für</strong> mich als<br />
Ossi ehrlicher geworden, wenn ich jetzt mit einem Kollege<br />
rede. Das ist nicht mehr dieses „alles so toll“, sondern<br />
es geht irgendwie mehr um reale Schwierigkeiten und<br />
Lösungswege.<br />
TN: Ich fi nde, das Reden von der Unsicherheit wird etwas<br />
überstrapaziert. Wir haben uns ja an das System rangerobbt,<br />
was im Westen selbstverständlich war, <strong>für</strong> uns<br />
aber was ganz Neues, wir haben die gleiche Augenhöhe<br />
einfach übertrieben. Ich erinnere mich, als ich 1995 eingestiegen<br />
bin, da hat mir meine Vorgängerin gesagt: Also<br />
sie mache das so, wenn sie was wissen will, dann ruft sie<br />
Herbert Scherer an und sagt ihm, dass sie so lange am<br />
Telefon sitzen bleibt, bis sie das begriffen hat, um was es<br />
geht. Das zeigt ja, wie schwierig das auch war, bestimmte<br />
Dinge zu verstehen und überhaupt auf gleiche Augenhöhe<br />
zu kommen.<br />
Torsten Wischnewski: Ich will noch einen anderen Aspekt<br />
reinbringen zu dem Thema, wie quasi das Pfefferwerk entstanden<br />
ist, weil das eine andere Dynamik hatte. Aber<br />
vielleicht später dazu.<br />
Gunter Fleischmann: Es gab eine Art gleicher Augenhöhe,<br />
auf der persönlichen Ebene. Also ich habe es so empfunden,<br />
dass es gegenseitigen Respekt gab und auch ein<br />
Interesse daran, Dinge zu erfahren, zu fragen: Wie war es<br />
eigentlich bei euch? Auf der Ebene der <strong>Arbeit</strong>sperspektive<br />
auch, denn wir wollten ja gerne mit da<strong>für</strong> sorgen, dass im<br />
Osten ein ähnlicher Verein wie unserer entsteht. Das war<br />
<strong>für</strong> uns ein Anliegen, weil wir dachten, dass Alternativen<br />
zur Heimerziehung etwas Gutes sind. Wir wollten auch<br />
gerne, dass diese verrotteten Ostheime bald ein Ende<br />
haben. Das war also die gleiche Perspektive auf beiden<br />
Seiten. Dadurch, dass die anderen aus dem Lehrerinstitut<br />
kamen und jung waren, war es so, was die Kompetenzen,<br />
sich in dem System zu bewegen, anging, gab es keine gleichen<br />
Partner auf Augenhöhe. Da waren wir diejenigen, die<br />
wussten wie es geht, und die anderen waren doof, also so<br />
war das einfach. Wir haben die beherbergt <strong>für</strong> zwei Jahre,<br />
weil sie auch keine Kohle hatten, also auch da waren sie<br />
nicht auf gleicher Augenhöhe. In unserem Büro haben sie<br />
einen Schreibtisch und ein Telefon gekriegt und konnten<br />
da sitzen.<br />
Dann kam die Phase der Pubertät, sage ich mal, wo die<br />
sich abgelöst haben. Da hat es dann auch ein bisschen<br />
geknirscht und wurde kurzfristig etwas unangenehm.<br />
Dann sind sie in ein eigenes Büro umgezogen und hatten<br />
ihren eigenen Verein, eigenes Geld, usw. und wir sind<br />
nach wie vor freundlich verbunden, die Namensnähe ist<br />
sowieso da, die können wir auch nicht mehr ändern, wir<br />
treffen uns auch. Beide Vereine haben sich eigenständig<br />
weiterentwickelt – mit der Voraussetzung, dass wir verabredet<br />
haben, dass „Neues Wohnen im Kiez“ die Ostbezirke<br />
bedient und „Jugendwohnen im Kiez“ die Westbezirke.<br />
Damit war Konkurrenz ausgeschaltet. Inzwischen<br />
haben die doppelt so viele Mitarbeiter wie wir, insofern<br />
ist die Augenhöhe kein Problem mehr.<br />
Aber es gibt nach wie vor ein großes gegenseitiges Interesse<br />
und ich weiß, ich kann immer den Geschäftsführer<br />
von euch anrufen, kriege alle Interna von ihm, wenn er bei<br />
mir anruft, dann kriegt er auch alle Interna. Insofern ist<br />
das ein engeres Verhältnis als zu einem anderen Träger<br />
– und das ist geblieben. Das speist sich natürlich aus der<br />
gemeinsamen Geschichte.<br />
Torsten Wischnewski: Ich will einen persönlichen Aspekt<br />
reinbringen und einen organisatorischen Aspekt. Pfefferwerk<br />
ist als Initiative um einen Ort, nämlich um den Pfefferberg,<br />
entstanden. Ich bin seit September oder Oktober<br />
1990 dabei, da gab es im Haus der Talente eine ominöse<br />
Sitzung mit 200 Leuten, alle Kettenraucher, so ein Bild<br />
habe ich davon. Diese Menschenmasse versuchte dar-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 63
64<br />
Workshop Ost/West Begegnungen<br />
über zu diskutieren, wie man diese alte Brauerei im<br />
Prenzlauer Berg retten und zu einem Kulturzentrum oder<br />
sozio-<strong>kulturelle</strong>n Zentrum mit kleingewerblichen Aspekten<br />
machen kann.<br />
Glücklicherweise bin ich dann mit einer der damaligen<br />
Protagonistinnen, Karin Ludwig, ins Gespräch gekommen.<br />
Sie kam auf mich zu und meinte, sie hätte mich noch nie<br />
gesehen und fragte wo ich herkomme. Ich sagte, dass ich<br />
bei einem kleinen Bildungsverein in Westberlin bin und<br />
wir hätten uns überlegt, dass wir gerne eine Jugendbildungsstätte<br />
eröffnen würden. Und wenn, dann jetzt, und<br />
am liebsten in einem Fabrikzusammenhang, und dass wir<br />
von befreundeten Künstlern aus Kreuzberg gehört haben,<br />
wir müssten zum Pfefferberg, weil da das Leben ist. Zwischen<br />
Kreuzberg und Prenzlauer Berg gab es eine ganze<br />
Menge Austausch.<br />
Meine persönliche Situation: Ich war 25, klarer Antikapitalist<br />
mit <strong>sozial</strong>istischer Prägung. Kurz vor dem November<br />
1990 war ich als Student in Dänemark auf einer<br />
Fortbildung zum Thema „Heimvolkshochschule in Dänemark,<br />
Zweiter Bildungsweg, Möglichkeiten zum Nachholen<br />
von Schulabschlüssen“. Die dänischen Sozialisten<br />
fragten uns nun als Studenten: Erklärt uns doch mal wie<br />
es in Deutschland weitergehen wird. Mir war gar nicht<br />
wohl dabei, dass diese Kraft der friedlichen Revolution<br />
die Mauer durchbricht und quasi ein Großdeutschland<br />
erwächst mit allen schlimmen geschichtlichen Aspekten,<br />
die es ja schon zweimal gegeben hatte. Ich war damals<br />
politisch sehr engagiert, aber auch in gewerblichen<br />
Zusammenhängen, war in einem <strong>Arbeit</strong>s-Kollektiv aktiv,<br />
war bei dem ersten linken Privatsender Radio 100 aktiv,<br />
ein Bürgerradio.<br />
Ich war äußerst distanziert, habe mich dann ab und zu<br />
im Roten Rathaus am Runden Tisch wieder gefunden, wo<br />
Leute darüber sinniert haben, wie die DDR gerettet werden<br />
kann. Da habe ich mich auch nicht sehr wohl gefühlt. Noch<br />
ein persönlicher Aspekt davor: Ich war seit 1987 nicht mehr<br />
in die DDR gereist. Ich hatte vorher immer freundschaftliche<br />
Beziehungen nach Magdeburg und Halberstadt gehabt.<br />
Irgendwann war das vorbei, warum auch immer, ich kam<br />
nicht mehr über die Grenze und konnte nicht mehr einreisen.<br />
Von daher war ich äußerst distanziert.<br />
Aber mit meinem Kollegen aus dem Berliner <strong>Arbeit</strong>skreis<br />
<strong>für</strong> politische Bildung sind wir dann gucken gegangen<br />
und bei den Pfefferberg-Aktivisten gelandet. Im Herbst<br />
1990 waren dort unheimlich viele Theaterschaffende,<br />
Bildhauer, Pantomimen, bunt gemischt. Aus diesem<br />
Kreis heraus gab es einen Kern von zehn Protagonisten,<br />
die einfach einen Verein im September 1990 gründeten,<br />
die Vereinsgründung fand in einer Eckkneipe statt.<br />
Und seitdem bin ich dem Pfefferwerk immer verbunden<br />
gewesen. Diese Auseinandersetzung zwischen Ossis<br />
und Wessis hat tatsächlich auch stattgefunden, aber<br />
eigentlich aus meiner Perspektive erst ein Jahr später,<br />
also Ende 1991 und 1992, und zwar im Vereinsvorstand.<br />
Diese Auseinandersetzung wurde sehr heftig<br />
und intensiv geführt, weil der Verein Pfefferberg e.V.,<br />
wo auch das Nachbarschaftshaus damals gefördert<br />
wurde, nur Ost-Protagonisten hatte, ich war der Einzige,<br />
der west-<strong>sozial</strong>isiert war. Ich war aber ab 1991 einer der<br />
Geschäftsführer in der Pfefferberg Stadtkultur gGmbH<br />
und habe da auch jugendlich und fröhlich mitgewirkt,<br />
das Ganze voranzubringen. Es gab tatsächlich intern<br />
einen Konfl ikt darüber, wie viel West soll es eigentlich<br />
in Prenzlauer Berg geben oder wie viel Ost ist in dieser<br />
Initiative zu erhalten? Das war kurz, aber heftig. Es<br />
war dann aber auch beendet, weil Prenzlauer Berg als<br />
Treffpunkt immer sehr offen war und immer neue Leute<br />
kamen, die neue Veranstaltungen machten.<br />
Von daher gab es bei uns nicht die Situation, dass schon<br />
jemand Bescheid weiß, wie es funktioniert, sondern die<br />
Leute haben es gemeinschaftlich gelernt. Mein Vorteil<br />
war, dass ich die Strukturen in Westberlin kannte, ich<br />
wusste, zu wem man gehen musste, um Rat zu holen,<br />
oder was in einem Antrag stehen musste, um einen<br />
Antrag durchzukriegen. Das war ein ziemlich großer<br />
Vorteil. Wir haben es sehr lange so gehalten, dass wir<br />
selbst als Pfefferwerk eine Institution waren, um Dinge<br />
zu ermöglichen. Ich habe mich nur in der Rolle gesehen,<br />
zu sagen, wie man bestimmte Dinge ermöglichen<br />
kann.<br />
So haben wir relativ lange agiert, bis diese ganze ABM-<br />
und SAM-Soße richtig losging, so ab 1992 oder 1993/4.<br />
Da haben wir uns dann bewusst entschieden, als Träger
der Jugendhilfe aufzutreten, mit Jugendarbeit, später<br />
Kindertagesstätte, das erzieherische Hilfen, da hat es<br />
mehr die Richtung von denjenigen gegeben, die intern<br />
die Protagonisten gewesen sind. Das hat einen anderen<br />
Zusammenhang als bei anderen Projekten.<br />
Ingrid Alberding Es ist noch einmal ein eigenes Thema,<br />
auf diesen Beschäftigungsteil einzugehen. Welche Instrumente<br />
sind damals verwendet worden? Welche Auswirkungen<br />
hatten die? Wie haben sie es ermöglicht,<br />
Strukturen zu schaffen oder auch zu zerschlagen? Aber<br />
ich wollte Elke noch mal die Gelegenheit geben.<br />
Elke Ostwaldt: Ich war damals in der Umweltbewegung<br />
und wir hatten eine ABM-Stelle im Anti-Atom-Büro im<br />
Ökodorf in Westberlin. Ab dem 10. November kamen<br />
immer ganz viele, die sich Informationsmaterial besorgt<br />
haben. Wir haben Päckchen gepackt mit allem was wir<br />
hatten. Vorher war ja das Unglück im Atomkraftwerk<br />
Tschernobyl und wir wollten den Kindern von Tschernobyl<br />
helfen. Damals gab es in Ostberlin war das Neue<br />
Forum, die haben einen ähnlichen Verein gegründet.<br />
Wir waren basisdemokratisch, offen <strong>für</strong> alle. Wir haben<br />
dann Kontakt aufgenommen und sind auch eingeladen<br />
worden. Als wir kamen, waren wir vollkommen irritiert,<br />
weil wir überhaupt nicht verstanden haben, was da<br />
ablief. Das war ganz anders als bei uns. Wir wurden<br />
vorgelassen, durften unser Anliegen vortragen. Dann<br />
wurden wir wieder rausgeschickt vor die Tür und sie<br />
haben ohne uns diskutiert. Wir fühlten uns da vollkommen<br />
ausgeschlossen, weil das eine ganz andere Art der<br />
Kommunikation war. Das werde ich nie vergessen.<br />
TN: Nach der Wende kamen viele Amtsleiter aus dem<br />
Westen in den Osten, weil damals Amtsleiter auch die<br />
Treppe hoch gefallen sind, also dieses ganze Heer von<br />
Leuten, das ging nicht ohne Blessuren ab. Dann bekamen<br />
die Bezirksämter neue Strukturen und wie das<br />
alles zukünftig funktionieren sollte. Da hat sich jeder<br />
natürlich einen Kopf gemacht, wo er in diesem System<br />
dann bleibt. Natürlich auch die Hoffnung gehabt, so,<br />
jetzt werden auch wir mal Einfl uss auf das Geschehen<br />
haben. Und solche Hoffnungen erfüllten sich dann häufi<br />
g nicht. Das Zusammenwachsen auf der Verwaltungsebene<br />
war und ist bis heute ganz schön schwierig.<br />
Ingrid Alberding Was ich heute mitnehme, ist, dass es im<br />
Bereich der Nachbarschaftsheime doch eher leicht ging,<br />
jedenfalls klingt es so. Es scheint so, als ob es sehr darauf<br />
ankam, ob man in der Verwaltung Förderer oder Gegner<br />
<strong>für</strong> seine Projekte hatte.<br />
TN: Zumindest bei dem Hospitations-Projekt war es ein<br />
Zusammenarbeiten. Einfach mal irgendwo hinfahren und<br />
gucken, dann wieder zurück, das ist etwas anderes, als<br />
wirklich zusammen zu arbeiten. Es wurde ja auch immer<br />
wieder vorbereitend diskutiert, was wir machen, wenn die<br />
Mauer wieder geschlossen würde. Es gab die Idee, dass<br />
dann alle Nachbarschaftshäuser zu Schlafstätten umgewandelt<br />
würden.<br />
TN: Das Hospitations-Projekt lief über zwei Jahre.<br />
Ingrid Alberding Zwei Jahre, da ist auch Zeit, um Alltagsprobleme<br />
und Konfl ikte zu produzieren. Und offensichtlich<br />
hat es trotzdem geklappt. Ich danke allen.<br />
Gisela Hübner: Hat es geklappt oder hat es nicht geklappt?<br />
Dass Nachbarschaftsheime in Deutschland und in Berlin<br />
Hilfe von außen bekommen haben, das hatte Geschichte,<br />
an die man sich nach der Wende noch mal erinnert hat.<br />
Wir haben über diese Geschichte erneut nachgedacht,<br />
über so wundervolle Worte wie Toleranz und gegenseitige<br />
Achtung und Offenheit <strong>für</strong> Andersartigkeit. Wir mussten<br />
anfangen, das auch zu leben.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 65
Input:<br />
Workshop<br />
Moderation: Tanja Ries<br />
Kultur-Botschaften<br />
Sozial-Kultur begegnet Sozio-Kultur<br />
Eva Bittner und Eva-Maria Täuber<br />
Theater der Erfahrungen<br />
Renate Wilkening (Nachbarschafts- und<br />
Selbsthilfezentrum in der ufafabrik)<br />
Margret Staal Bundesvereinigung sozio-<strong>kulturelle</strong>r Zentren<br />
Tanja Ries: Wir wollen schauen, ob diese traditionellen<br />
Zuordnungen von sozio-<strong>kulturelle</strong>r <strong>Arbeit</strong> und <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>r<br />
<strong>Arbeit</strong> noch stimmen. Wo berühren sie sich? Wo gibt<br />
es klare Abgrenzungen? Dient in der <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n<br />
<strong>Arbeit</strong> die Kunst nur dem Sozialen? Wie sieht das auf der<br />
<strong>Verband</strong>sebene und in den Einrichtungen aus?<br />
Es gibt drei Inputs: Es starten Eva Bittner und Eva-Maria<br />
Täubert vom Theater der Erfahrungen, das zum Nachbarschaftsheim<br />
Schöneberg gehört.<br />
Es folgt Renate Wilkening vom Nachbarschafts- und<br />
Selbsthilfezentrum in der Ufa-Fabrik, dort verbindet man<br />
das Soziale mit der Kultur.<br />
Danach hören wir Margret Staal von der Bundesvereinigung<br />
sozio-<strong>kulturelle</strong>r Zentren, die auch über deren Entwicklung<br />
etwas sagen kann.<br />
Eva Bittner: Ich hatte am Anfang ziemlich Mühe mit den<br />
Begriffen sozio-kulturell und <strong>sozial</strong>-kulturell. Ich fand,<br />
diese Begriffe sind schwierig zu benutzen, weil ich den<br />
Unterschied nicht so richtig sah. Dann habe ich mir aber<br />
erklären lassen, dass die Sozio-Kultur mit dem Denken<br />
eher bei der Kulturarbeit anfängt, während die <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> eher bei der Sozialarbeit anfängt und die<br />
Kulturarbeit mit einbezieht.<br />
Eva-Maria Täubert: Als Eva mich mit diesem Thema konfrontierte,<br />
dachte ich darüber nach, wie es damals eigentlich<br />
genau war. Wir hatten ja eigentlich gar nicht (so recht)<br />
die Wahl der Entscheidung, die war relativ zufällig. Kurz<br />
nach der Wende haben sich im Osten unheimlich viele<br />
Vereine gegründet. Diese Vereine haben sich häufi g in der<br />
Nachfolge der Kulturhäuser installiert. Waren die Vereine<br />
umweltorientiert, dann wurde das eine eher umweltorientierte<br />
Szenerie. Wenn es – wie in Grünau – ein ausgemachter<br />
Kulturverein war, dann wurde es ein Treff mit<br />
starkem <strong>kulturelle</strong>n Akzent. Das barg allerdings in Grünau<br />
von Anfang an ein paar Probleme in sich, weil dieser Verein<br />
fast elitär kulturell war. Die Vereinsvorsitzende wollte<br />
ein Ausstellungshaus aufmachen. Dazu muss man sagen,<br />
das Bürgerhaus Grünau war ein Stasi-Haus gewesen, in<br />
dem eine Abhörzentrale war, speziell <strong>für</strong> Stefan Heym, der<br />
um die Ecke in Grünau wohnte.<br />
Der Verein hatte teilweise wendeorientierte Mitglieder, sie<br />
besetzten mehr oder weniger das Bürgerhaus bzw. die<br />
alte Stasi-Höhle und da sollte nun was passieren, erst mal<br />
kulturell orientiert. Mit Sozialarbeit und Sozialarbeitern<br />
brachte man das nicht in Verbindung. Die Personalstruktur<br />
wurde mit ABM-Kräften aufgebaut. Und was war zu<br />
diesem Zeitpunkt an Mitarbeitern mit Qualität zu haben?<br />
Medienmitarbeiter, Schauspieler, Dramaturgen, Musiker,<br />
alle die, die in den frühen 90er Jahren abgewickelt wurden.<br />
Das führte auch dazu, dass sehr viele Zentren im<br />
Osten bzw. in Ostberlin einen stark <strong>kulturelle</strong>n Akzent<br />
hatten. Aber das Anliegen, das sich dann im Laufe der<br />
Jahre entwickelte, war dem der <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n <strong>Arbeit</strong>,<br />
die ich dann in der Wolke kennen gelernt habe, doch<br />
sehr ähnlich: Gruppenarbeit, Selbsthilfegruppen waren<br />
unheimlich wichtig bei der <strong>Arbeit</strong>slosigkeit, die sich ausbreitete;<br />
Kinderangebote und Kultur <strong>für</strong> Leute, die sich<br />
das, was in der City oder im Zentrum läuft, gar nicht mehr<br />
leisten konnten. So etwas drängte immer mehr in den Vor-
dergrund. Dieses sozio-<strong>kulturelle</strong> Zentrum hat sich trotz<br />
stärkster <strong>kulturelle</strong>r Akzentuierung dem, was wir unter<br />
<strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>r <strong>Arbeit</strong> verstehen, sehr angenähert, die<br />
Unterschiede sind gar nicht so groß.<br />
Eva Bittner: Das Theater der Erfahrungen geht jetzt in das<br />
30. Jahr, also das gab es schon zehn Jahre vor der Wende.<br />
Ich glaube, wir machen von der Herkunft her eine <strong>sozial</strong><strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> im Kleinen. Johanna Kaiser und ich haben<br />
das gemeinsam aufgebaut. Johanna ist Diplom-Sozialpädagogin<br />
und ich komme aus den Theaterwissenschaften,<br />
wir haben uns in der Mitte getroffen, aber völlig ohne<br />
Begriffe, also eher aus der Praxis heraus. Wir dachten,<br />
es sei eine großartige Idee, mit Laien Theater zu entwickeln.<br />
Ich denke bis heute, dass es so gut funktioniert, weil<br />
beides gleichgewichtig ist. Es ist Sozialarbeit, aber es ist<br />
auch Kulturarbeit, auf beides legen wir Wert, sowohl auf<br />
den Prozess als auch auf das Produkt, das dabei herauskommt.<br />
Der Begriff „<strong>sozial</strong>-kulturell“ sagt uns was <strong>für</strong> die<br />
Praxis, aber ich würde daraus keine Theorie machen.<br />
Eva-Maria Täubert: Das Theater der Erfahrungen hat ein<br />
Wahnsinns-Ergebnis, wenn es in ein Pfl egeheim kommt.<br />
Da ist nicht unbedingt das dankbarste Publikum, weil<br />
die Leute teilweise schon halb weggetreten sind. Aber<br />
wir machen viel mit Musik, man merkt, dass dann doch<br />
jemand wippt oder summt, was wirklich sehr bewegend<br />
ist. Es kommt nicht annähernd die Resonanz wie wenn wir<br />
vor einem generationenübergreifenden Publikum spielen,<br />
aber es gibt einem sehr viel, weil es Sinn macht, denn<br />
diese Menschen haben kaum noch Abwechslung. Solche<br />
<strong>kulturelle</strong>n Aktivitäten bringen diesem Publikum Freude,<br />
was eine wunderschöne Aufgabe ist.<br />
Renate Wilkening: Wir haben eine enge Verbindung zum<br />
Theater der Erfahrungen. Ich bin vom Nachbarschaftsheim<br />
der Ufa-Fabrik. Für uns hat sich die Frage <strong>sozial</strong>kulturell<br />
oder sozio-kulturell überhaupt nicht gestellt, also<br />
diese Begriffl ichkeiten waren uns ziemlich egal.<br />
Die Ufa-Fabrik ist 1979 besetzt worden und heißt so, weil<br />
sie auf einem 18.000 qm großen Gelände im Westteil<br />
Berlins am Teltowkanal liegt, das in den 20er Jahren das<br />
Kopierwerk von den Universal-Filmstudios aus Babelsberg<br />
beherbergte. Die Gebäude, die wir dort haben, sind<br />
alle aus den 20er Jahren. Wir haben dort auch ein Premierenkino<br />
vorgefunden, wo den Sponsoren Filme gezeigt<br />
wurden. Die Ufa hatte das aufgegeben und ihr Kopierwerk<br />
woanders hin verlegt, das Gelände lag brach. Die<br />
Post hat es gekauft, konnte aber damit dann doch nichts<br />
anfangen und hat es an den Senat verkaufen wollen. Der<br />
unterschriftsreife Vertrag lag beim Notar am 9. Juni 1979.<br />
Und die Ufa-Kommunarden, die vorher schon einen Verein<br />
<strong>für</strong> Kunst, Kultur und Handwerk hatten, haben sich dieses<br />
Gelände über eine Besetzung friedlich angeeignet. Das<br />
erklärte Ziel war – und ist es heute immer noch -, miteinander<br />
zu leben, miteinander zu arbeiten, miteinander<br />
Kunst und Kultur zu machen, das aber nicht nur <strong>für</strong>einander<br />
zu machen, sondern auch nach außen zu geben.<br />
Wer immer Lust hat, soll kommen, egal welchen Alters,<br />
das Gelände entdecken, nehmt euch Raum, wenn ihr den<br />
braucht und sofern wir ihn haben. Ich selber war bei der<br />
Besetzung nicht mit dabei, aber ich habe die Geschichte<br />
von Anfang an verfolgt.<br />
Zuerst wurden sehr viele Räume instand gesetzt und es<br />
wurde ein Zirkus gegründet, wo alle Kommunarden und<br />
Kommunardinnen ihre eigenen Talente entdeckt haben<br />
und – ähnlich wie beim Theater der Erfahrungen – sich<br />
viele, viele Jahre artistisch und musikalisch ausgebildet<br />
haben, um hinterher Zirkusnummern vom Feinsten hinzulegen,<br />
was auch <strong>für</strong> ein Publikum jeder Couleur etwas<br />
war.<br />
Insofern war die Kultur ein ganz großer Schwerpunkt. Aber<br />
die andere Seite war das <strong>sozial</strong>e Miteinander. Das war von<br />
Anfang an ein Schwerpunkt, wenn man miteinander lebt,<br />
dann möchte man auch <strong>sozial</strong> miteinander leben, Konfl<br />
ikte gemeinsam im Konsens lösen. Es gab und gibt in der<br />
Kommune Menschen, denen ging es etwas besser, weil<br />
sie von Papa und Mama mit fi nanziellem Background gut<br />
ausgestattet waren, manche dagegen überhaupt nicht,<br />
manche waren allein erziehende Mütter, also die ganze<br />
Bandbreite der <strong>kulturelle</strong>n und <strong>sozial</strong>en Gesellschaft war<br />
und ist dort vertreten. Die <strong>sozial</strong>e Komponente wurde<br />
sowohl im Zusammenleben als auch in der Gründungsphase<br />
des Nachbarschaftszentrums verstärkt.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 67
68<br />
Workshop Kultur-Botschaften<br />
Dann gab es Zeiten, in denen im Westteil der Stadt Geld<br />
<strong>für</strong> Selbsthilfearbeit bezahlt wurde. Es kam ein Senator<br />
in die Ufa-Fabrik, seine Kinder waren vom Kinderzirkus<br />
begeistert, in dem die Ufa-Fabrik junge Artisten ausbildet.<br />
Er war so begeistert, dass er meinte, man müsste das<br />
in Form gießen, damit der Senat uns eine Finanzierung<br />
geben kann. Wir sagten, dass wir darüber nachdenken<br />
müssen, weil Finanzierung bedeutet, dass man die Unabhängigkeit<br />
verliert.<br />
Wir haben acht Jahre ohne einen staatlichen Pfennig<br />
gearbeitet. Aber dann haben wir uns entschieden, das<br />
Geld vom Gesundheitssenator <strong>für</strong> die Selbsthilfearbeit<br />
anzunehmen. Da<strong>für</strong> haben wir mit sieben Frauen einen<br />
Verein gegründet und gesagt: so, dieser Verein ist das<br />
Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der Ufa-<br />
Fabrik. Da machen wir Freizeitangebote, da machen wir<br />
Kunst und Kultur, wir machen u.a. auch Karate und Aikido<br />
und andere Bewegungs-Künste.<br />
Es kamen ganz viele junge Frauen zu uns, die schwanger<br />
waren oder Kinder hatten. Die wollten Gruppen <strong>für</strong> sich,<br />
Müttergruppen, Schwangerengruppen, sie brauchten<br />
plötzlich aber auch <strong>sozial</strong>e Beratung. Dann haben wir<br />
selbstverständlich geguckt, wo wir Experten fi nden, ob wir<br />
sie vielleicht im eigenen Haus haben, und so ist das organisch<br />
gewachsen. So kam die <strong>sozial</strong>e Komponente dazu.<br />
Ich selber bin von Haus aus Bankerin und Sozialpädagogin<br />
und hatte auch Ahnung von <strong>sozial</strong>er Beratung.<br />
Es gab zwei Verbände, die auf uns zukamen, nämlich<br />
die Bundesvereinigung sozio-<strong>kulturelle</strong>r Zentren und<br />
der <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong>. Beide meinten,<br />
dass wir zu ihnen gehören und ihnen beitreten sollten.<br />
Wir hatten uns das angeschaut und uns <strong>für</strong> den <strong>Verband</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> entschieden, weil uns<br />
die <strong>sozial</strong>e <strong>Arbeit</strong> genauso wichtig ist wie die <strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>. Deswegen sind wir in einem <strong>Verband</strong> gut aufgehoben,<br />
der den Boden schafft, die <strong>kulturelle</strong> und <strong>sozial</strong>e<br />
<strong>Arbeit</strong> miteinander zu verbinden. Das machen wir heute<br />
nach wie vor.<br />
Wir sind mittlerweile ein international anerkanntes<br />
<strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>s Zentrum. Wir haben vier Bühnen, auf<br />
denen Comedy und Variété gespielt werden, auch das<br />
Theater der Erfahrungen ist dort zuerst vor 30 Jahren<br />
aufgetreten und wird wieder bei uns auftreten und<br />
Geburtstag feiern. Unter den vier Bühnen befi ndet sich<br />
eine Open-Air-Bühne, auf der Künstler aus der ganzen<br />
Welt auftreten, wir haben eine Samba-Band, Terra Brasilis,<br />
und auch eine Jugend-Samba-Band, die Tebras.<br />
Zwei ganz aktive junge Leute, die in Brasilien waren,<br />
haben im Sommer dieses Jahres brasilianische Jugendliche<br />
hergeholt, die Capoeira machen, die haben sich in<br />
einem Workshop zusammengefunden und haben uns<br />
dann eine wundervolle Vorstellung in unserem Variété<br />
gegeben. Also auch diese Komponente gibt es bei uns.<br />
Außerdem haben wir einen Kinderbauernhof, ein großes<br />
Restaurant und einen Laden.<br />
Heute sagen wir, dass wir nicht nur Kultur und Soziales<br />
miteinander verbinden, sondern auch Bildung. Wir<br />
haben eine Freie Schule, auch Pfl ege, auch Wirtschaft,<br />
also wir sind auch ein ökonomischer Betrieb. Mittlerweile<br />
ist es so, dass wir nicht nur auf dem Gelände vertreten<br />
sind, sondern in ganz Tempelhof-Schöneberg. Wir<br />
sind Träger mehrerer Kindertagesstätten, wir sind Träger<br />
mehrerer Offener Ganztagsbetriebe an Schulen, wir<br />
sind Träger von diversen Nachbarschaftstreffpunkten<br />
und von zwei Kinder- und Jugend-Clubs in der Stadt.<br />
TN: Wenn dort Programme von Gaby Decker oder anderen<br />
Comedians laufen, die bei euch auftreten, kommt<br />
das genauso aus eurer <strong>Arbeit</strong>? Ich habe gedacht, es sind<br />
zwei verschiedene Sachen, das Theater, das bewirtschaftet<br />
und organisiert wird, und das Nachbarschafts- und<br />
Selbsthilfe-Zentrum.<br />
Renate Wilkening: Das ist ein bisschen so. Früher gab<br />
es einen einzigen Verein und der hieß Ufa e.V., sonst gab<br />
es nichts. Mittlerweile gibt es den Ufa e.V., der macht<br />
die Grundstücksverwaltung, die ja rasant gewachsen<br />
ist. Dann gibt es das IKC, das Internationale Kultur Centrum,<br />
das <strong>für</strong> die Konsumkultur zuständig ist, wie wir<br />
das nennen. Artisten oder Comedy-Künstler kommen,<br />
und es fi nden Veranstaltungen statt, das IKC organisiert<br />
komplett den Kulturbetrieb auf der Bühne. Dann<br />
gibt es das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum,<br />
wir organisieren den <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n Bereich. Wenn
wir Jugendbands organisieren oder alles, was Leute<br />
selber machen wollen, ob Kunst oder Kultur, ob die<br />
einen Trommelworkshop machen oder tanzen wollen,<br />
egal, das wird vom Nachbarschaftszentrum organisiert,<br />
einem eigenständigen Verein. Wir haben eine GmbH,<br />
die macht die Bäckerei und den Laden. Wir haben<br />
einen individuellen Wirtschaftsbetrieb, das ist das Restaurant.<br />
Das hat die Rechtsform einer GbR. Das wird<br />
privatwirtschaftlich betrieben. Der Betreiber muss entsprechend<br />
Miete zahlen. Dann haben wir noch Netdays,<br />
das ist der Punkt Bildung, die organisieren die ganzen<br />
PC-Geschichten, auch das ist ein eigener e.V.<br />
Wir organisieren uns so, dass wir einmal in der Woche<br />
zusammensitzen, alle Häuptlinge, und da beratschlagen<br />
wir, was an großen Dingen ansteht. Wir reden da nicht<br />
über einzelne Gruppen, sondern darüber, ob es Schwierigkeiten<br />
gegeben hat und wie wir die lösen können, ob<br />
wir ein Leitsystem machen, oder wer was wie wann baut,<br />
wir geben uns Tipps, wo man Geld bekommt und welche<br />
Konzepte man machen muss. Das ist unser Gremium.<br />
Dann gibt es noch die 30 Menschen aus den 70er Jahren,<br />
die dort leben. Mit Nachwuchs jetzt auch intergenerativ,<br />
die jüngste Bewohnerin ist ein Jahr alt, unser ältestes<br />
Mitglied war 96, ist aber inzwischen verstorben. Gott<br />
hab ihn selig. Er hat aber ein gutes Leben gehabt.<br />
Ich wollte nur die Bandbreite schildern. Wir haben mehrere<br />
Generationen, wobei die Jugendlichen sich erst mal<br />
von ihren Eltern und der Ufa-Fabrik trennen und ausziehen,<br />
aber nach ein paar Jahren kommen sie wieder.<br />
Margret Staal: Ich bin als Vertreterin der Bundesvereinigung<br />
sozio-<strong>kulturelle</strong>r Zentren hier. Ich bin schon lange<br />
Mitglied in diesem <strong>Verband</strong> und habe 1986 ein sozio<strong>kulturelle</strong>s<br />
Zentrum im Westerwald aufgebaut. Wir haben<br />
uns damals zunächst an dem <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> in Nordrhein-Westfalen orientiert, da es in<br />
Rheinland-Pfalz Sozio-Kultur als <strong>Verband</strong> noch nicht gab.<br />
Irgendwann hatten wir den Eindruck, dass wir da nicht<br />
ganz richtig sind, weil sie dort mehr engagiert <strong>für</strong> Nachbarschaftsheime<br />
und Sozialarbeit waren, während unser<br />
Fokus ein anderer war.<br />
Wir haben gerade bei 35 sozio-<strong>kulturelle</strong>n Zentren eine<br />
bundesweite Befragung gemacht, in der ging es u.a.<br />
darum, ob sie ein Leitbild haben und was die Gründe<br />
da<strong>für</strong> sind. Da ist mir deutlich geworden, dass ein wichtiges<br />
Anliegen ist, Raum zu bieten <strong>für</strong> eine Kultur, die in<br />
anderen Häusern keinen Platz hat oder nicht vorkommt.<br />
Man will also den Kulturbegriff verändern. In den 70er<br />
Jahren war der Hintergrund, dass es Kultur nicht nur als<br />
Oper oder Orchester oder in den Theatern geben sollte,<br />
sondern auch ganz woanders, dass Kultur ganz kleinräumig<br />
sein kann. Kleinkunst ist der Begriff, der mit Sozio-<br />
Kultur verbunden ist. Da<strong>für</strong> Räume zu schaffen, da<strong>für</strong> die<br />
Möglichkeiten zu schaffen. Damit sie wachsen und stattfi<br />
nden kann, sind die Zentren vielfach auch von Künstlern<br />
gegründet worden. Ein ganz wichtiger Grund war auch,<br />
Kultur <strong>für</strong> alle zu machen, Kultur auch vor Ort, Kultur auf<br />
den Straßen und Plätzen anzubieten. In den 70er Jahren<br />
war das Thema, heute ist das teilweise Mainstream, das<br />
fi ndet heute überall statt, also auch die Theater gehen<br />
auf die Straße oder in andere Räume, was eben vor 30<br />
Jahren nicht so war.<br />
Ich habe auch in den Zentren gefragt, die erst 1989 oder<br />
1991 gegründet wurden, die aber nach wie vor diesen<br />
Schwerpunkt haben, Raum <strong>für</strong> die Kultur zu geben. Es<br />
gibt das eine oder andere Zentrum, das eher in den<br />
Jugendhilfe-Bereich reingeht oder ganz dezidiert Bildung<br />
und Integration zum Thema hat, wo Kultur eben auch mit<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 69
70<br />
Workshop Kultur-Botschaften<br />
dabei ist. Den Kulturbegriff anders zu defi nieren, Kultur<br />
zu demokratisieren, wirklich allen zugänglich zu machen,<br />
unter dem Motto von Joseph Beuys „Jeder Mensch ist<br />
ein Künstler“, daran wird in vielen unserer Zentren gearbeitet.<br />
Dennoch gibt es eben Zentren, zum Beispiel den<br />
Schlachthof in Kassel, der noch zu einem Drittel diese Kulturarbeit<br />
hat, aber zu zwei Dritteln <strong>sozial</strong>e <strong>Arbeit</strong> macht,<br />
Schuldnerberatung, Fallmanagement, Migrationsarbeit<br />
usw. In den Interviews gibt es auch Äußerungen, dass<br />
sie dann eben irgendwann auf die Nachbarschaftsarbeit<br />
gekommen sind.<br />
Häufi g sind es Hausbesetzer, die Fabrikhallen oder sonst<br />
was besetzt haben, wo ein wichtiger Punkt Basisdemokratie<br />
und Selbstverwaltung war. Die gibt es heute nicht<br />
mehr überall, mittlerweile ist in vielen Häusern auch<br />
eine Hierarchie entstanden. Geblieben ist aber eine<br />
hohe Identifi kation der Leute, die mitarbeiten, sowie ein<br />
großes Bestreben, gemeinsam Dinge zu entscheiden und<br />
zu entwickeln. Ein wichtiger Begriff ist Nutzerorientierung,<br />
wodurch sich Zentren sehr unterschiedlich verändern. Je<br />
nachdem, an welchem Ort sich die <strong>Arbeit</strong> entwickelt hat,<br />
liegen die Schwerpunkte im Literaturbereich, Theaterbereich,<br />
mehr bei Kindern und Jugendlichen usw.<br />
TN: In der Ufa-Fabrik trifft man sich einmal in der Woche.<br />
Wie viele Personen nehmen daran teil?<br />
Renate Wilkening: Zwölf. Aber das ist kein geheimer Zirkel,<br />
denn jeder weiß, wo und wann das Treffen stattfi ndet.<br />
Von denen, die dort leben, kann jeder, der daran interessiert<br />
ist, teilnehmen, also manchmal sitzen dann auch 25<br />
Leute in dem Raum. Das ist offen, aber <strong>für</strong> die Häuptlinge<br />
ist das Treffen verbindlich.<br />
TN: Wie viele Personen insgesamt sind dort ehrenamtlich<br />
und hauptamtlich tätig? Oder kann man das nicht<br />
trennen?<br />
Renate Wilkening: Doch. Wir haben im Nachbarschaftszentrum<br />
200 fest angestellte Mitarbeiter, 95 Ehrenamtliche<br />
und 102 freie Honorarkräfte.<br />
Herbert Scherer: Das klingt jetzt, als wären die Mitarbeiter<br />
alle in der Ufa-Fabrik, aber es geht auch um all die Kindertagesstätten<br />
und die Einrichtungen, die außerhalb des<br />
Geländes sind. Aber wie viele sind es auf dem Gelände<br />
der Ufa-Fabrik im Nachbarschaftszentrum? Ist die Verwaltung<br />
auch dabei?<br />
Renate Wilkening: Ja, unsere Verwaltung ist auch dabei.<br />
Wir haben eine relativ schlanke Verwaltung, zwei Kolleginnen<br />
in der Personalverwaltung, eine Finanzbuchhalterin,<br />
einen Bilanzbuchhalter, eine Kita-Verwalterin und<br />
mich, plus drei Assistentinnen, die noch Öffentlichkeitsarbeit<br />
und andere Sachen machen.<br />
TN: Für diese Größenordnung ist das wenig.<br />
Eva Bittner: Wir sind gar kein sozio-<strong>kulturelle</strong>s oder <strong>sozial</strong><strong>kulturelle</strong>s<br />
Zentrum, wir sind ein Teilbereich des Nachbarschaftsheims<br />
Schöneberg. Das Nachbarschaftsheim hat<br />
800 Mitarbeiter, ebenso viele ehrenamtliche Mitarbeiter.<br />
Wir sind ein Mini-Unternehmen. Zur Zeit werden wir <strong>für</strong> ein<br />
größeres Projekt zusätzlich aus Europa-Mitteln gefördert<br />
und stehen deswegen etwas besser da.<br />
Ralf Jonas: Den Unterschied zwischen <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>m<br />
und sozio-<strong>kulturelle</strong>m Zentrum könnte man auch so<br />
benennen/defi nieren, dass sozio-<strong>kulturelle</strong> Zentren<br />
eher Veranstaltungszentren sind, während in <strong>sozial</strong><strong>kulturelle</strong>n<br />
Zentren eher Gruppenarbeit oder offene Angebote<br />
stattfi nden. Das wäre ein Unterscheidungsmerkmal<br />
<strong>für</strong> mich. Dann geht es vielleicht auch um die Qualität von<br />
künstlerischer <strong>Arbeit</strong>. Wir gelten ja als <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>s<br />
Zentrum, dann wurde gesagt: ihr seid ja eigentlich kein<br />
<strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>s Zentrum, sondern eher ein sozio-<strong>kulturelle</strong>s<br />
Zentrum. Wo ist da eigentlich der Unterschied? Aber<br />
es scheint Unterscheidungsmerkmale zu geben, was die<br />
Qualität der künstlerischen <strong>Arbeit</strong> betrifft und ob man Veranstaltungszentrum<br />
ist oder ein Ort, an dem Gruppenarbeit<br />
oder offene Angebote stattfi nden. Ist das richtig?<br />
Margret Staal: Für mich ist es eher der Entstehungshintergrund<br />
und welche Entwicklung es dann nimmt. Das
ist oft unterschiedlich, weil sich die Entstehungsarbeit<br />
nach der Region richtet, welchen ungedeckten Bedarf<br />
es dort gibt. Die sozio-<strong>kulturelle</strong>n Zentren sind eher daraus<br />
entstanden, dass etwas im Bereich Kultur oder Bildung<br />
gefehlt hat und nicht, weil man dort einen Nachbarschaftstreff<br />
machen wollte. Das ist ein wesentlicher<br />
Punkt. Mittlerweile sehen sich manche Zentren genötigt,<br />
zum Beispiel Diskos u.a. Konsumkultur zu organisieren,<br />
um andere Veranstaltungen zu fi nanzieren, während der<br />
Bereich der eigenen Kreativität ganz in den Hintergrund<br />
getreten ist, weil der nicht zu fi nanzieren ist.<br />
TN: Aber wenn tatsächlich die Qualität der Kulturprodukte<br />
den Unterschied ausmachen würde, wäre das <strong>für</strong> uns<br />
sehr schmerzhaft.<br />
TN: Das ist ja nur eine Frage oder eine Vermutung gewesen.<br />
Ralf Jonas: Ich habe das manchmal bei Gesprächen<br />
gespürt. Es gibt ja auch einen sozio-<strong>kulturelle</strong>n <strong>Verband</strong><br />
in Bremen, wenn ich da nur gesagt habe, dass ich aus<br />
dem Bürgerhaus komme, dann habe ich gemerkt, dass<br />
ich sofort in die Schublade Makramee gepackt worden<br />
bin. Kulturelle Qualität wurde von uns gar nicht erwartet.<br />
TN: Ich will Sie unterstützen. Wir sind in Brandenburg Mitglied<br />
in beiden Verbänden. Von der Methodik und dem,<br />
was die Zentren anbieten, sind sie häufi g sehr vergleichbar.<br />
Aber bei uns im Haus machen wir eine ganz biedere<br />
Kultur. Da hängen nette Bilder, hier fi nden klassische<br />
Konzerte statt. Wir haben überhaupt nicht den Anspruch,<br />
innovative Kultur zu machen. Viele sozio-<strong>kulturelle</strong> Zentren<br />
haben ja diesen Anspruch, dass sie Räume <strong>für</strong> Künstler<br />
öffnen, die etwas Neues machen, die am Puls der Zeit<br />
sind, und zwar so weit voraus, dass sie in den Hochkultur-<br />
Orten noch keinen Raum fi nden. Wir haben hier das, was<br />
schon vor 20 Jahren angesagt war. Aber das ist das, was<br />
Kreativität möglich macht, weil es in die Breite geht.<br />
Herbert Scherer: Gucken, wo was fehlt, das ist ganz wichtig,<br />
um Entstehungsgeschichten zu verstehen, aber dann<br />
auch das weitere Geschehen aufmerksam zu beobach-<br />
ten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tatsache, dass<br />
die Sozio-Kultur es zumindest in Berlin sehr schwer hatte,<br />
in Gang zu kommen, damit zu tun hatte, dass es da <strong>für</strong><br />
Szene-Kultur jede Menge Orte gab und gibt, da brauchte<br />
man das nicht. Anderswo, zum Beispiel in der Provinz, gibt<br />
es das nicht, weshalb es dort ein Bedürfnis nach Raum<br />
<strong>für</strong> Besonderes gab. Damit ist die Nähe zur alternativen<br />
Kunst-Szene auch ein Teil des Selbstverständnisses. Die<br />
Leitideen, wie weit steuern sie das Alltagsgeschehen?<br />
Gibt es da Grenzen? Ich glaube, die Grenzen sind <strong>für</strong><br />
unsere beiden Verbände schon unterschiedlich.<br />
Margret Staal: Unsere Ideen sind sicher an dem Punkt<br />
aus der Jugendzentrumsbewegung gespeist worden, wo<br />
es darum ging, selber zu bestimmen, was in den sozio-<strong>kulturelle</strong>n<br />
Zentren stattfi ndet, die inhaltlichen Themen auch<br />
selber kreieren zu wollen, das war die eine Bewegung. Die<br />
andere Bewegung ist ganz klar aus dem künstlerischen<br />
und <strong>kulturelle</strong>n Bereich, dass Orte gesucht wurden, wo<br />
Leute andere Formen von Theater, Tanz oder Musik unterbringen<br />
konnten, weshalb sie auch alte Hallen oder sonst<br />
was besetzt haben.<br />
Ich glaube, es gibt eine Bandbreite von unterschiedlichen<br />
Zentren, in denen die Leitlinien ein Stück vermischt werden,<br />
die sich aber trotzdem in der Sozio-Kultur beheimatet<br />
fühlen, weil sie z.B. auch Kultur mit inter<strong>kulturelle</strong>m<br />
Schwerpunkt machen - und trotzdem mehr ein Nachbarschaftshaus<br />
als ein Kulturzentrum sind. Manchmal sind<br />
die Schwierigkeiten der Abgrenzung auf Landes- oder<br />
Bundesebene größer als vor Ort in den Zentren selber.<br />
Was ich wichtig fi nde, ist, dass in den Landesverbänden<br />
und auch im Bundesverband die Diskussion mehr darum<br />
geht, Räume <strong>für</strong> eine andere Formen von <strong>kulturelle</strong>r <strong>Arbeit</strong><br />
zu schaffen als sie bis dato und zum Teil ja noch in den<br />
Gruppen vor Ort stattfi ndet. Da ein anderes Denken und<br />
auch ein anderes kulturpolitisches Konzept anzuschieben,<br />
darin liegt der Unterschied.<br />
Die Nachbarschaftsheime sagen, dass Nachbarschaftszentren<br />
offen <strong>für</strong> alle sind, auch <strong>für</strong> alle Sorten von Angeboten,<br />
egal, ob kulturell oder bildungsmäßig, ob es mit<br />
Alten oder Kindern zu tun hat, ob es <strong>sozial</strong>e Beratung<br />
ist oder <strong>sozial</strong>e Treffpunkte, Gruppen, Tauschringe usw.,<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 71
72<br />
Workshop Kultur-Botschaften<br />
die Bandbreite ist da größer. Ansonsten sind manche<br />
Dinge identisch, weil – das ist <strong>für</strong> mich eigentlich der<br />
wesentlichste Punkt – das was fehlt, von den Menschen<br />
angepackt wird und sie sich den Raum da<strong>für</strong> nehmen.<br />
Für unseren <strong>Verband</strong> sehe ich die Aufgabe, das überall<br />
zu unterstützen, wo Menschen ein Bürgerhaus, Stadtteilzentrum,<br />
Nachbarschaftszentrum wollen, die offen sein<br />
wollen <strong>für</strong> alle Leute, die die Möglichkeiten und den Ort<br />
bieten, dass Menschen eigenverantwortlich – ein ganz<br />
wichtiger Punkt, in dem wir uns wieder ganz nah sind –<br />
ihre Dinge machen können, ob das Kultur ist oder andere<br />
Dinge, die <strong>für</strong> sie wichtig sind.<br />
Eva-Maria Täubert: Ich habe nach wie vor mit der Unterscheidung<br />
sozio-kulturell und <strong>sozial</strong>-kulturell Schwierigkeiten,<br />
weil ich denke, dass das Umfeld bestimmt, mit<br />
welchen Inhalten das jeweilige Projekt wächst. Dann ist<br />
es doch ziemlich egal, wie das Kind heißt. Ich habe sechs<br />
Jahre in einem sozio-<strong>kulturelle</strong>n Projekt gearbeitet, das<br />
war echt nicht innovativ, sondern sehr bieder.<br />
Wenn wir dort z.B. ungewohnte Musik an den Mann bringen<br />
oder kreative Gruppen aufbauen wollten, sind wir<br />
in der Regel an einer weit gehenden Interessenlosigkeit<br />
der Umgebung gescheitert. Wir haben schöne klassische<br />
Konzerte gemacht, die gibt es immer noch, Dixieland, eine<br />
schöne Schreibgruppe, die ihre Erfahrungen auswertete<br />
und die Kinder haben gebastelt, also kulturell orientiert,<br />
aber kulturell innovativ kann man das nicht nennen. Ich<br />
fi nde, dass das bei unserem „Theater der Erfahrungen“,<br />
das ja eigentlich dem <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n Bereich zugeordnet<br />
ist, anders läuft: Fast alle Stücke, die die Gruppen<br />
dieses Theaters spielen, sind selber entwickelt, in ihrer<br />
Form ganz unterschiedlich, zum Teil wirklich ziemlich<br />
schräg, also das ist zukunftsweisender, auch in der Seniorenarbeit,<br />
als das schöne, bürgerliche, sozio-<strong>kulturelle</strong><br />
Projekt in Grünau.<br />
Margret Staal: Man kann es schlecht auf ein einzelnes<br />
Zentrum beziehen. Der Innovationspreis Soziokultur<br />
2009 ging an die Ländliche Akademie Krummhörn ganz<br />
oben im Nordwesten, <strong>für</strong> das Projekt „Sturmfl ut 1509“.<br />
Dazu gehörte auch ein Theaterstück mit 120 Leuten aus<br />
19 Dörfern der Region. Der Hintergrund <strong>für</strong> diese Initiative<br />
war, in diese ländliche Region hinein Kulturarbeit zu<br />
transportieren, weil außer dem heimischen Chor vielleicht<br />
nichts stattfi ndet. Das ist sicher auch nicht ohne Befremden<br />
abgegangen, aber es bewegt sich dann doch was.<br />
Ich habe, wie gesagt, auch in einer ländlichen Region, 50<br />
Kilometer entfernt von jeder größeren Stadt, Kulturarbeit<br />
bzw. Kleinkunst aufgebaut. Das war auch erst befremdlich.<br />
Aber mittlerweile ist es salonfähig und an allen Ecken<br />
und Enden vertreten. Ich denke, so ein Theaterprojekt ist<br />
genauso gut in einem sozio-<strong>kulturelle</strong>n Zentrum möglich.<br />
Gerade hatten wir im Dreiländereck zwischen Saarland,<br />
Rheinland-Pfalz und der wallonischen Region in Belgien<br />
eine Sitzung zum Thema Sozio-Kultur. Dort stellte sich<br />
heraus, dass das Saarland Sozio-Kultur in zwei Strängen<br />
betrachtet, nämlich einmal, die <strong>sozial</strong>e <strong>Arbeit</strong> mit Kultur<br />
zu betreiben, andererseits auf der <strong>kulturelle</strong>n Ebene,<br />
Kultur <strong>für</strong> alle und die Möglichkeit zur Kreativität <strong>für</strong> alle<br />
zu bieten, was jeweils vom Sozialhaushalt oder vom Kulturhaushalt<br />
fi nanziert wird. In Belgien und in Wallonien<br />
geht es ganz klar auch in Richtung Kulturarbeit und um<br />
Demokratisierung durch Kulturarbeit und Bildungsarbeit,<br />
nämlich um den emanzipierten Bürger, also die Erwachsenenbildung<br />
und Jugendbildung zu formen.<br />
Tanja Ries: Es kam jetzt auf, dass wir alle doch ähnlich<br />
sind. Ich sehe allerdings doch einen ganz großen Unter-
schied. In der sozio-<strong>kulturelle</strong>n <strong>Arbeit</strong> wird Raum <strong>für</strong> Kultur<br />
geboten. Da werden Künstler gebucht oder Kunstgruppen<br />
machen was, während in der <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n <strong>Arbeit</strong><br />
mit Menschen, ob sie Künstler, Bäcker oder Rentner sind,<br />
Kultur erarbeitet wird, wo also die Kultur im Prozess entsteht.<br />
Und zu der Qualitätsfrage: Wenn ihr <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> macht, passiert es euch nicht manchmal, dass es<br />
heißt: na ja, das ist ja bestimmt ganz schön, wenn da mit<br />
Laien gearbeitet wird, man kann das mal angucken, weil<br />
es spannend ist, aber man erwartet jetzt nicht gleich ein<br />
hohes Niveau? Mir geht es so, wenn ich mit Jugendlichen<br />
arbeite: Das Publikum geht nicht davon aus, dass es ein<br />
hohes Niveau geboten bekommt, sondern die Leute fi nden<br />
es toll, dass da überhaupt was gemacht wird.<br />
Eva Bittner: Ich habe im Moment eine kleine Identitätskrise,<br />
weil ich überall zuzuordnen bin, auch in der Tüte<br />
Sozio-Kultur fühle ich mich total zu Hause. Die Startbedingungen<br />
vom Theater der Erfahrungen waren wirklich<br />
eine Abgrenzung von der Hochkultur. Wir wollten einen<br />
anderen Kulturbegriff, mehr die Kultur der kleinen Leute,<br />
Kultur von unten, Kultur von Leuten, die sonst nie gehört<br />
werden, also mit Älteren, die sonst nicht vorkommen. Das<br />
war der Anfang der Geschichte. Dadurch, dass wir beim<br />
Nachbarschaftsheim Schöneberg willkommen waren, das<br />
uns fest an seine Brust gedrückt hat, ist natürlich auch<br />
eine kleine Verschiebung in manchen Ecken passiert, die<br />
ja auch zum Guten des Projektes ist. Aber inhaltlich ist<br />
es im Bereich der <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n <strong>Arbeit</strong> so, dass man<br />
sagen könnte: Kulturarbeit ist manchmal die bessere<br />
Sozialarbeit. Sie hat diese <strong>sozial</strong>e Komponente eher. Das<br />
stimmt <strong>für</strong> uns auch.<br />
Alles, was hier gesagt wird, kann ich durchaus zusammenbinden<br />
mit dem, was wir tun. Was du sagtest, stimmt<br />
leider auch, dass die Qualitätsfrage an uns immer wieder<br />
gestellt wird und wir garantiert <strong>für</strong> die <strong>Arbeit</strong>, die wir tun,<br />
nie vom Kultursenat gefördert werden würden. Das ist<br />
auch wahr. Nur versuchen wir durch die Produkte, das ein<br />
Stück weit zu unterlaufen, und ich glaube, es gelingt uns<br />
auch sogar, weil der Anspruch an uns so gering ist. Die<br />
Leute denken erst mal, kann ja nichts werden, also die<br />
Anspruchshaltung ist relativ niedrig. Dann kann man sie<br />
gut beeindrucken mit dem, was man tatsächlich tut. Ob<br />
das <strong>für</strong> alle Bereiche gilt, das würde ich gerne als Frage<br />
in den Raum stellen. Ob es stimmt, dass die Sozialarbeit,<br />
die mit kulturpädagogischem Handwerkszeug arbeitet,<br />
notwendigerweise ein schlechteres Ergebnis bringt?<br />
Herbert Scherer: Wir haben vorhin vom kulturpolitischen<br />
Selbstverständnis der Sozio-Kultur gesprochen. Du hast<br />
jetzt einen ganz wichtigen Satz gesagt: der Kultursenat<br />
würde das nicht fördern. Ich glaube, das ist das größte<br />
Verdienst der Sozio-Kultur, dass sie es geschafft hat, <strong>für</strong><br />
<strong>sozial</strong>e <strong>kulturelle</strong> Projekte eine Bresche geschlagen zu<br />
haben. Das haben wir in Berlin nicht geschafft.<br />
Es ist nicht nur das Selbstverständnis wichtig, sondern<br />
auch die Frage: vor welchem Geldgeber muss ich mich<br />
mit dem, was ich tue, rechtfertigen? Unsere Kollegen<br />
müssen sich vor dem Ressort Soziales rechtfertigen und<br />
das Kulturelle auch <strong>sozial</strong> begründen. Wenn sie anfangen<br />
würden, sich vor dem Kultursenat zu rechtfertigen, hätten<br />
sie bei der arroganten Berliner Kulturpolitik keine große<br />
Chance. Da kommt man gerade noch mit Kleinkunst rein,<br />
aber dann ist auch schon Schluss.<br />
Renate Wilkening: Bei der Ufa-Fabrik ist es so, dass wir<br />
natürlich auch vom Kultursenat gefördert werden, und<br />
zwar mit erheblich größeren Summen als vom Sozialsenat,<br />
aber das Geld geht ganz klar nur in die Kulturschiene.<br />
Wir haben durch unsere Größe, durch unsere Besonderheit<br />
und durch das, was wir machen, beide Senatsförderungen.<br />
Ich sagte ja schon, dass ein großer Teil der Projekte<br />
auf unserem Gelände schwerpunktmäßig aus der<br />
Kultur gefördert wird, nur ein Teil aus dem Sozialbereich.<br />
Margret Staal: Ich beobachte das gerade in einem anderen<br />
Bereich: die BKJ als Bundesvereinigung <strong>kulturelle</strong><br />
Kinder- und Jugendbildung wird ja aus dem Jugendministerium<br />
gefördert. Im Grunde genommen machen sie<br />
<strong>kulturelle</strong> Bildungsarbeit, das könnte man genauso gut<br />
in die Kultur packen, weil der Anspruch in die Richtung<br />
geht. Jetzt hat die Enquête-Kommission gesagt: es gibt<br />
die Bundeszentrale <strong>für</strong> politische Bildung, und so soll es<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 73
74<br />
Workshop Kultur-Botschaften<br />
auch eine Zentrale <strong>für</strong> die <strong>kulturelle</strong> Bildung geben, die<br />
aber dann aus dem Kulturhaushalt bezahlt werden soll.<br />
Im Bereich <strong>kulturelle</strong>r Bildung passiert ganz viel Kultur,<br />
und es ist eigentlich völlig egal, ob die aus dem Jugendministerium<br />
oder aus dem Kulturministerium gefördert<br />
wird. Bei dem Ansatz, den wir in der Sozio-Kultur hatten,<br />
die Kultur in die Breite zu tragen und zu vertreten, dass<br />
Kultur nicht nur als Hochkultur stattfi ndet, sondern ganz<br />
viel mehr ist, da ist sicher etwas dabei, was in die <strong>kulturelle</strong><br />
Förderung muss.<br />
Ich habe draußen ein paar Infodienste und Zeitschriften<br />
liegen, Anfang des Jahres hieß eine Zeitschrift Mainstream<br />
Sozio-Kultur, weil ganz viele Inhalte und ganz viele<br />
Dinge, die Sozio-Kultur riskiert und probiert hat, an vielen<br />
Stellen heute glücklich etabliert sind. Im Grunde macht<br />
die Sozio-Kultur mit ihren Formaten das, was heute zum<br />
Teil auch Theater oder Orchester machen. Es entstehen<br />
immer wieder neue Entwicklungen, die sind vielleicht nur<br />
nicht mehr so spektakulär wie vor 30 Jahren, als das Theater<br />
auf die Straße geholt wurde.<br />
Ralf Jonas: Das Problem ist nicht die Vielfältigkeit der Häuser,<br />
sondern das Denken in Ressorts. Man wird gezwungen,<br />
sich irgendwie zu defi nieren. Wir bekommen eine<br />
Förderung vom Kultursenat, dann bekommen wir auch<br />
eine Nebenförderung von Soziales, neuerdings auch noch<br />
eine Nebenförderung von Bildung, <strong>kulturelle</strong>r Bildung,<br />
von den Etats der Schulen usw. Das ist eine Unmenge an<br />
<strong>Arbeit</strong>, die wir in die unterschiedlichen Ansprüche der verschiedenen<br />
Ressorts stecken. Für die Bürgerhäuser ergibt<br />
diese Aufspaltung teilweise überhaupt keinen Sinn.<br />
TN: Ich fand die Frage von Herbert Scherer spannend,<br />
wie weit diese Leitideen und auch die historisch gewachsenen<br />
Hintergründe der Einrichtungen die Praxis dann<br />
auch mitbestimmen oder ungeschriebene Grenzen vorgeben.<br />
Wir waren zum Beispiel auch in der Situation,<br />
dass wir uns entscheiden mussten, von der Theaterpädagogik<br />
kommend, in der Praxis beides machend, Kultur<br />
und <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong>. Wir haben uns entschieden,<br />
dass wir ein Mehrgenerationenhaus sind und auch in den<br />
<strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> gehen. Aber da gab es<br />
Widerstände bei einigen Kollegen, die stärker von der Kulturarbeit<br />
kamen und ein bisschen erschrocken waren, ob<br />
wir mit dem Schritt unsere Kulturarbeit aufgeben würden.<br />
Das hat sich dann alles relativiert, weil sich natürlich in<br />
der Praxis Soziales und Kulturelles vermischt haben und<br />
die Kollegen merkten, dass sie das auch weiter machen<br />
können. Diese Hürden gibt es aber manchmal.<br />
Margret Staal: Diese Diskussionen fi nden natürlich statt,<br />
auch weil jetzt ein Generationenwechsel stattfi ndet. In<br />
relativ kleinen Häusern haben sich Leute zusammengetan,<br />
<strong>für</strong> die ist ihre Einrichtung ihr Wohnzimmer, das<br />
belebt wurde. Und das jetzt anders zu öffnen, <strong>für</strong> eine<br />
jüngere Generation und eine andere, jüngere <strong>kulturelle</strong><br />
Bewegung, dazu gibt es jetzt neue Diskussionen.<br />
Tanja Ries: Ich würde gerne auf die inhaltliche Frage<br />
zurückkommen, ob denn in der Qualität oder von den<br />
Inhalten her wirklich ein Unterschied beschreibbar ist,<br />
also einer, der uns weiterhilft, sonst könnten wir den<br />
Begriff ja auch einfach nicht mehr benutzen und sagen,<br />
das ist eins.<br />
Herbert Scherer: Man kann das ganz einfach machen:<br />
Man übersetzt es ins Französische, dann übersetzt man<br />
es zurück ins Deutsche und das Problem ist gelöst, weil im<br />
Französischen heißt alles socio-culturel, da ist das Sozial-<br />
Kulturelle und das Sozio-Kulturelle in einem Begriff.<br />
Tanja Ries: Zum Beispiel dieses Theater Thikwa, das mit<br />
Profi s und Behinderten gemeinsam arbeitet: das ist vom<br />
Kulturprodukt her sicher was Neues, Schräges, Fremdes<br />
und vom Ergebnis her sicher auch etwas ganz anderes als<br />
das, was von „ganz normalen“ Schauspielern erarbeitet<br />
und entwickelt wird. Aber es ist auch ein Projekt mit <strong>sozial</strong>en<br />
Komponenten. Ich wollte nur die Frage stellen, ob<br />
sich das an den Inhalten besser beschreiben lässt?<br />
TN: Wenn man trennen will, dann kann man das an den<br />
Grenzen jeweils machen. Wie weit gehen jeweils die Verbände?<br />
Wenn ich mir die Sozio-Kultur-Mitgliedschaft angucke,<br />
dann sind zum Teil einzelne Künstler oder Projekte
Mitglied, die sagen: ich mache Kunst, und zwar zusammen<br />
mit Leuten, aber ich mache Kunst, oder ich betreibe ein<br />
Museum. Wenn man in den <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> schaut, dann fi ndet man im Extremfall jemanden,<br />
der ein Pfl egeheim betreibt, wo es auch mal eine Weihnachtsfeier<br />
gibt.<br />
TN: Nein, so ist das nicht. Ein Pfl egeheimbesitzer könnte<br />
nicht sagen, dass er ein <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>s Zentrum oder<br />
ein Nachbarschaftsheim ist, nur weil er ab und zu Flötenmusik<br />
<strong>für</strong> die Bewohner macht.<br />
Herbert Scherer: Es gibt bei uns sicherlich eine Grenze,<br />
wo man sagen kann: das würde uns tatsächlich trennen.<br />
Aber ich könnte das nicht so einfach defi nieren, wie du<br />
das jetzt gerade gemacht hast.<br />
Ralf Jonas: Ich fi nde, das macht auch keinen Sinn. Die<br />
Einrichtungen verändern sich im Laufe der Jahre, manche<br />
nehmen <strong>sozial</strong>e Sachen mit rein, andere haben eher<br />
<strong>kulturelle</strong> Sachen mit reingenommen. Es gibt viele, die<br />
würde ich als <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> Zentren bezeichnen, aber<br />
ich wüsste nicht mehr, wo ich da unterscheiden sollte. Es<br />
gibt auch <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> Einrichtungen, die mit erstklassigen<br />
Künstlern Kinderarbeit machen, also es ist nicht so,<br />
dass <strong>sozial</strong>-kulturell eine schlechtere Qualität beinhaltet<br />
als sozio-kulturell. Von den Inhalten her hat sich das doch<br />
sehr angenähert. Wir versuchen diese Unterscheidung<br />
auch nicht mehr, die besteht nur noch auf politischer<br />
Ebene.<br />
Margret Staal: Wir sind inhaltlich auf Bundesebene<br />
sicher anderswo unterwegs als der <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong><strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>, wir bohren andere Bretter als die <strong>sozial</strong><strong>kulturelle</strong>n<br />
Zentren. Das ist ganz wichtig, selbst wenn<br />
sich die Basis beider Verbände zum Teil überlappt oder<br />
angenähert hat.<br />
Herbert Scherer: In welchem Brett bohrt ihr denn gerade?<br />
Margret Staal: Durch die Enquête-Kommission gab es<br />
ja den Weg, dass sozio-<strong>kulturelle</strong> Zentren neben den<br />
Hochkultur-Häusern wichtige Kultureinrichtungen hier in<br />
Deutschland sind, die die <strong>kulturelle</strong> Grundversorgung der<br />
Menschen gewährleisten. Das trifft den Anspruch, den<br />
sozio-<strong>kulturelle</strong> Zentren ursprünglich an sich selber hatten,<br />
nämlich Kultur niedrig schwellig vor Ort <strong>für</strong> die Menschen<br />
möglich zu machen und auch andere Formen von<br />
Kulturangeboten möglich zu machen. Um dem tatsächlich<br />
jetzt Gewicht zu verleihen, dass es auch umgesetzt wird,<br />
gibt es Hinweise, dass Kommunen mit einsteigen, um die<br />
Finanzierung der Häuser zu verbessern. Daran arbeiten<br />
wir im Moment.<br />
Herbert Scherer: Und an welchen Brettern bohren wir?<br />
In Berlin haben wir uns erfolgreich an einer ganz anderen<br />
Stelle angesiedelt, nämlich in diesem Stadtteilzentrumsbegriff.<br />
Das heißt: Stadtteilzentren-Vertrag, Landespolitik,<br />
Landesförderung, Kernfi nanzierung, Infrastruktur – so<br />
etwas soll es überall geben, als Teil der <strong>sozial</strong>en Grundversorgung,<br />
nicht der <strong>kulturelle</strong>n.<br />
Das haben wir hier geschafft, dass das in der Landespolitik<br />
verankert ist. Aber das ist eben keine Bundesebene,<br />
wodurch es in den anderen Bundesländern eben dann<br />
auch nicht so läuft. Hier ist das durch verschiedene glückliche<br />
Konstellationen entstanden und dadurch, dass hier<br />
einige Zentren sehr gewachsen sind und eine Bedeutung<br />
bekommen haben, wodurch sie die anderen mitnehmen.<br />
Aber das hat hier auch im Kopf durchaus was verändert.<br />
Jetzt heißen die Zentren alle erst einmal u.a. Stadtteilzentrum<br />
im Untertitel. Oder Mehrgenerationenhaus, das<br />
ist die zweite Schiene. Das ist in Berlin auch ein relativ<br />
großes Thema, hier gibt es neun solcher Häuser, die mit<br />
diesem Anspruch antreten.<br />
Margret Staal: Es haben sich sozio-<strong>kulturelle</strong> Zentren<br />
genauso als Mehrgenerationenhäuser beworben und<br />
sind es auch geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele<br />
bundesweit.<br />
Herbert Scherer: Nicht so viele, aber es sind einige. Vielleicht<br />
können wir Gaisental einbringen, weil das noch mal<br />
eine ganz andere Perspektive ist. Wie sieht das bei euch<br />
aus?<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 75
76<br />
Workshop Kultur-Botschaften<br />
Sabrina Blum: Ich bin erst seit einem halben Jahr dort<br />
tätig und habe dazu noch keinen umfassenden Einblick.<br />
Ich bin auch nicht aus dem <strong>sozial</strong>pädagogischen Bereich,<br />
sondern aus dem Betriebswirtschafts-Bereich. Ich kenne<br />
die Situation bei uns im Haus, habe allerdings keine Vergleichsmöglichkeiten.<br />
Das Stadtteilhaus liegt im Stadtteil Gaisental in Biberach.<br />
Biberach hat ca. 30.000 Einwohner, der Landkreis<br />
bei uns hat 200.000 Einwohner. Das Stadtteilhaus ist<br />
2000 auf das große Drängen der Anwohner gegründet<br />
worden, die ein Haus wollten, in dem sie ihre Angebote<br />
schaffen können, in dem aber auch Angebote <strong>für</strong> die Bürger<br />
geschaffen werden, also sowohl von Bürgern als auch<br />
<strong>für</strong> Bürger. 2000 ist das gebaut worden, seit 2007 ist es<br />
auch ein Mehrgenerationenhaus. Wir hatten vorher schon<br />
viele Aufl agen, die mit einem Mehrgenerationenhaus verbunden<br />
sind, <strong>für</strong> uns selber umgesetzt, zum Beispiel den<br />
Mittagstisch, den es geben muss, weshalb wir uns relativ<br />
leicht damit getan haben, dann zum Mehrgenerationenhaus<br />
ernannt zu werden.<br />
Wir bieten alles Mögliche an, angefangen bei diesem<br />
wöchentlich stattfi ndenden Mittagstisch, wo Bürger aus<br />
dem Stadtteil kommen und einen Treffpunkt haben, wo<br />
sie sich mit anderen austauschen können. Wir haben<br />
einen Tauschring, aber auch einen Sprachkurs „Mama<br />
lernt Deutsch“, wo wir gleichzeitig die Kinderbetreuung<br />
übernehmen. Wir bieten Konzerte an, also da bieten wir<br />
auch einen <strong>kulturelle</strong>n Bereich an, der allerdings noch<br />
ausgebaut werden könnte. Deshalb sitze ich auch hier,<br />
damit ich mir ein paar Anregungen holen kann und mitbekomme,<br />
wo die Schwierigkeiten liegen, weil wir diesen<br />
Bereich bei uns verstärken wollen. Das Problem ist, dass<br />
wir in einem Stadtteil sind, der in Biberach ziemlich verpönt<br />
ist. Viele Russland-Deutsche haben sich dort niedergelassen,<br />
die in der Stadt nicht den besten Ruf haben.<br />
Dazu haben sich natürlich auch noch andere Menschen<br />
mit Migrationshintergrund gesellt. Das ist jetzt nicht wirklich<br />
ein Ghetto, aber es kommt diesem Begriff schon ein<br />
bisschen nahe. Bei den anderen Bürgern ist der Stadtteil<br />
recht unbeliebt und wird auch nicht gerne besucht. Deswegen<br />
tun wir uns schwer, Kultur anzubieten, weil Menschen<br />
mit Migrationshintergrund so etwas leider nicht<br />
so annehmen. Und die anderen Menschen aus der Stadt<br />
kommen nicht, weil sie sich dort eben nicht wohl fühlen.<br />
TN: Am Anfang sagtest du, es sei ein Bedürfnis der Leute<br />
gewesen. <strong>Arbeit</strong>en viele ehrenamtlich mit?<br />
Sabrina Blum: Nicht mehr. Es war ursprünglich wirklich<br />
so, dass auch viele Senioren da<strong>für</strong> gekämpft haben, weil<br />
sie nicht mehr mobil genug waren, um durch die Gegend<br />
zu fahren, weshalb sie gerne hier im Stadtteil etwas haben<br />
wollten. Inzwischen ist es leider so, dass die Senioren<br />
eben älter geworden sind und nicht mehr so viel leisten<br />
können, während die Jüngeren leider nicht nachkommen.<br />
Das ist auch ein ganz großes Problem bei uns, dass wir<br />
viel zu wenig Ehrenamtliche haben, weshalb wir auch gar<br />
nicht so viel leisten können wie wir wollen.<br />
Ich bin mit einer 50 %-Stelle angestellt, die Kollegin, die<br />
<strong>für</strong> das Mehrgenerationenhaus zuständig ist, hat ebenfalls<br />
eine 50%-Stelle. Inzwischen gibt es vier Frauen, die<br />
je auf 400-Euro-Basis arbeiten. Das ist eine ganz schwierige<br />
Struktur bei uns. Der Vorstand ist sich auch nicht völlig<br />
klar darüber, wo es lang gehen soll. Aber wie gesagt,<br />
ich komme aus dem BWL-Bereich und habe eine andere<br />
Sichtweise. Ich habe das schon beim Vorstand angesprochen,<br />
der ist im Bilde, aber es ist schwer, an der Situation<br />
was zu ändern.<br />
Ich mit meiner 50 %-Stelle, dann vier 400-Euro-Kräfte,<br />
zusätzlich haben wir noch eine 400-Euro-Kraft, die <strong>für</strong><br />
das Sekretariat zuständig ist, da weiß die linke Hand nicht<br />
immer, was die rechte tut. Dabei noch Ehrenamtliche zu<br />
koordinieren, ist sehr schwierig, weil wir keine festen<br />
Bürozeiten haben, denn die 400 Euro-Kräfte kommen<br />
dann, wenn sie denken, dass sie gebraucht werden. Ich<br />
bin reingekommen und mir ist der Kopf angeschwollen,<br />
weil ich nicht mehr wusste, wo ich überhaupt bin und mit<br />
wem ich was zu besprechen habe, wer Ansprechpartner<br />
ist – und genauso geht es den Bürgern. Sie kommen ins<br />
Haus, haben ein Anliegen, ich kann nicht weiterhelfen,<br />
weil meine Kollegin da<strong>für</strong> zuständig ist und weiß auch<br />
nicht Bescheid, weil ich meine Kollegin kaum sehe. Es<br />
fehlt an Absprachen usw., man hört wahrscheinlich, dass<br />
ich ein bisschen ratlos bin.
TN: Aber trotzdem noch motiviert, noch mehr Kultur ins<br />
Haus zu bringen?<br />
Sabrina Blum: Ich bin supermotiviert, was vielleicht merkwürdig<br />
ist, aber da ich aus dem BWL-Bereich mit Schwerpunkt<br />
Kultur- und Freizeitmanagement komme, will ich<br />
Kultur machen. Ich bin auch der Überzeugung, wenn man<br />
es richtig anpackt, dann kann es auch funktionieren. Aber<br />
es muss erst mal angepackt werden, da<strong>für</strong> reichen meine<br />
Kräfte mit einer 50 %-Stelle einfach nicht aus, da<strong>für</strong> benötige<br />
ich auch Ehrenamtliche. Das wäre der erste Schritt,<br />
die zu aktivieren.<br />
TN: Oder Kooperationen, Vereine oder Organisationen,<br />
die bei euch etwas veranstalten.<br />
Sabrina Blum: Wir betreiben auch sehr viel Netzwerkarbeit,<br />
allerdings hauptsächlich im <strong>sozial</strong>en Bereich mit<br />
Behinderteneinrichtungen usw.. Aber das ist sicher auch<br />
eine Möglichkeit, ebenso wie eine Sponsorenakquise zu<br />
machen, es muss eben alles angezapft werden.<br />
TN: Das ist nicht in einem halben Jahr zu machen, es wird<br />
noch ein bisschen Zeit brauchen.<br />
Sabrina Blum: Mit Sicherheit, aber noch bin ich motiviert.<br />
Margret Staal: Kooperationen sind ein ganz wichtiger<br />
Punkt, generell <strong>für</strong> Nachbarschaftshäuser. Räume <strong>für</strong><br />
Gruppen zu bieten, die sich dort treffen, sei es der Probenraum<br />
<strong>für</strong> die Theatergruppe oder den Chor, die dann<br />
dort in den Räumen auch Veranstaltungen machen.<br />
Herbert Scherer: Wir hatten bei uns früher überall im<br />
<strong>Verband</strong> eine große Diskussion darüber, was wichtiger ist<br />
– Räume oder Menschen? Wir hatten zwei Flügel: Die aus<br />
der Gemeinwesenarbeit sagten, dass nicht die Räume<br />
entscheidend sind, sondern die Leute, die mit den Menschen<br />
arbeiten, denn die werden <strong>für</strong> sich schon Räume<br />
fi nden; während die andere Fraktion, die Nachbarschaftsheimfraktion,<br />
meinte, dass die Räume als das zentrale<br />
Angebot im Vordergrund stehen. Räume bieten die Mög-<br />
lichkeit, dass sich etwas auf der Basis der Interessen der<br />
Menschen entwickelt. Durch die Benutzung der Räume<br />
entsteht Interaktion.<br />
Ich glaube, dass Räume auch beim Stadtteilzentrumskonzept<br />
einen zentralen Stellenwert haben. Sie sollen <strong>für</strong><br />
selbst organisierte, aber auch <strong>für</strong> angeschobene Begegnungen,<br />
Aktivitäten, usw. als halb öffentliche Räume zur<br />
Verfügung gestellt werden. Es sind Räume nicht primär <strong>für</strong><br />
einen <strong>kulturelle</strong>n Zweck, sondern sie sind offener. Deswegen<br />
beinhaltet diese Parole „offen <strong>für</strong> alle“ auch, dass es<br />
offene Räume <strong>für</strong> alle gibt. Das greift an den Stellen, wo<br />
es so etwas nicht oder nicht ausreichend gibt. Und dann<br />
gibt es auch wieder Orte, wo es <strong>für</strong> bestimmte Menschen<br />
ausreichend Möglichkeiten gibt, das können Kneipen<br />
sein oder der Feuerwehrverein. Und da braucht es wieder<br />
Räume <strong>für</strong> die anderen, die sich in den entsprechenden<br />
Milieus nicht wohlfühlen. Das können dann sozio-<strong>kulturelle</strong><br />
Zentren sein, die eine entsprechende Alternative<br />
bieten. Ich glaube, diese Art Beschränkung würden wir in<br />
den Einrichtungen unseres <strong>Verband</strong>es in der Regel nicht<br />
machen. Sondern wir wollen <strong>für</strong> die Geraden und Schrägen<br />
und <strong>für</strong> alle da sein, <strong>für</strong> die verschiedenen Generationen<br />
und nicht so sehr ausschließen. Vielleicht können<br />
wir uns das auch einfach erlauben, weil es diese verschiedenen<br />
kleinen Kultur-Nischen in Berlin schon kommerziell<br />
gibt. Vielleicht könnt ihr noch mal sagen: warum diese<br />
Rechtfertigungsnotwendigkeit gegenüber dem Sozialen<br />
an diesem Punkt?<br />
TN: Es gibt eine Förderung <strong>für</strong> sozio-<strong>kulturelle</strong> Projekte<br />
auf Bundesebene, und da wird immer wieder um diesen<br />
Begriff gerungen, was ein sozio-<strong>kulturelle</strong>s Projekt ist.<br />
Eine Theatergruppe <strong>für</strong> Senioren zu machen, wäre sicher<br />
kein sozio-<strong>kulturelle</strong>s Projekt. Aber unter dem Blickwinkel,<br />
dass ein Künstler mit Laien arbeitet, um mit ihnen kulturell<br />
etwas zu bewegen, wäre das gleiche Projekt doch eine<br />
sozio-<strong>kulturelle</strong> Sache.<br />
TN: Darin steckt doch genau das Problem. Anstatt zu<br />
sagen: wenn eine Künstlerin kommt und mit Leuten etwas<br />
macht, das ist die beste Sozialarbeit überhaupt. Das ist<br />
präventive <strong>Arbeit</strong>, das ist eine herausragende <strong>Arbeit</strong> und<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 77
78<br />
Workshop Kultur-Botschaften<br />
das muss seinen Stellenwert haben und fi nanziert werden.<br />
Statt dessen wertet man so etwas ab und meint: da<br />
machen die ein bisschen Pipifax mit den Senioren oder<br />
Jugendlichen.<br />
TN: Ja, weil andere so denken, sehen wir selber es manchmal<br />
auch so ...<br />
TN: Ich denke jetzt gerade mal weg von Nachbarschaftshäusern<br />
und sozio-<strong>kulturelle</strong>n Zentren, aber es ist mittlerweile<br />
doch schon deutlicher geworden, dass <strong>Arbeit</strong> mit<br />
Laien oder zum Beispiel mit Schülern, die absolute Schulverweigerer<br />
sind, sehr wichtig und qualitativ hochwertig<br />
sein kann. Denkt an die wunderbare Aufführung von „Le<br />
Sacre du printemps“ dieses wunderbare Stück, das von<br />
Simon Rattle mit Schülern auf die Bühne gestellt wurde,<br />
die absolut null Bock hatten. Es gibt ja den Film dazu, der<br />
die Entwicklung zeigt. Hochkarätige Künstler haben das<br />
fertiggebracht. Das gibt es an Nachbarschaftszentren an<br />
bestimmten Punkten auch, dass man nicht nur mal was<br />
mit jungen Besuchern macht, sondern auch hohe Qualität<br />
erreicht wird. Dabei erwarten wir gar nichts. Es gibt Stücke,<br />
die mit Laien gemacht werden, die qualitativ absolut<br />
hochwertig sind. Da<strong>für</strong> möchte ich eine Lanze brechen,<br />
dass das sehr wohl möglich ist, aber auch das Andere<br />
ist wichtig.<br />
Ralf Jonas: Ich bin davon überzeugt, dass sich in den<br />
nächsten Jahren in den Kommunen und Städten verschiedene<br />
Ressorts wie Kultur, Bildung und Soziales<br />
gemeinsam an einen Tisch setzen. In Ansätzen fi ndet<br />
das ja bereits statt, um genau diesen Bereich <strong>kulturelle</strong>r<br />
Bildung, von dem wir hier reden, nachhaltig zu fördern<br />
und mehr Kindern und Jugendlichen den Zugang zu<br />
ermöglichen. Dann sollte man wirklich mit erstklassigen<br />
Künstlern in die Schulen gehen. Momentan sind wir in<br />
Bremen leider mit einem größeren Antrag an den Bund<br />
gescheitert, man will uns die Infrastruktur zur Verfügung<br />
stellen, aber nicht die Mittel <strong>für</strong> die Künstler, obwohl man<br />
die auch braucht.<br />
TN: Wir stehen immer wieder vor dem Dilemma, dass auf<br />
der einen Seite die Freude darüber da ist, dass <strong>kulturelle</strong><br />
Angebote jetzt eine Anerkennung erfahren, während die<br />
Finanzierung oft überhaupt nicht vorhanden ist.<br />
Eva Bittner: Ich fi nde es andererseits aber auch kompliziert,<br />
dass die Kultur irgendwie an Boden verloren hat.<br />
Vor 30 Jahren war es klarer, wogegen man losgezogen<br />
ist. Während es heute <strong>für</strong> Künstler unheimlich schwer ist,<br />
sich überhaupt zu ernähren und durchzubringen. Insofern<br />
ist man gezwungen, diese Sozialgeschichten zu machen,<br />
was ja nicht <strong>für</strong> jeden Künstler immer ein Genuss ist.<br />
Wir erleben das bei uns auch ein Stück weit. Das reine<br />
„Theater der Erfahrungen“ war so, wie wir es eigentlich<br />
am liebsten bis zur Rente gemacht hätten, nämlich Stück<br />
um Stück entwickeln und glücklich sein. Das ging nicht,<br />
weil sich die Bedingungen verändert haben. Aus Neugier,<br />
aber auch aus <strong>sozial</strong>er Verantwortung haben wir diese<br />
intergenerative <strong>Arbeit</strong> begonnen, wir sind mit den Spielern<br />
in die Schulen gegangen und haben mit den Jugendlichen<br />
Stücke entwickelt. Einmal oder zweimal ist das<br />
superklasse und oberspannend. Aber wenn es irgendwann<br />
heißt: damit das Projekt weitergeht, damit ihr das<br />
machen könnt, was ihr wirklich machen wollt, müsst ihr<br />
auch ehrenamtlich ein Stück Sozialarbeit leisten - daraus<br />
ergibt sich eine Schwierigkeit, die in diesem Bereich auch<br />
noch mit drinsteckt, dass nämlich die Räume <strong>für</strong> Kulturarbeit<br />
so klein geworden sind.
TN: Auf sozio-<strong>kulturelle</strong> Einrichtungen übersetzt heißt das,<br />
dass wir die Disko oder anderes machen müssen, damit<br />
andere Sachen fi nanziert werden können, weil es sonst<br />
gar nicht geht.<br />
TN: Der Konsens wäre dann, dass es auf jeden Fall viel<br />
mehr Geld <strong>für</strong> diese <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> geben muss.<br />
Herbert Scherer: Das ist ein wunderbarer Konsens,<br />
dann machen wir noch einen Beschluss und eine Resolution.<br />
Ich denke, wir müssen noch mal genauer hingucken,<br />
wie wir das erreichen. Da spielt die Qualitätsfrage<br />
eine wichtige Rolle. Nur dann, wenn es gelingt,<br />
die guten Projekte auch richtig gut, vielleicht auch in<br />
ihrer ganzen Kraft, zusammenzufassen, wird es gelingen,<br />
diese Vorurteile und diese Barrieren zu überwinden.<br />
Und dieses Nase-Rümpfen ist ja überhaupt nicht<br />
berechtigt. Oder es ist nur dann berechtigt, wenn wir<br />
nicht an der Frage arbeiten, wo wir selber welche Qualitätsansprüche<br />
haben. Unsere Qualitätsansprüche sind<br />
nicht identisch mit denen der Kulturbehörde, aber es<br />
gibt trotzdem interne hohe Qualitätsansprüche. Es gibt<br />
in unseren Bereichen weltweit so gute Sachen. Ihr habt<br />
doch den Film gesehen mit diesen Alten in den USA,<br />
die <strong>für</strong> ihre Musik standing ovations bekommen – oder<br />
das Video über das Taubstummen-Theater der Drusen<br />
in Nordisrael. Sie haben taubstumme Menschen in<br />
einer arabischen Gegend, wo sie normalerweise versteckt<br />
werden, auf die Bühne gebracht und damit im<br />
ländlichen Raum kulturell und <strong>sozial</strong> ganz viel bewegt.<br />
Plötzlich haben diese vorher nicht wahrgenommenen<br />
Menschen <strong>sozial</strong>e Anerkennung bekommen. Die Frage<br />
Kultur und Soziales ist in einer genialen Weise verknüpft.<br />
Wir haben vor zwei oder drei Jahren diese gut dokumentierte<br />
Jugendorchesterbewegung aus Venezuela kennen<br />
gelernt. Also es gibt eine öffentliche Wahrnehmung <strong>für</strong><br />
diese Projekte und deren Qualität, aber wir müssen es<br />
schaffen, das irgendwie zusammenzubringen.<br />
Margret Staal: Es hat auch bei uns schon lange ganz tolle<br />
Projekte gegeben und es wird sie immer wieder geben.<br />
Sie werden nur nicht so selbstbewusst vertreten und<br />
nicht so nach außen kommuniziert. Es heißt lapidar, dass<br />
jemand mit Jugendlichen oder Senioren was macht. Aber<br />
dass so eine <strong>Arbeit</strong>, die 30 Jahre alt ist, im Grunde etwas<br />
vorgedacht hat, wo wir heute sagen, wir müssen <strong>für</strong> die<br />
Generation 60 plus was tun, darauf kann man eigentlich<br />
selbstbewusst hinweisen. Das ist die Herausforderung,<br />
auch das, was Herbert sagt, wir müssen es zusammenbringen<br />
und wir müssen es vermarkten und sagen, dass<br />
wir eine supertolle Sache machen, die sehr lohnend ist<br />
sich anzuschauen.<br />
TN: Ich fi nde nicht, dass jedes <strong>kulturelle</strong> Projekt, das mit<br />
Menschen gemacht wird, auch in eine öffentliche Aufführung<br />
münden muss. Wir haben zum Beispiel einen professionellen<br />
Musiker, der mit Kindern arbeitet. Da ist eben<br />
nicht das Ziel, eine Aufführung zu haben oder dass was<br />
Tolles rauskommen muss, sondern der <strong>sozial</strong>e Auftrag ist<br />
die Stärkung des Kindes. Wir wollen also kein tolles Produkt<br />
machen, sondern der Prozess steht im Vordergrund.<br />
Ich fi nde das genauso wichtig. Beides kann sein, aber<br />
muss nicht sein.<br />
Renate Wilkening: Das ist ein wichtiger Aspekt, dass<br />
beides seine Berechtigung hat. Aber ich erlebe zum Beispiel<br />
in der <strong>Arbeit</strong> mit den Kindern, dass sie ein Ergebnis<br />
ihrer <strong>Arbeit</strong> zeigen möchten. Für die ist dieses Produkt<br />
enorm wichtig und sie fi ebern dem entgegen. Wir haben<br />
bei uns eine Action-Hausparty, da treten alle die Gruppen<br />
auf, die über das Jahr miteinander gearbeitet haben,<br />
ob professionell oder nicht professionell, ob Kindertanz,<br />
Bauchtanz oder Samba. Kinder wollen ihr erworbenes<br />
Können unbedingt vorführen.<br />
Da muss es Modelle geben, die beides ermöglichen,<br />
einerseits muss der Prozess ermöglicht werden, also ohne<br />
Anspruch an den Qualitätslevel. Auf der anderen Seite<br />
muss es genauso möglich sein, dass wir da, wo wir diesen<br />
Anspruch auf Präsentation entdecken und wo er gerechtfertigt<br />
ist, - manchmal sehe ich während des Prozesses<br />
Kinder, wo ich denke: das könnte ich der Deutschen Oper<br />
anbieten - dass auch diese Möglichkeit geboten wird. Das<br />
sollten wir auch nicht verstecken. Öffentliche Anerkennung<br />
ist schön und gibt den Leuten Selbstbewusstsein.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 79
80<br />
Workshop Kultur-Botschaften<br />
Und wir können auch ganz selbstbewusst unsere Entdeckungen<br />
präsentieren. Diese Sichtweise ist natürlich<br />
auch ufa-mäßig, weil wir uns das auf die Fahne geschrieben<br />
haben, Leute zu entdecken und zu fördern.<br />
Herbert Scherer: Dieser Qualitätsbegriff orientiert sich<br />
nicht nur an dem Produkt, sondern bezieht sich auf das<br />
Ganze. Das ist ja bei dem genannten Film so gut, dass<br />
er das Gesamte zeigt, auch das, was hinter den Kulissen<br />
passiert. Diese Geschichte mit den alten Menschen ist ja<br />
Realität, kein Theaterstück - der Film zeigt das Umfeld,<br />
die Proben, was machen sie, wenn einer stirbt, das ist<br />
die Qualität des Ganzen, dass ein Gesamtbild entsteht.<br />
Der Stress, dass es ein Produkt geben sollte, ist Teil des<br />
Ganzen. Aber nicht, weil es von Sozialarbeitern so gewollt<br />
wird, sondern weil Künstler ihre ganze kreative Energie<br />
da mit reinstecken. Also die Qualität ist das Gesamte und<br />
nicht nur das Produkt.<br />
TN: Es steht in den Leitlinien der Stadtteilzentren, dass<br />
<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> eines der vier wichtigen Standbeine ist.<br />
Trotzdem ist es oft so, dass dieser Teil nur als Sahnehäubchen,<br />
als Kann-Bestimmung mitläuft, aber keine<br />
Kernaufgabe ist. Im Ernstfall sind die Beratungen und alle<br />
anderen Dinge wichtiger, Kinderbetreuung, Sozialstation<br />
usw. Das sind tatsächlich alles wichtige Angebote, aber<br />
die <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> Anstrengung steht in manchen Einrichtungen<br />
nicht an oberster Stelle. Sie steht ein bisschen<br />
an der Seite – oder ist das nur meine Wahrnehmung?<br />
TN: Da würde ich gerne einhaken. Wir haben den Club<br />
Spittelkollonaden in der Leipziger Straße. Während der<br />
umfassenden Diskussion dachte ich: Mensch, das sind<br />
alles hier so hohe künstlerische Ansprüche, da können<br />
wir überhaupt nicht mithalten. Ich fühle mich jetzt ein<br />
bisschen klein. Wir sind ein Stadtteilzentrum, welches<br />
nur Räume zur Verfügung stellt, nämlich Räume <strong>für</strong> die<br />
verschiedensten Interessengemeinschaften.<br />
Unser Publikum in der Leipziger Straße ist intellektuell<br />
sehr bereit, sich neuen Dingen zu öffnen und braucht auch<br />
sehr viel geistige Anregung, die sie selbst einbringen. Deshalb<br />
haben sie in Selbstinitiative Projekte entwickelt und<br />
Interessengruppen zusammengefasst und bieten bei uns<br />
in den Räumlichkeiten bestimmte Sachen an. Wir haben<br />
über 20 verschiedene Interessengruppen. Unsere Nachbarschafts-<br />
und Begegnungsstätte gibt es seit 1992, sie<br />
ist aus der Aktivität von interessierten Bürgerinnen und<br />
Bürgern entstanden. Wir leiten an, wir unterstützen bei<br />
verschiedenen Projekten, wir haben jetzt mit interessierten<br />
Bürgerinnen und Bürgern das Stadtteilaktiv Spittelkolonnaden<br />
gebildet, das Neueste, was wir gemacht haben.<br />
Im November werden wir die erste Stadtteilkonferenz in<br />
Berlin-Mitte abhalten. Das ist eine tolle Errungenschaft,<br />
aber das geht gar nicht in Richtung Kultur.<br />
TN: Kommt darauf an, was in den Gruppen passiert.<br />
TN: Ganz viel Kultur natürlich, aber es hat einen anderen<br />
Stellenwert, wir haben keine eigenen Theaterstücke oder<br />
wir haben auch keine tolle, künstlerische, musikalische<br />
Laufbahn zu bieten, aber vielleicht ergänzt meine Kollegin.<br />
TN: Wir haben bei uns natürlich auch Künstler, die in den<br />
Gruppen sind. Wir organisieren auch Veranstaltungen,<br />
wo Künstler auftreten, fast alle Genres, das sind Schriftsteller,<br />
Sängerinnen und Sänger. Einen Tanzkurs machen<br />
wir jetzt, der ja auch Kultur und Lebensfreude spiegeln<br />
soll. Insofern kann ich nur das unterstreichen, was vorhin<br />
hier gesagt wurde, man muss die Möglichkeit haben, sich<br />
auch mal vor anderen zu produzieren und zu zeigen, was<br />
man in der ganzen Zeit überhaupt gemacht hat. Es sind<br />
alles Senioren, die sich zum Tanzen zusammengefunden<br />
haben. Ich kann das jetzt wieder neu beleben, weil ich<br />
einen neuen Tanzlehrer gefunden habe, der auch Standard<br />
und Latein in seinem Repertoire hat, was gar nicht<br />
so einfach war – <strong>für</strong> Senioren. Für Kinder machen ja sehr<br />
viele was, aber <strong>für</strong> Senioren?<br />
Wir haben also auch künstlerische Ambitionen. Auch <strong>für</strong><br />
unser Nachbarschaftsfest hatten wir ein tolles Kulturprogramm<br />
auf die Bühne gebracht, wir haben das organisiert.<br />
Das ist sehr gut von allen angenommen worden. Die Berliner<br />
Seniorenakademie nutzt unsere Räume, sie machen<br />
einen Opernkurs, musikalische Akademie, Operette, usw.,<br />
was sehr viele Leute interessiert, gleichzeitig schaffen wir
ihnen die Basis, dass sie sich dort produzieren können.<br />
Wenn in einer Veranstaltung 50 Leute sind und der Saal<br />
fasst nur 50, dann ist das eine tolle Sache. Ich denke, so<br />
etwas wäre bestimmt auch <strong>für</strong> Sie machbar, man muss ja<br />
nicht gleich mit einer Seniorenakademie anfangen.<br />
Sabrina Blum: Bei uns ist auch das ganz schwierig, weil<br />
wir eine der reichsten Kommunen in Deutschland sind,<br />
die auch sehr viel Geld in Kultur und ähnliches steckt.<br />
Deswegen haben sämtliche Vereine und Einrichtungen in<br />
Biberach eigentlich ihre eigenen Räumlichkeiten.<br />
TN: Aber die Russlanddeutschen …<br />
TN: ... die sind meistens sehr musikalisch und mögen<br />
musikalische Zusammenkünfte ganz doll...<br />
Sabrina Blum: Die haben zum Beispiel auch ihren extra<br />
Raum, wo sie ihre Folkloretänze machen können, der<br />
wurde ihnen von der Stadt zur Verfügung gestellt. Das ist<br />
arg schwer, weil die Konkurrenz unsere Stadt selber ist.<br />
TN: Aber wir haben auch die Staatsoper, die Komische<br />
Oper, das ist alles bei uns drum herum. Trotzdem machen<br />
die Leute auch ihre eigenen Sachen noch.<br />
Sabrina Blum: Ja, das erstaunt mich. In Berlin ist es wohl<br />
so, dass es trotzdem auch noch Menschen gibt, die sich<br />
nicht nur <strong>für</strong> das große Kommerzielle interessieren, sondern<br />
auch <strong>für</strong> die Kleinen mit ihren Projekten.<br />
TN: Wo soll denn bürgerschaftliches Engagement stattfi nden,<br />
wenn es keine Räume gibt? Irgendwo muss das ja<br />
eine Anlaufstelle haben.<br />
TN: Ich habe Probleme, alle unterzukriegen, die bei uns<br />
was machen wollen. Manchmal ist dieser Andrang einem<br />
gar nicht so recht, weil dann der Besucher, der normal so<br />
kommen will, beide Räume belegt vorfi ndet.<br />
TN: Wir sind auch ein sehr, sehr kleines Stadtteilzentrum,<br />
unsere Räumlichkeiten sind arg eingeschränkt. Wir<br />
haben wirklich nur zwei Räume, einen großen Veranstaltungsraum<br />
<strong>für</strong> 50 bis 60 Leute, dann einen kleinen Raum,<br />
die Kollegen haben nicht mal ein eigenes Büro, die sitzen<br />
immer in diesen beiden Räumen mit drin, also das sind<br />
ganz unzumutbare Bedingungen.<br />
Herbert Scherer: Ich komme mal zu unserem generellen<br />
Thema zurück: 50 Meter von dieser Einrichtung ist die<br />
nächste, aber dazwischen ist die Mauer, die es nicht mehr<br />
gibt - oder ist sie immer noch in den Köpfen vorhanden?<br />
Hat sich da was verändert?<br />
Margret Staal: Im Rückblick meine ich, dass sich da vieles<br />
geändert hat. Ich weiß von den Anfängen aus der Sozio-<br />
Kultur, dass die entstehenden <strong>kulturelle</strong>n Einrichtungen<br />
im Osten unseres Landes eher kritisch beäugt wurden,<br />
weil die Sorge bestand, dass das aus den alten Kulturhäusern<br />
gewachsen war und die alten Strukturen noch<br />
wirksam sind. 1992 gab es hier in Berlin einen Kongress<br />
„Utopien leben“, ich glaube, im ‚Förderband‘, wo sehr<br />
hart darüber debattiert wurde, welche Maßstäbe man<br />
an Kunst und Kultur anlegen kann, professionell oder<br />
nicht. 2001 gab es noch mal einen Infodienst dazu, wo<br />
der Ton schon sehr viel gelassener war – und so nehme<br />
ich das auch wahr. In den ostdeutschen Einrichtungen,<br />
die ich besucht habe, hat einiges vor 10 oder 15 Jahren<br />
begonnen und die Entstehungsgeschichten sind ähnlich.<br />
Es gibt inzwischen nicht mehr so viel kulturpolitischen<br />
Ballast. Heute geht es darum, Räume und Möglichkeiten<br />
zu schaffen, um der Kreativität des Einzelnen jenseits der<br />
üblichen Strukturen einen Platz zu geben. Wir machen die<br />
Rest-Kultur, also das, was nirgendwo Platz hat.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 81
Input:<br />
Workshop<br />
Stadtteil-Entdeckungen<br />
Gemeinwesenarbeit begegnet Quartiersmanagement<br />
Prof. Dr. Dieter Oelschlägel (Dinslaken)<br />
Markus Runge Nachbarschaftshaus Urbanstr.<br />
(Kreuzberg)<br />
Angelika Greis, Stadtteilmanagement/<br />
NBH Urbanstr. (Kreuzberg)<br />
Moderation: Reinhilde Godulla<br />
Dieter Oelschlägel: Ich habe mit der Mauer insofern zu<br />
tun, dass ich dabei war, als sie aufgebaut wurde – und<br />
umso mehr bin ich erfreut, dass sie wieder der weg ist.<br />
Was die Gemeinwesenarbeit und Stadtteilarbeit betrifft,<br />
haben wir in Dinslaken vom Wegfall der Mauer nichts<br />
gespürt, da ist alles so weitergegangen wie es war und es<br />
gab keine großen Erschütterungen.<br />
Im <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> bin ich seit 1972,<br />
ich habe in Heerstraße Nord angefangen und hatte dann<br />
lange Zeit verschiedene Funktionen. Jetzt bin ich Ruheständler<br />
und im Vorstand eines Stadtteilvereins in Dinslaken.<br />
Ich will nur kurz anreißen, wie wir Gemeinwesen wahrgenommen<br />
haben. Vor etwa zehn Jahren hat C.W. Müller<br />
auf einer Tagung eine Bilanz der Gemeinwesenarbeit<br />
der letzten 30 Jahre gezogen, was ungefähr auch<br />
meine Zeit betrifft. Er sagte u.a. auch, dass die lokale<br />
Geschäftswelt in den GWA (Gemeinwesenarbeit)-Prozess<br />
einbezogen worden ist. Das stimmte <strong>für</strong> uns gar nicht,<br />
wir haben mit den Menschen an der Basis darüber geredet,<br />
aber Geschäftsleute waren nicht dabei. Heute geht<br />
es nicht mehr nur um den - wie es bei uns damals hieß<br />
- Reproduktionsbereich, also Freizeit, Konsum, Wohnen,<br />
sondern sehr stark auch um <strong>Arbeit</strong>, <strong>Arbeit</strong>slosigkeit und<br />
lokale Wirtschaft. Die Projekte leben vielfach verstärkt<br />
von abenteuerlicher Mischfi nanzierung. Multiethnische<br />
Projekte spielten vor 30 Jahren noch keine große Rolle,<br />
das hat sich inzwischen geändert. Auch das Berufsbild<br />
des Gemeinwesenarbeiters hat sich sehr verändert. Die<br />
alte GWA scheint den <strong>sozial</strong>pädagogischen Kinderstuben<br />
entwachsen zu sein. Ich war immer der Meinung, dass<br />
GWA nicht so eng an die Sozialarbeit gebunden werden<br />
sollte, sondern weit darüber hinausgehen und sehr viel<br />
in andere Bereiche gehen soll. Inzwischen ist Quartiersmanagement<br />
groß herausgekommen, nicht zuletzt durch<br />
das Programm Soziale Stadt. Man könnte fast meinen, es<br />
habe GWA ersetzt.<br />
Ich bin inzwischen ehrenamtlich in meiner Heimatstadt<br />
Dinslaken in einem Projekt der Sozialen Stadt tätig. Das<br />
ist ein Projekt, das Quartiersmanagement durch einen<br />
Verein betreibt, der von der Stadt Dinslaken mit einem<br />
Kooperationsvertrag das Quartiersmanagement übertragen<br />
bekommen hat. Das ist ein Stadtteil von 7.000<br />
Einwohnern, mit etwa 50 % Migranten, einem Bergwerk,<br />
das vor zwei Jahren geschlossen wurde, also mit allen<br />
Problemen, die dabei entstehen.<br />
Über einige Erfahrungen, die wir mit dem Quartiersmanagement<br />
gemacht haben, möchte ich Ihnen berichten.<br />
Inwieweit sie übertragbar sind, müssen Sie selbst entscheiden.<br />
Quartiersmanagement ist eine Strategie unter<br />
der Regie der Städte. Programmatisch soll es die <strong>sozial</strong>e<br />
Desintegration in den Städten aufhalten, die Lebenslage<br />
der Menschen in den benachteiligten Stadtteilen verbessern,<br />
Bürgerbeteiligung und Vernetzungen staatlicher und<br />
privater Akteure schaffen und verschiedene Handlungsfelder<br />
integrieren.<br />
Wie das umgesetzt wird, das ist von Stadt zu Stadt und<br />
auch innerhalb der Städte verschieden. Es kann durchaus<br />
eine Verbesserung der Lebensumstände erreicht werden.<br />
Aber Quartiersmanagement kann auch – je nach kommunaler<br />
Philosophie und Steuerungsvorstellung – als
Spar- oder Befriedungsstrategie eingesetzt werden und<br />
der eigenen Legitimation dienen. Das habe ich in Dinslaken<br />
schon wahrgenommen, dass die Stadt uns immer<br />
benutzt, um sich zu legitimieren, um sagen zu können,<br />
dass sie etwas Soziales tut.<br />
Finanziell hängen wir am Tropf der Stadt, das Geld wird<br />
vom Land bzw. vom Bund an die Stadt überwiesen, die<br />
Stadt überweist es an uns. Manchmal ist das eine Sicherheit,<br />
weil man weiß, dass es kommt. Aber es ist auch<br />
ein Mittel, um uns an der kurzen Leine zu halten. Wir<br />
mussten zum Beispiel bis vor einem Jahr jede Ausgabe<br />
über 500 Euro genehmigen lassen. 500 Euro hatten wir<br />
freies Geld, damit konnten wir spielen. Das ist natürlich<br />
<strong>für</strong> Gemeinwesenarbeit und <strong>für</strong> Stadtteilarbeit eine <strong>für</strong>chterliche<br />
Klemme. Wenn man dann schnell mal was unternehmen<br />
will, dann muss man fragen und es geht den Verwaltungsweg.<br />
Man schreibt dem Sachbearbeiter, der legt<br />
es seinem Amtsleiter vor, wenn es sehr schwierig ist, legt<br />
er es dem Dezernenten vor, dann geht der Weg wieder<br />
zurück. Inzwischen ist die ganze Sache schon gelaufen<br />
und man braucht das Geld nicht mehr. Das ist eine doch<br />
sehr kurze Leine.<br />
Entscheidungen werden auch in Politik und Verwaltung<br />
gefällt, es sind viele bauliche Sachen im Programm Soziale<br />
Stadt, die werden im Planungsamt und im Bauverwaltungsamt<br />
entschieden. Wir können dazu noch ein<br />
bisschen Bürgerbeteiligung organisieren. Beteiligungsansätze<br />
sind vielfach die üblichen runden Tische, Lenkungsausschüsse,<br />
Projektgruppen, in denen diejenigen<br />
sitzen, die sich ausdrücken können. In der Regel sind das<br />
dann bei den Ehrenamtlichen die Lehrer und ähnliche<br />
Berufsgruppen, die Geschäftsführer oder Mitarbeiter in<br />
den Wohlfahrtsverbänden und die politischen Vertreter.<br />
Das kann gut gehen, es kann aber auch nicht gut gehen.<br />
Es passiert auch, dass mit Teilhabe gelockt wird - und am<br />
Ende werden doch die Entscheidungen gefällt, die vorher<br />
bereits ausgehandelt und beschlossen wurden.<br />
Quartiersmanagement kann auch zur Ausgrenzung in den<br />
Stadtteilen beitragen, zum Beispiel bei der Ausgestaltung<br />
und Umsetzung von bestimmten Maßnahmen, bei denen<br />
immer stärker beispielsweise die <strong>Arbeit</strong>sverpfl ichtung und<br />
nicht die Frage nach den Entwicklungsperspektiven der<br />
Einzelnen im Vordergrund stehen. Wir haben es erlebt,<br />
dass die Maßnahmen dann nach den Kriterien, wie sie<br />
uns vorgegeben werden, laufen mussten und man gar<br />
nicht viel Auswahl bei der Gestaltung hatte.<br />
Die Befristung der Förderzeit ist ebenso ein Problem. Es<br />
wird nicht auf die Prozesse im Stadtteil geachtet, sondern<br />
nach schematisch vorgegebenen Zeiten und Problemlösungsstrategien<br />
vorgegangen. Dahinter steckt die Ideologie<br />
von den selbst tragenden Strukturen. Das hört man<br />
bei dem Projekt Soziale Stadt immer wieder, dass selbst<br />
tragende Strukturen geschaffen werden sollen. Der Stadtteil<br />
muss in die Lage versetzt werden, mit allen Problemen<br />
selbst fertig zu werden. Das ist das alte Sich-überfl üssigmachen,<br />
was eigentlich nie eingetroffen ist. Das wird<br />
aber jetzt noch zusätzlich als „aktivierender Sozialstaat“<br />
beschrieben, worin eine ganze Menge Ideologie steckt.<br />
Schließlich gibt es dann auch noch das Sozialraum-Budget,<br />
was ich <strong>für</strong> Spielgeld halte. Jedenfalls bei uns wird es<br />
von einer Jury verteilt, die im Wesentlichen aus Politikern<br />
und Vertretern von Wohlfahrtsverbänden besteht. Die<br />
Betroffenen haben darauf gar keinen Einfl uss.<br />
Das Ganze ist widersprüchlich, um es mal vorsichtig<br />
positiv auszudrücken. Wir machen das trotzdem und wir<br />
machen das auch noch gerne, wir strengen uns an, denn<br />
viele Verbesserungen werden erreicht. Es wäre zynisch,<br />
das Quartiersmanagement nicht zu nutzen. GWA kann<br />
auch eine Strategie innerhalb des Quartiersmanagements<br />
sein, auch parallel dazu im Stadtteil laufen. Wir versuchen<br />
immer wieder, Ansätze von Gemeinwesenarbeit<br />
im Quartiersmanagement zu realisieren, zu erkämpfen,<br />
durchzusetzen, zu verhandeln, je nachdem, wen man als<br />
Gesprächspartner gewinnen kann. Wir versuchen jedenfalls,<br />
so viel Bürgerbeteiligung wie möglich in dem Projekt<br />
unterzubringen.<br />
Was ist das:Gemeinwesenarbeit? Ich will nur auf zwei<br />
Punkte hinweisen, die ich besonders wichtig fi nde. Das<br />
sind eigentlich ganz alte Sachen aus den 60er Jahren des<br />
vorigen Jahrhunderts. Der Gemeinwesenarbeiter bzw. die<br />
Gemeinwesenarbeiterin soll Anwalt und Organisator sein.<br />
Anwalt, das heißt, gemeinsam mit Betroffenen Stellung<br />
zu beziehen und sich öffentlich und aktiv zu äußern. Das<br />
ist eine Voraussetzung <strong>für</strong> eine wirksame Praxis. Die Men-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 83
84<br />
Workshop Stadtteil-Entdeckungen<br />
schen müssen wissen, dass wir uns dort <strong>für</strong> sie einsetzen,<br />
wo sie das selbst nicht können. Das ist allerdings ein kniffliger<br />
Prozess, bei dem man sich immer vor Entmündigung<br />
hüten muss. Er hat eine starke <strong>sozial</strong>politische und auf<br />
Öffentlichkeit gerichtete Wirkung. Dabei kann es dazu<br />
kommen, dass wir auch <strong>für</strong> die Betroffenen stellvertretend<br />
handeln und uns äußern müssen, was immer wieder<br />
die Legitimationsfrage aufwirft. Allerdings sollten wir<br />
<strong>für</strong> die Betroffenen nicht das erledigen, was sie selbst<br />
tun können, sondern ihnen gemeinsames solidarisches<br />
Handeln ermöglichen. Wir müssen zielbewusst auf Prozesse<br />
der Selbstorganisation hinwirken. GWA heißt dann:<br />
gezielte und nachhaltige Investition in kompetente Personen,<br />
beschützte Begleitung von Bevölkerungsgruppen,<br />
die sonst in der Gesellschaft nicht wahrgenommen werden.<br />
Dieser Organisationsprozess weist über die Anwaltsfunktion<br />
hinaus und gehört gleichzeitig dazu. Damit habe<br />
ich allerdings nichts Neues gesagt, das ist Bestandteil von<br />
GWA seit den 70er Jahren.<br />
Markus Runge: Angelika Greis und ich, wir kommen<br />
beide aus dem Nachbarschaftshaus Urbanstraße in Berlin,<br />
wo wir seit einigen Jahren als Stadtteilarbeiter aktiv<br />
sind, Angelika seit 2005 auch in der neuen Funktion als<br />
Stadtteilmanagerin.<br />
Ich will zunächst einen recht kritischen Blick auf Nachbarschaftshäuser<br />
und aktivierende <strong>Arbeit</strong> im Gemeinwesen<br />
wagen, dann wollen wir beide dialogisch ein paar Aspekte<br />
herausgreifen, Erfahrungen im Stadtteilmanagement,<br />
also im Programm Soziale Stadt, und in der Gemeinwesenarbeit<br />
jenseits des Programms Soziale Stadt, um dann<br />
in die Diskussion zu kommen.<br />
Zum Thema Nachbarschaftshäuser und aktivierende<br />
<strong>Arbeit</strong> im Gemeinwesen gab es in der Vergangenheit eine<br />
zuweilen recht heftige Diskussion, an der Dieter Oelschlägel<br />
nicht ganz unbeteiligt war. Für mich ist die damalige<br />
Diskussion darüber, ob Nachbarschaftshäuser vor allem<br />
das Gemeinwesen in den Mittelpunkt ihrer <strong>Arbeit</strong> stellen<br />
sollen oder eher die Einrichtung, nach wie vor nicht vorbei.<br />
Ich frage mich in den letzten Monaten häufi ger, wieso<br />
Gemeinwesenarbeit und Nachbarschaftshäuser immer<br />
noch so stark mit der Tradition der Settlement-Bewegung<br />
identifi ziert werden, aus der sie stammen. Gemeinwesenarbeit<br />
verstehe ich heute als hinausgehende <strong>Arbeit</strong><br />
mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit den Menschen<br />
im Stadtteil Handlungsspielräume zu fi nden und daran<br />
anknüpfend Lebensverhältnisse zu verändern, also eine<br />
starke Selbstbefähigung zu fördern.<br />
Ich fi nde, dieser <strong>Arbeit</strong>sansatz <strong>für</strong> Gemeinwesenarbeit<br />
unterscheidet sich sehr stark von dem <strong>Arbeit</strong>sansatz<br />
Nachbarschaftsarbeit, den man heute angebotsorientiert<br />
ganz viel in den Nachbarschaftshäusern fi ndet. Aus meiner<br />
Sicht steht Stadtteilarbeit oder Gemeinwesenarbeit<br />
immer noch in vielen Satzungen von Nachbarschaftshäusern<br />
als Begriff drin. Schaut man jedoch tiefer in die<br />
<strong>Arbeit</strong> hinein, dann fi nde ich selten Stadtteilarbeiter, die<br />
<strong>für</strong> bestimmte Stadtteile oder Kieze zuständig sind und es<br />
sich ganz konkret zur Aufgabe machen, hinauszugehen in<br />
den Stadtteil, dort von Bewohnern getragene Netzwerke<br />
aufzubauen, bürgerschaftliches, stadtteilbezogenes<br />
Engagement zu aktivieren und diese Menschen darin zu<br />
begleiten, die Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil<br />
zu verbessern.<br />
Ich bin ein Fan von Gemeinwesenarbeit. Ich fi nde es<br />
bedauerlich, dass es historisch betrachtet in den Nachbarschaftshäusern<br />
zwar eine Kernkompetenz Gemeinwesenarbeit<br />
gibt, ich diese aber heute in vielen Nachbarschaftshäusern<br />
nicht mehr sehe. Nachbarschaftshäuser<br />
vergeben sich meiner Meinung nach damit eine Chance,
wenn sie auf diese Kompetenz verzichten, die es ihnen in<br />
hohem Maße ermöglicht, sich aktiv in die Stadtteilentwicklung<br />
einzumischen, sich gemeinsam mit den dort wohnenden<br />
und arbeitenden Bürgern zu engagieren. Wenn<br />
wir z.B. ins Programm Soziale Stadt schauen, gerade auf<br />
Berlin bezogen, dann sind die Nachbarschaftshäuser<br />
zwar als lokale Akteure in den Quartiersmanagement- und<br />
Stadtteilmanagementgebieten vertreten. Aber sie spielen<br />
keine bedeutende Rolle als Gebietsbeauftragte, als Träger<br />
von Quartiersmanagements. Warum nicht? Vielleicht weil<br />
wir uns den ständigen Rollenkonfl ikt zwischen Legislative,<br />
Exekutive, Administration, Kommune und Stadtteilbevölkerung<br />
nicht zutrauen? Weil zunehmend basisorientierte<br />
Ansätze durch Reglementierung eingeschränkt werden?<br />
Weil es unbequem ist, diese <strong>Arbeit</strong> zu tun?<br />
Wenn man in den Bereich Community Organizing (CO)<br />
schaut, dann gibt es in Berlin ganz spannende Ansätze.<br />
Auch da sind wir oft nicht Initiator im Aufbau von Bürgerplattformen,<br />
sondern wenn überhaupt, dann eher Mitglied<br />
einer Bürgerplattform, zum Teil aber auch nicht mal das,<br />
obwohl wir in Gebieten des CO unseren Standort haben.<br />
Und Gemeinwesenarbeit jenseits von Community Organizing<br />
und Quartiersmanagement fi ndet sich aus meiner<br />
Sicht in den Nachbarschaftshäusern noch seltener, was<br />
aber umso wichtiger wäre, wenn man sich im Stadtteil<br />
nicht nur in der Zwangsjacke des Zuwendungsempfängers<br />
bewegen will.<br />
Ich komme aus dem Nachbarschaftshaus Urbanstraße,<br />
wo es seit etwa 30 Jahren eine Tradition von Gemeinwesenarbeit<br />
gibt, initiiert von Wolfgang Hahn. In den 90er<br />
Jahren haben wir dann den ersten Stadtteilarbeiter im<br />
Nachbarschaftshaus eingestellt. Aktuell haben wir sechs<br />
StadtteilarbeiterInnen und arbeiten in vier Stadtteilen<br />
Kreuzbergs. Davon drei Kolleginnen in der Düttmann-<br />
Siedlung, also in einem Stadtteilmanagementgebiet,<br />
fi nanziert über das Programm Soziale Stadt; drei StadtteilarbeiterInnen<br />
arbeiten in anderen Quartieren jenseits<br />
der Finanzierung über das Programm Soziale Stadt.<br />
Angelika steht jetzt eher in diesem Dialog zwischen uns<br />
<strong>für</strong> das Stadtteilmanagement, <strong>für</strong> das Programm Soziale<br />
Stadt und die Erfahrung damit, ich stehe hier eher <strong>für</strong><br />
die übrigen drei Gemeinwesenarbeitsbereiche oder Quar-<br />
tiere, in denen wir arbeiten. Wir wollen in einem relativ<br />
spontan gestalteten Dialog aus unseren Erfahrungen mit<br />
ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Ressourcen,<br />
Beteiligungsansätzen schauen, wo die Unterschiede<br />
liegen. Ich sehe den Ansatz Quartiersmanagement und<br />
das Programm Soziale Stadt eher kritisch. Ich glaube, ich<br />
könnte in dem Setting nicht arbeiten, aber ich lade euch<br />
dann ein, das Für und Wider dieser unterschiedlichen<br />
Ansätze zu diskutieren.<br />
Wir haben völlig unterschiedliche Rahmenbedingungen.<br />
Ich fi nde, ihr im Stadtteilmanagement Düttmann-Siedlung<br />
arbeitet eher in einer relativ engen Struktur an Rahmenbedingungen.<br />
In welchem Setting bewegt ihr euch?<br />
Angelika Greis: Es hat sich so entwickelt, dass die<br />
Düttmann-Siedlung ein Stadtteilmanagement hat. Mit<br />
3.000 AnwohnerInnen fällt die Siedlung ein bisschen<br />
aus den anderen Quartiersmanagements heraus, nicht<br />
nur aufgrund der Größe, sondern weil es eine reine<br />
Wohnsiedlung ist, es gibt ganz wenig Infrastruktur,<br />
kaum Gewerbe.<br />
Wir haben 2004 als Pilotprojekt angefangen, als die<br />
Senatsverwaltung an das Nachbarschaftshaus herangetreten<br />
ist und gefragt hat, ob wir die Fördergelder<br />
übernehmen. In den ersten 1 ½ Jahren hatten wir überhaupt<br />
keine Stellen, nun haben wir eine 20-Stunden-<br />
Stelle und Unterstützung durch die Geschäftsführung,<br />
teilweise bist auch du dabei.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 85
86<br />
Workshop Stadtteil-Entdeckungen<br />
Es gab also Geld, das kam von der Senatsverwaltung <strong>für</strong><br />
Stadtentwicklung. Aber da hatten wir eine ganz kompetente<br />
Regionalsachbearbeiterin, die uns unterstützt hat.<br />
Wir haben dann eine Initiative gegründet, mit Akteuren,<br />
die schon vorher vor Ort in der Trägerrunde gearbeitet<br />
haben, und Bewohnern und Bewohnerinnen. Wir mussten<br />
ganz schnell Strukturen aufbauen, um diese Gelder<br />
zu verteilen. Es ging dann um Bewilligungsanträge, wir<br />
mussten überhaupt erst mal durchblicken, was wie und<br />
wo beantragt werden muss, wie Förderanträge gestellt<br />
werden müssen. Im Juni 2005 kamen wir aus dem Pilotprojekt<br />
raus und ins Stadtteilmanagement. Seitdem<br />
merken wir, dass die Rahmenbedingungen immer enger<br />
werden.<br />
Die Senatsverwaltung gab dann die Aufgabe an die<br />
Bezirksleiter mit dem Hinweis weiter, dass die Stadtteile<br />
auch eine Hausaufgabe des Bezirkes sind. So wurde der<br />
Rahmenvertrag zwischen Senatsverwaltung, dem Bezirk<br />
und dem Nachbarschaftshaus abgeschlossen. Es gab<br />
die unterschiedlichsten Kooperationsrunden mit dem<br />
Bezirk, Steuerungsrunde, Lenkungsrunde usw. Ich kann<br />
da Herrn Oelschlägel Recht geben, es ist teilweise ein<br />
Kampf. Es gibt die Interessen des Bezirkes, es gibt die<br />
Interessen der Senatsverwaltung, die aber immer mehr<br />
an den Bezirk abgegeben hat, und wir hängen als Vor-Ort-<br />
Büro oft dazwischen. Es werden z.B. Entscheidungen von<br />
BewohnerInnen gefällt, die dann der Bezirk nicht <strong>für</strong> gut<br />
erachtet. Dieses Problem gibt es überall. Wir sind auch im<br />
Austausch mit allen QuartiersmanagerInnen in Friedrichshain-Kreuzberg,<br />
da sind einige an den immer enger werdenden<br />
Rahmenbedingungen gescheitert. Die Fördermittel<br />
sind oft nur unter größter Mühe zu bekommen,immer<br />
wieder muss jeder beantragte Cent umgewidmet werden,<br />
wenn es auch nur kleinste Abweichungen von der Planung<br />
gibt.Was uns in der <strong>Arbeit</strong> hier einengt, das sind defi nitiv<br />
diese undurchschaubaren Förderregelungen, die aber<br />
von der EU vorgegeben werden.<br />
Das sind die Rahmenbedingungen, die uns am meisten<br />
einengen. Es werden im Quartiersrat Entscheidungen<br />
gefällt, die auf der Stelle umgesetzt werden müssten.<br />
Aber bis es so weit kommt, dass Anträge vom Bedarf über<br />
Ausschreibungen zu Fachämtern gelangen, und wer da<br />
noch alles involviert ist, bis etwas endlich durchgeführt<br />
werden kann, ist viel Zeit vergangen und ein sehr großer<br />
Teil des Bewohner-Interesses verpufft.<br />
Wenn wir in der Düttmann-Siedlung Träger kontaktieren und<br />
fragen, ob sie Anträge zu unseren Ausschreibungen stellen<br />
wollen, lehnen es viele wegen der <strong>für</strong>chterlichen Rahmenbedingungen<br />
ab. Sie sagen, dass der Verwaltungsaufwand<br />
insbesondere <strong>für</strong> kleine Projekte zu groß ist.<br />
Markus Runge: Nach einer Ausschreibung wurde die<br />
Düttmann-Siedlung als festes QM-Gebiet festgelegt. Das<br />
Nachbarschaftshaus hat dagegen die anderen drei Stadtteile<br />
selber gewählt, entsprechend der Gebietskenntnis<br />
und den Beobachtungen über Entwicklungen im Stadtteil<br />
haben wir gesagt, dass wir stärker in diesem Stadtteil<br />
oder in jenem arbeiten müssen. Das heißt, wir wählen<br />
schon mal den Stadtteil frei, in dem wir aktiv sind.<br />
Wir haben auch keine Vorgaben zum Aufbau bestimmter<br />
Strukturen, also es braucht in unserer <strong>Arbeit</strong> keinen Quartiersrat,<br />
keine Steuerungsrunde, das ist alles eher frei<br />
gestaltbar, organisatorisch und auch inhaltlich. Während<br />
ihr in der Düttmann-Siedlung ein Handlungskonzept habt,<br />
gucken wir eher regelmäßig im Gespräch mit den Menschen<br />
vor Ort, welches die Themen sind, die die Leute<br />
berühren und wo sich Menschen fi nden, die <strong>für</strong> diese Themen<br />
aktiv werden wollen.<br />
Ihr habt relativ regelmäßig Kontakte zum Bezirksamt, zu<br />
Stadträten, ihr könnt immer anrufen, und ihr erreicht relativ<br />
leicht die Leute. Unser Kontakt zum Bezirk gestaltet<br />
sich dagegen relativ schwierig. Dass es <strong>für</strong> euch so viel<br />
leichter ist, liegt vielleicht daran, dass ihr als Stadtteilmanagement<br />
sozusagen von oben eingesetzt seid. Dennoch<br />
schätze ich unsere Unabhängigkeit, dieses freie Agieren.<br />
Du hast schon von der Finanzierung gesprochen: ihr habt<br />
eine Grundfi nanzierung, zusätzlich bestimmte Fördertöpfe,<br />
auf die ihr Zugriff habt, bei all dem aber sehr viel<br />
Bürokratie.<br />
Bei uns ist das recht anders. Wir haben zwei halbe Stellen<br />
<strong>für</strong> Stadtteilarbeit in zwei Stadtteilen, von denen<br />
jeder etwa 15.000 Einwohner hat. Außer diesem Personal<br />
haben wir geringfügige Projektmittel. Das heißt<br />
<strong>für</strong> unsere Vorgehensweise, dass wir erst mal die Ideen
mit den Menschen vor Ort entwickeln, und erst dann die<br />
Frage stellen, woher das Geld da<strong>für</strong> kommen kann. Die<br />
Suche nach Finanzierung ist ein Schritt, der schon auch<br />
länger braucht. Aber mir erscheint dieses Vorgehen viel<br />
gesünder, nicht 100.000 Euro zu haben und am Anfang<br />
des Jahres überlegen zu müssen, wo<strong>für</strong> ich das Geld verwenden<br />
könnte, damit am Ende des Jahres auch alles<br />
ausgegeben ist. Ich fi nde es besser, so eine Freiheit zu<br />
haben, Geld dann zu beantragen, wenn ich weiß, wo<strong>für</strong><br />
ich es nutzen möchte. Auch nicht in Jahresscheiben zu<br />
denken, sondern Geld über Jahresscheiben hinweg ausgeben<br />
zu können.<br />
Angelika Greis: Das Handlungskonzept schränkt uns<br />
nicht ein. Wir haben die Vorgabe von einem Handlungskonzept<br />
mit neun Handlungsfeldern, das geht von Qualifi<br />
zierung, <strong>Arbeit</strong>, <strong>sozial</strong>er Infrastruktur bis zu Gesundheit,<br />
das ist fast ein politisches Programm. Die Bewohner bzw.<br />
der Quartiersrat entscheiden, welches Handlungsfeld <strong>für</strong><br />
sie momentan wichtig sind. In der Düttmann-Siedlung ist<br />
Qualifi zierung zum Beispiel ein sehr, sehr großer Aspekt.<br />
Darin steckt eine langfristige Perspektive. Und Qualifi zierung<br />
kann nicht alleine über die Bürgerbeteiligung laufen,<br />
weil man sich nicht selber qualifi zieren kann, es muss<br />
immer ein Know-how reinfl ießen.<br />
Aber wir haben gemerkt, dass durch diese vielen Handlungsfelder<br />
die Verantwortung immer größer wird. Es gibt<br />
viele Möglichkeiten, Pilotprojekte zu starten, wir haben<br />
durch die Gelder eine Infrastruktur schaffen können,<br />
wir haben einen Nachbarschaftstreff, wir konnten einen<br />
Kindertreff eröffnen, wir haben intergenerative Lernwerkstätten,<br />
wir haben Räume vom Jugendamt bekommen,<br />
wo Projekte stattfi nden können. Wir haben auch erreicht,<br />
dass einzelne Träger in der Siedlung bleiben und auch<br />
Migranten ins Programm wollen, um nachhaltige Strukturen<br />
aufzubauen.<br />
Aber das Problem ist, dass es Projekte gibt, die die AnwohnerInnen<br />
zwar erreichen, die gute Ansätze haben, aber<br />
dann nicht nachhaltig sind. Die Projekte können nicht<br />
über einen längeren Zeitraum erhalten werden. Der<br />
Bezirk hat kein Geld, der Senat hat kein Geld. Aber es<br />
läuft nicht von alleine, denn die Projekträume müssen<br />
gehalten werden, die <strong>Arbeit</strong> muss auch bezahlt werden,<br />
es kann nicht alles ehrenamtlich geleistet werden. Das<br />
steht irgendwie hinter diesem Programm Soziale Stadt,<br />
was Herr Oelschlägel auch gesagt hat, es ist ein Riesenprogramm,<br />
wo eigentlich zu jedem Punkt nur ein Tropfen<br />
auf den heißen Stein fällt. Wir können AnwohnerInnen<br />
keine <strong>Arbeit</strong> geben, vielleicht ein paar <strong>Arbeit</strong>splätze über<br />
den zweiten <strong>Arbeit</strong>smarkt, die sogenannten ÖBS-Stellen,<br />
wo AnwohnerInnen dann z.B. als Kiezlotsen mitarbeiten.<br />
Aber nachhaltige, stabile Strukturen aufzubauen, das<br />
ist eine Verantwortung und eine Aufgabe, wenn man die<br />
ernst nimmt, muss man täglich diesen Spagat machen,<br />
der eigentlich nicht möglich ist.<br />
Markus Runge: Dennoch, fi nde ich, liegen darin ganz<br />
viele Chancen. Über diese Stadtteilarbeit oder Stadtteilmanagementarbeit<br />
schaffen wir ganz viele Zugänge zu<br />
Menschen und entwickeln da ganz viel. Letztlich auch<br />
immer Dinge, die <strong>für</strong> das Nachbarschaftshaus eine<br />
Bereicherung sind. Einige <strong>Arbeit</strong>sbereiche, die wir jetzt<br />
im Nachbarschaftshaus haben, hätten wir nicht, wenn<br />
wir die Stadtteilarbeit nicht gehabt hätten und darüber<br />
ganz klar Dinge herausgefunden hätten, die wesentlich<br />
sind, und die wir dann geschaffen haben. Z.B. ein offenes<br />
Jugendzentrum, wir hätten dieses offene Jugendzentrum<br />
nicht übernommen, wenn wir nicht in diesem Stadtteil<br />
schon Stadtteilarbeit gemacht hätten. Der Bezirk sagte:<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 87
88<br />
Workshop Stadtteil-Entdeckungen<br />
ihr seid doch da eh schon aktiv, übernehmt doch bitte die<br />
Trägerschaft <strong>für</strong> dieses Jugendzentrum. Ich sehe darin<br />
eine große Chance, über Stadtteilarbeit die <strong>Arbeit</strong> der<br />
Nachbarschaftshäuser zu erweitern und anzureichern.<br />
Ich sehe viele Anknüpfungspunkte <strong>für</strong> Kooperation und<br />
eine große Nähe zum Bedarf und den Bedürfnissen von<br />
Menschen, woraus dann Dinge wachsen können.<br />
Letzter Punkt: Bewohnerbeteiligung. Ich glaube, da gibt<br />
es auch Unterschiede. Ihr habt eine stark vorgegebene<br />
Beteiligungsstruktur, wenn ich mir etwa den Quartiersrat<br />
anschaue. Vielleicht willst du dazu noch mehr sagen?<br />
Wobei ihr natürlich auch enorm spannende Ansätze<br />
habt.<br />
Angelika Greis: Es gibt den Quartiersrat, den kennen<br />
wahrscheinlich alle. Ein Gremium aus hauptsächlich<br />
BewohnerInnen und Trägern, die über die Projekte entscheiden.<br />
In der Düttmann-Siedlung haben wir es durchgesetzt,<br />
dass alle Quartiersratsmitglieder aus der Bewohnerschaft<br />
MigrantInnen sind, unsere gesamte <strong>Arbeit</strong><br />
passiert mit MigrantInnen. Sie stellen Projekte vor und<br />
entscheiden darüber. Die einzige Bremse sind aber immer<br />
wieder unsere Richtlinien: dass Fördergelder bis zu einem<br />
bestimmten Zeitpunkt ausgegeben werden müssen; dass<br />
Projektideen in die Fördertöpfe reinpassen müssen. Das<br />
ist <strong>für</strong> uns immer wieder ein Riesenspagat und teilweise<br />
auch nicht machbar. Dass die Gelder in Jahresscheiben<br />
eingeteilt sind. Das sind so die Probleme, die es gibt. Aber<br />
prinzipiell ist dieser Quartiersrat <strong>für</strong> die Bewohnerschaft<br />
schon ein wichtiges Gremium <strong>für</strong> die Auseinandersetzung.<br />
Die Bewohnerbeteiligung passiert auch in den einzelnen<br />
Projekten. Alle Projekte sollen Partizipation und Eigenverantwortung<br />
beinhalten.<br />
Georg Zinner: Ich teile die Auffassung nicht. Bei uns<br />
machen wir klassische Gemeinwesenarbeit und sehr<br />
viele konkret nützliche Sachen. Und wir sind nicht mehr<br />
abhängig vom Senat und von Zuwendungen. Wir sind<br />
Akteure, die mittlerweile so stark in der Region und im<br />
Bezirk sind, dass der Bezirk uns braucht, der Bezirk ist<br />
von uns abhängig. Wir können Dinge bewegen mit den<br />
Bürgern zusammen, Sachen machen, die einen prak-<br />
tischen Nutzen haben. Wenn eine Schule unzufrieden<br />
ist mit der Ganztagsbetreuung, aber keine Initiative vonseiten<br />
des Schulleiters da ist, den Träger zu wechseln,<br />
dann können wir mit den Eltern zusammen da<strong>für</strong> sorgen,<br />
da<strong>für</strong> gibt es praktische Beispiele, dass ein Trägerwechsel<br />
stattfi ndet. Oder wenn ein Jugendfreizeitheim saniert<br />
werden muss, dann sind wir in der Lage, das zu tun und<br />
eine Einrichtung zu erhalten und weiterzuentwickeln zu<br />
einem Nachbarschaftszentrum, eine Infrastruktur zu entwickeln,<br />
in der Bürger aller Altersstufen sich treffen und<br />
auch wieder betätigen können.<br />
Wir sind ständig im Austausch mit den Leuten, in ständiger<br />
Kommunikation. Wir haben vor kurzem ein Ehrenamtsfest<br />
gemacht, zu dem wir 900 Ehrenamtliche eingeladen<br />
haben. Das sind Leute, die bei uns in die Strukturen<br />
eingebunden sind, die haben was zu sagen, die reden mit.<br />
Die sind natürlich ein Potenzial auch dem Bezirk gegenüber<br />
oder gegenüber den politischen Entscheidungsträgern<br />
und die mischen sich in alles ein. Wir schaffen <strong>für</strong><br />
sie Zugänge und stellen auf diese Art <strong>für</strong> sie Qualität her.<br />
Eines meiner Lieblingsworte ist: wir geben an die Gesellschaft<br />
einen aktiven Bürger wieder zurück. Das ist <strong>für</strong><br />
mich praktische Gemeinwesenarbeit. Und die verstehe<br />
ich auch als Stadtteilarbeit.<br />
Heute hatten wir eine Diskussion darüber, wie wichtig<br />
Schulen sind, mit dem Bezirksamt und dem Jugendamt<br />
in Schöneberg. Die Leute ziehen weg, wenn bestimmte<br />
Strukturen in einem Bezirk nicht mehr stimmig sind und<br />
der Stadtteil absackt. Da kannst du so viel Stadtteilarbeit,<br />
Gemeinwesenarbeit oder Quartiersmanagement machen,<br />
wie du möchtest, das nutzt gar nichts, wenn die Schule<br />
nicht super funktioniert. Dazu können wir aber einen Beitrag<br />
leisten – und das machen wir auch.<br />
Thomas Mampel: Ich will etwas zu der These sagen, dass<br />
Nachbarschaftshäuser und Stadtteilzentren zu wenig<br />
Gemeinwesenarbeit machen. Wenn es so wäre, wäre es<br />
natürlich hochgradig bedauerlich, aber ich kann diese<br />
Beobachtung in der Tat nicht nachvollziehen. Ich komme<br />
aus Steglitz-Zehlendorf, das ist der Bezirk der Schönen<br />
und Reichen. Wir haben natürlich kein Quartiersmanagement,<br />
sind nicht Fördergebiet des Programms Soziale
Stadt, aber trotzdem gibt es da ganz viele Kieze und<br />
Sozialräume, die natürlich Stadtteilarbeit brauchen, die<br />
Gemeinwesenarbeit brauchen.<br />
Unser Verein bekommt aus dem Stadtteilzentrumsvertrag<br />
eine Förderung von 95.000 Euro, also selbst wenn wir<br />
wollten, könnten wir niemals sechs Leute als Stadtteilarbeiter<br />
beschäftigen. Für uns ist also vollkommen klar,<br />
dass alle Projekte, alle Einrichtungen, die wir in den Kiezen,<br />
Sozialräumen und Stadtteilen entwickeln, mit dem<br />
Auftrag an die <strong>Arbeit</strong> gehen, sich <strong>für</strong> den Stadtteil zu öffnen,<br />
in den Stadtteil zu wirken. Im Prinzip muss unsere<br />
Kitaleiterin Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit machen,<br />
im Prinzip macht unser Jugendarbeiter Stadtteil- und<br />
Gemeinwesenarbeit. Ich glaube, Nachbarschaftshäuser<br />
beweisen das durch ihr tägliches Handeln, dass Gemeinwesenarbeit<br />
und Stadtteilarbeit eine sehr hohe Priorität<br />
haben. Z.B. die Kooperation mit Outreach ist nichts<br />
anderes als der Versuch, auf diesem Gebiet Stadtteil- und<br />
Gemeinwesenarbeit zu entwickeln, in der Kooperation mit<br />
Schulen etwa geht es immer darum, diese Einrichtungen<br />
zum Gemeinwesen zu öffnen.<br />
Sie sagten, Sie würden sich wünschen, dass Gemeinwesenarbeit<br />
sich nicht so eng an Sozialarbeit koppelt. Da<br />
ist meine Be<strong>für</strong>chtung oder meine Wahrnehmung, dass<br />
Quartiersmanagement eigentlich das gescheiterte Modell<br />
davon ist. Was passiert, wenn man Gemeinwesenarbeit<br />
von Sozialarbeit abkoppelt? Dann passiert aus meiner<br />
Sicht irgendwas sehr Technokratisches, was mit den<br />
Lebensverhältnissen und der <strong>sozial</strong>en Situation der Menschen<br />
nur noch begrenzt zu tun hat und was auch nicht<br />
nachhaltig wirkt. Wäre es da nicht sinnvoller, diese unendlichen<br />
Summen von Geld, die <strong>für</strong> Quartiersmanagement<br />
kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, in die Finanzierung<br />
von Nachbarschaftsheimen und Stadtteilzentren<br />
fl ießen zu lassen, damit da nachhaltig Stadtteilarbeit und<br />
Gemeinwesenarbeit entwickelt wird? Anstatt solche technokratischen,<br />
von den Bürgern entrückten Modelle zu<br />
machen, über deren Sinn man wirklich streiten kann.<br />
Dieter Oelschlägel: Zunächst mal möchte ich nicht gerne<br />
die alten Diskussionen führen, die bringen uns nicht weiter.<br />
Wir sollten uns lieber fragen, ob es nicht <strong>für</strong> jeden<br />
eine Form von Gemeinwesenarbeit gibt und es getrost<br />
den einzelnen Einrichtungen überlassen, welche Form<br />
der Gemeinwesenarbeit sie machen. Zu dem Punkt, dass<br />
ich beklagt hatte, dass GWA so eng an die Sozialarbeit<br />
gebunden war oder ist: Sozialarbeit wurde als Methode<br />
der Problembewältigung gesehen. Sie wurde dann mit<br />
der Einzelfallhilfe, der Gruppenarbeit und der Gemeinwesenarbeit<br />
in einen Topf geschmissen und immer wenn<br />
es kritisch wurde, auch wenn zum Beispiel viele <strong>sozial</strong>e<br />
Probleme auftauchten, dann hat die Gemeinwesenarbeit<br />
sich zurückgezogen und wurde dann Gruppenarbeit und<br />
Einzelfallhilfe. Es wurde sehr viel Betreuungsarbeit und<br />
<strong>für</strong>sorgliche <strong>Arbeit</strong> gemacht und wenig Aktivierung und<br />
Selbstorganisation. Andererseits hatte sich Gemeinwesenarbeit<br />
eben wie Sozialarbeit immer auf die <strong>sozial</strong>en<br />
Fragen beschränkt und wenig auf die <strong>Arbeit</strong>s- und Wirtschaftsfragen<br />
konzentriert.<br />
Wir sollten die lokale Ökonomie fördern, das betrachte ich<br />
als eine sehr wichtige Aufgabe von Gemeinwesenarbeit.<br />
Die kleinen, oft ausländischen Geschäftsleute zu organisieren,<br />
damit sie eine Macht werden, das ist dann nicht<br />
mehr Sozialarbeit im engen Sinn.<br />
Gerd Schmitt: Bei uns in Schöneberg-Nord, auch ein QM-<br />
Gebiet, hat sich inzwischen die Sozialraumorientierung<br />
der Jugendhilfe entwickelt. Sie spielt eine wichtige Rolle,<br />
weil das ganze System von Vernetzung und Nachhaltigkeit<br />
damit auf ganz andere Füße gestellt wird.<br />
Aber ich muss dem beipfl ichten, dass man mit den Mitteln,<br />
so wie sie jetzt im Programm Soziale Stadt eingesetzt<br />
werden, wesentlich Sinnvolleres machen könnte, weil wir<br />
im Moment Parallelstrukturen haben. Einerseits haben<br />
wir im Rahmen der Sozialraumorientierung bestimmte<br />
Strukturen, auch von guter, gewachsener Zusammenarbeit.<br />
Andererseits ein System der Sozialen Stadt. Es wird<br />
zwar versucht, diese beiden Dinge zu verbinden, aber das<br />
gelingt nicht immer. Zum Beispiel sind Quartiersräte oft<br />
ambivalent. Auf der einen Seite Partizipation, wunderbar,<br />
auf der anderen Seite werden oft nicht – so ist es<br />
bei uns – die Schwerpunkte umgesetzt, die im Sinne der<br />
Nachhaltigkeit wichtig wären. Schwerpunkte wären etwa<br />
das Anknüpfen an Schulen und Kitas. Das ist <strong>für</strong> die Ent-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 89
90<br />
Workshop Stadtteil-Entdeckungen<br />
stehung von Nachhaltigkeit ein entscheidender Punkt.<br />
Weshalb ich der These widersprechen würde, dass jetzt<br />
weniger Gemeinwesenarbeit gemacht wird. Wenn ich das<br />
auf uns beziehe: in den letzten 20 Jahren sind wir von<br />
einer auf das Haus fi xierten und begrenzten Einrichtung<br />
dahin gekommen, dass wir ganz viele Einrichtungen in<br />
dem Stadtteil haben, ein Netz aus Kitas und Schulen,<br />
intensive Verbindung mit den Eltern. An all diesen Punkten<br />
fi nden heute die spannenden Prozesse statt. Das aber<br />
nachhaltig zu organisieren, das ist die Aufgabe.<br />
Wir haben Projekte, fi nanziert über Soziale Stadt, die zum<br />
Beispiel Zugänge der Eltern zu Kitas verändert haben,<br />
also dass die Kinder früh in die Kita gehen, dass die Übergänge<br />
gestärkt werden zwischen Kita und Grundschulen,<br />
dass Eltern sich in den Schulen beteiligen. Das sind Prozesse,<br />
die nach dem Ende des Projekts nicht einfach in<br />
sich zusammen fallen, sondern sie haben eine stabile<br />
Qualität von nachhaltiger Beteiligung gewonnen. Das ist<br />
<strong>für</strong> mich eine Frage der Steuerung, wie diese Mittel in<br />
nachhaltige Strukturen einfl ießen. Grundsätzlich kritisiere<br />
ich die Tatsache, dass im Prozess des Quartiersmanagements<br />
zuviel Energie <strong>für</strong> die Abwicklung verloren geht.<br />
Ich denke, wenn man eine übergreifende Struktur hat, wo<br />
alle Beteiligten in einem Stadtteil auch eine gemeinsame<br />
Strategie entwickeln, dann müssen dort die Gelder einfl<br />
ießen. Warum soll man nicht die Mittel beispielsweise<br />
der Jugendämter verstärken, mit denen man zusammen<br />
Projekte entwickelt, statt sie in eine eigene Institution wie<br />
das Quartiersmanagement zu geben. Ich hielte das <strong>für</strong><br />
effektiver und langfristiger.<br />
TN: Es wurde gesagt: wir geben den Bürgern die Einrichtung<br />
zurück. Das fi nde ich auch und ich glaube, wir sind<br />
die Einzigen, die dazu in der Lage sind. Trotzdem würde<br />
ich mir ein bisschen mehr Ehrlichkeit an der Stelle wünschen.<br />
Ich erlebe viele Fälle, in denen eine Kitaleiterin<br />
oder die Leiterin vom Schulhort nicht in der Lage sind, die<br />
<strong>Arbeit</strong> der Verbindung zu den Anwohnern zu leisten, weil<br />
sie in ihren Aufgabenfeldern schon überlastet sind. Was<br />
wir gerne wollen und wichtig fi nden und woran wir auch<br />
arbeiten, nämlich rausgehen aus der Einrichtung in das<br />
Wohnumfeld der Menschen, das können sie nicht zusätzlich<br />
erbringen. Wir müssen also überlegen, wie wir diesen<br />
Anspruch auch wirklich umsetzen können.<br />
Im Zusammenhang mit der Sozialraumorientierung bin ich<br />
in Berlin durch relativ viele Bezirke gekommen, durch Sozialraumrunden,<br />
Kiezrunden u.ä., die ich begleitet habe. In<br />
diesen Runden meint man häufi g: wenn es Geld aus dem<br />
Quartiersmanagement gab, dann ist es uns gelungen,<br />
auch Bürger stärker zu aktivieren. Wenn am Beginn eines<br />
Projekts Geld bereits da ist, um etwa die Schulhofgestaltung,<br />
die Öffnung des Schulhofs in den Sozialraum umzusetzen,<br />
ist das eine große Hilfe, um Bürger zu aktivieren.<br />
Und das Geld ist so auch besser eingesetzt, glaube ich,<br />
wenn die Kitaleiterin sich nicht darum kümmern muss, wo<br />
sie Gelder <strong>für</strong> die Schulhofgestaltung her bekommt, sondern<br />
sich mehr um die Bürger kümmern kann.<br />
Markus Runge: Also ich will die Diskussion jetzt auch<br />
nicht wieder aufgreifen mit der GWA, ich glaube, da gibt<br />
es einfach eine unterschiedliche GWA-Defi nition. Nachbarschaftshäuser<br />
machen ohne Frage eine sehr nützliche<br />
<strong>Arbeit</strong>, und solche Häuser in den Stadtteil zu öffnen und<br />
sie so den Bürgern zurückzugeben, ist wichtig.<br />
Was mich interessieren würde: Haltet ihr denn den Ansatz<br />
dieser hinausgehenden <strong>Arbeit</strong> <strong>für</strong> falsch, weil ihr ihn aus<br />
meiner Sicht nicht in dem Maße praktiziert wie wir? Oder<br />
wie betrachtet ihr diesen Ansatz der hinausgehenden<br />
stadtteilbezogenen <strong>Arbeit</strong>? Und an Thomas Mampel: Du
hast dieses Quartiersmanagement so ein Stück kritisiert<br />
als den falschen Ansatz, aber ich sehe darin ja auch eine<br />
Chance, so wie es Dieter Oelschlägel auch gesagt hat.<br />
Nur war ja die Beobachtung 1999, dass kein Nachbarschaftshaus<br />
Träger von einem Quartiersmanagement<br />
wurde, 2005 waren es dann zwei oder drei, die in die<br />
Trägerschaft von Quartiersmanagement kamen. Ich stelle<br />
mir da die Frage, welche stadtteilbezogenen Kompetenzen<br />
hatten wir offensichtlich nicht?<br />
In der Düttmann-Siedlung hatten wir bereits eine Steuerungsrunde,<br />
bevor das Stadtteilmanagement überhaupt<br />
begonnen hatte, nämlich die Trägerrunde, die wir dort<br />
aufgebaut hatten.<br />
Diese hohe Gebietskompetenz, die wir als Träger hatten,<br />
die hat uns automatisch qualifi ziert, dort Träger des QM<br />
zu werden. Jetzt kann ich mir in ganz Berlin ganz viele<br />
Quartiersmanagementgebiete angucken, wo es Nachbarschaftshäuser<br />
gibt, die aber nicht dazu gekommen sind,<br />
Träger von Quartiersmanagement zu werden. Da frage ich<br />
mich, was hat denen denn an Kompetenz gefehlt, dass<br />
sie diese Chance nicht bekommen haben? Denn aus<br />
meiner Sicht sollten Nachbarschaftshäuser genau diese<br />
Rolle übernehmen, da sie vor Ort bleiben, auch wenn das<br />
Quartiersmanagement ausläuft.<br />
Georg Zinner: Wir haben uns auch immer stark da<strong>für</strong><br />
gemacht, dass die Nachbarschaftshäuser Quartiersmanagementaufgaben<br />
übernehmen und diese Gelder nutzen.<br />
Um wenigstens aus diesem schlechten Programm<br />
das Beste zu machen und es zu verbinden mit den etablierten<br />
Systemen, die da sind und nachhaltig sind. Die<br />
man auch damit weiterentwickeln kann, um einen Qualitätssprung<br />
zu erreichen. Aber den Glauben, dass mit<br />
dem Quartiersmanagement oder mit so einem Programm<br />
Soziale Stadt tatsächlich irgendwelche großen Veränderungen<br />
bewirkt werden, teile ich nicht. Kommunen nutzen<br />
dieses Programm, um bestimmte Schritte zu machen, die<br />
sie sonst auch machen würden. Falsch daran ist, dass<br />
sich Kommunen den Bürgern gegenüber mit diesem Programm<br />
immer das Interventionsrecht vorbehalten.<br />
Vielleicht noch mal zu der Forumlierung, wir geben unsere<br />
Einrichtung den Bürgern zurück: das ist ein ständiger Pro-<br />
zess, der hört nie auf. Jede Institution, auch wir, unterliegen<br />
ständig der Gefahr, dass wir uns selbst genügen<br />
und uns als Organisation zufrieden stellen, aber nicht die<br />
Bürger. Das ist eine Daueraufgabe, man muss sich dieser<br />
Gefahr bewusst sein.<br />
Zum Aktivieren der Bürger: das ist <strong>für</strong> mich ein schwer zu<br />
schluckender Begriff. Ich fi nde, es steht uns nicht zu, die<br />
Bürger zu aktivieren. Es steht uns nicht zu, weil die Bürger<br />
ihre eigenen Interessen haben, man muss sich keine<br />
Sorgen machen, sie sind hochaktiv an ganz vielen Stellen.<br />
Wenn sie es dann sind, dann soll man bitte darauf achten<br />
und sie unterstützen und begleiten und fördern.<br />
Es gibt unendlich viele Initiativen in Berlin, wir sind gar<br />
nicht in der Lage, das alles aufzunehmen, was es gibt.<br />
Bürgeraktivierung ist in meinen Augen alles, was mit<br />
ehrenamtlichem und bürgerschaftlichem Engagement zu<br />
tun hat. Die Leute engagieren sich selber. Und sie tun das<br />
nicht, weil wir dazu aufrufen, sondern sie wollen etwas<br />
tun und wir müssen viele Zugänge und Gelegenheiten<br />
schaffen, damit sie es tun können. Das ist unser Job. Und<br />
sie müssen es nach ihrer Facon tun dürfen, nicht nach<br />
unseren Vorstellungen. Wir dürfen selbstverständlich ein<br />
Angebot machen. Bei der Einführungsveranstaltung <strong>für</strong><br />
unsere neuen Mitarbeiter geht es auch um ehrenamtliche<br />
Mitarbeit. Die ist <strong>für</strong> uns das Innovationspotenzial<br />
schlechthin. Ehrenamtliche Mitarbeit und Bürgerengagement<br />
fi ndet nur dort statt, wo herkömmliche Institutionen<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 91
92<br />
Workshop Stadtteil-Entdeckungen<br />
versagen und irgendwas nicht mehr stimmig ist in unserer<br />
Gesellschaft, wo etwas nicht mehr zusammenpasst, da<br />
engagieren sich Bürger. Wir müssen uns keine Gedanken<br />
machen, außer denen, wie wir eine Struktur schaffen können,<br />
dass dieses Engagement unterstützt wird. Wie können<br />
wir dazu beitragen, dass Bürger ihre Ziele erreichen?<br />
Hinschauen, registrieren, was passiert und das dann unter<br />
Umständen wie ein Katalysator verstärken und unterstützen,<br />
das sehe ich als unsere Aufgabe an. Man kann das<br />
mit ganz einfachen Mitteln machen. Wir haben seit fünf<br />
Jahren eine Stadtteilzeitung, die es einmal im Monat gibt.<br />
Das macht eine ehrenamtliche Redaktion unter Anleitung<br />
einer Honorarkraft, aber die Ehrenamtlichen bestimmen,<br />
das Nachbarschaftszentrum nimmt auf die Redaktion keinen<br />
Einfl uss. Die rein ehrenamtlichen Redakteure dürfen<br />
da schreiben und veröffentlichen, was sie wollen. Die Zeitung<br />
erscheint in einer Aufl age von 10.000, inzwischen<br />
trägt sie sich fi nanziell sogar fast selbst, anfangs haben<br />
wir das subventioniert. Das ist ein wichtiges Medium in<br />
Schöneberg-Steglitz geworden. In der Quartiersmanagement-Zeitung<br />
dürfen die Leute nicht schreiben, was sie<br />
wollen, ich glaube, das sind auch ehrenamtliche Redakteure.<br />
Das ist genau der Unterschied. Wir haben die Kraft<br />
und die Möglichkeit, so etwas zu machen. Aber da will<br />
ich nicht sagen, dass wir die Bürger aktiviert haben. Es<br />
war unsere Idee, so eine Stadtteilzeitung zu machen, wir<br />
haben es gemacht, es haben sich Leute gemeldet und<br />
seitdem läuft das Ding. So einfach kann es sein, wir müssen<br />
gar nichts groß machen, da kommen die Themen<br />
schon auf den Tisch. Ich gebe es sozusagen auch wieder<br />
ein Stück weit den Bürgern in die Hand, die haben das<br />
Medium, die haben eine verlässliche Infrastruktur durch<br />
das Nachbarschaftsheim, damit diese Zeitung erscheinen<br />
kann.<br />
Bahar Sanli: Ich würde Ihnen bei der Herangehensweise<br />
vollkommen zustimmen, nur würde ich sagen, zu meiner<br />
Aufgabe als Stadtteilarbeiterin zählt es auch, zu aktivieren.<br />
In dem Sinne zu aktivieren, dass ich zum Beispiel<br />
rausgehe, durch Gespräche und Beobachtungen herausfi<br />
nde, was ist das Interesse, was sind die Bedürfnisse<br />
der Stadtteilbewohner? Es gibt viele Interessensgruppen<br />
oder einzelne Personen, die sich nicht aus eigener Initiative<br />
heraus ehrenamtlich und freiwillig engagieren, in<br />
irgendwelche Vereine oder Initiativen eintreten oder die<br />
Angebote des Nachbarschaftshauses in Anspruch nehmen.<br />
Sie setzen sich mit Problemen ganz <strong>für</strong> sich alleine<br />
auseinander. Da sehe ich es als meine Aufgabe Informationen<br />
zu sammeln und herauszufi nden, wie ich sie begleiten,<br />
fördern und unterstützen kann. In dem Sinne wirke<br />
ich ja auch aktivierend ein, wenn ich sage, hier, es gibt<br />
Gleichgesinnte, die teilen mit dir das gleiche Problem, wir<br />
bieten euch die Strukturen, wir bieten euch die Räume,<br />
ihr könnt euch hier versammeln und wir können euch<br />
unterstützen. Solange der Einzelne sich in seine Wohnung<br />
zurückzieht und sich alleine mit den Themen wie<br />
z.B. Mietentwicklung oder Vermüllung auseinandersetzt,<br />
hat er keine Möglichkeiten, Einfl uss auf die Gestaltung<br />
seines Kiezes zu nehmen.<br />
Manchmal müssen Menschen da<strong>für</strong> motiviert werden,<br />
sich <strong>für</strong> ihre Ziele einzusetzen. Da<strong>für</strong> bin ich da, ich bin<br />
so eine Art Coach, ich bin da, um sie zu unterstützen,<br />
damit sie sich trauen und den Kontakt zu Gleichgesinnten<br />
aufsuchen. In dem Sinne sehe ich die Aufgabe von Stadtteilarbeit<br />
auch in der Aktivierung.<br />
Unter diesem Aspekt ist auch der Stellenwert der Vernetzungsarbeit<br />
zu bewerten. Entscheidend ist nicht unbedingt<br />
die Akquisition von Projektgeldern, sondern dass<br />
ich Ressourcen ausfi ndig mache und aktiviere. Hier will<br />
jemand was, dort gibt es jemanden, der diese Ressource<br />
hat und beide sind bereit <strong>für</strong> Ihren Kiez etwas zu tun. Wie<br />
kann ich diese Personen zusammenführen? Vielleicht<br />
kann man sogar ohne fi nanzielle Mittel Bürgern durch<br />
die Vernetzungsarbeit ermöglichen, etwas <strong>für</strong> den Kiez<br />
zu schaffen, nicht nur in Form von Festen, sondern auch<br />
in Form von z.B. einer Zeitung, die sie schließlich mit Hilfe<br />
einer im Kiez ansässigen Druckerei selbst produzieren.<br />
Georg Zinner: Einverstanden. Wir haben 1998 zum ersten<br />
Mal einen Flyer gedruckt, auf dem wir unsere Angebotsstruktur<br />
bekannt gemacht haben. Von dem Moment<br />
an mussten wir uns als Nachbarschaftszentrum keine<br />
Gedanken mehr machen, was wir anbieten, weil die Bürger<br />
mit so vielen Ideen und Vorschlägen kamen, was wir
machen sollten, dass wir fast getrieben waren, immer<br />
wieder Einrichtungen zu schaffen. Die enorme Vielfalt der<br />
Nachfrage hat gereicht, um eine unglaubliche Infrastruktur<br />
aufzubauen.<br />
Bahar Sanli: Für mich ist es aber auch wichtig, die Gruppen<br />
zu erreichen, die nicht auf diese Methoden anspringen.<br />
TN: Ich glaube, alle, die in diesem Bereich arbeiten, wissen,<br />
dass man Stadtteilarbeit nicht nach seinen eigenen<br />
Ideen machen kann. Aber egal auf welcher Ebene, ob das<br />
der Träger ist, ob das Bewohner sind, auf institutioneller<br />
Ebene, Kitas, Schulen, funktioniert eigentlich nichts von<br />
alleine. Es muss jemand in der Trägerrunde sein, der die<br />
Einladungen macht, die Tagesordnungspunkte, den Kleinkram<br />
organisiert. Quartiersrat, Bewohner, Kita-MitarbeiterInnen,<br />
Schulen, alle sind durch die starken Kürzungen<br />
völlig überfordert. Es ist so schwierig, diese Vernetzung<br />
zu machen, dass die Menschen miteinander reden und<br />
ihre Ressourcen nutzen. Es gibt viele Institutionen, die<br />
so in ihrer eigenen <strong>Arbeit</strong> verstrickt sind und gegen Kürzungen<br />
kämpfen, dass sie überhaupt keinen Blick mehr<br />
nach außen haben. Es muss sich jemand um Vernetzung<br />
kümmern.<br />
TN: Die Infrastruktur schaffen.<br />
Dieter Oelschlägel: Ich bin nicht ganz einverstanden,<br />
Georg, dass man allein mit der Bekanntmachung von Möglichkeiten<br />
die Menschen zum Handeln ermuntert. Denn<br />
damit erreicht man nur immer wieder dieselben Leute,<br />
die aktiv sind. Die, die immer still sind, die erreichst du<br />
nicht. Da müssen wir Methoden fi nden, denen auch die<br />
Möglichkeit zu geben sich zu äußern. Das heißt ja nicht,<br />
dass ich denen sagen muss, was sie machen sollen. Aber<br />
ich muss ihnen die Möglichkeit zur Äußerung geben. Zum<br />
Beispiel gibt es bei uns ein Zechengelände, das stillgelegt<br />
wurde, was jetzt neu überplant wird. Da kommt doch<br />
kein Mensch von sich aus auf die Idee, dass Bürger hingehen<br />
und mitplanen können, dass sie sogar eine eigene<br />
Planung machen können. Das müssen wir anregen. Und<br />
dann machen sie mit. Da reden wir ihnen dann auch nicht<br />
rein. Das haben die ganz prima gemacht und das ist jetzt<br />
in die zentrale Planung eingegangen. Das ist eine ganz<br />
tolle Sache. Aber wenn wir nicht den Anstoß mit einer<br />
Bürgerversammlung gegeben hätten, dann wäre das nie<br />
passiert. Daraus ist ein Beteiligungsprozess geworden.<br />
Gerd Schmitt: In der ganzen GWA-Debatte fi nde ich<br />
unsere Anwaltsfunktion wichtig, die auch beinhaltet, dass<br />
Beteiligung nicht von alleine entsteht. Wenn man Strukturen<br />
und Gelegenheiten zum Mitmachen schafft, entsteht<br />
daraus eine Aktivierung. Hinausgehen oder Nichthinausgehen,<br />
das muss es beides geben. Wir haben z.B. eine<br />
Familienberatung, und da sagen wir, das geht doch nicht<br />
mehr, dass die Familienberatung dort sitzt und wartet,<br />
bis sie angerufen wird. Sondern wir müssen an die Familien<br />
rankommen, die diese Hilfe brauchen und nicht in<br />
Anspruch nehmen. Diese Momente von hinausgehender<br />
<strong>Arbeit</strong>, mit der wir ganz viele Strukturen im Stadtteil schaffen<br />
in Verbindung mit den Regeleinrichtungen, das ist <strong>für</strong><br />
mich kein Gegensatz, sondern es gehört zusammen.<br />
Thomas Mampel: Ich brauche immer irgendwelche Bilder,<br />
um mir die Welt zu erklären. Bei dieser Diskussion<br />
Quartiersmanagement, Gemeinwesenarbeit, so wie wir<br />
sie als Nachbarschaftsarbeiter verstehen, fällt mir ein<br />
Bild aus der Software-Entwicklung ein. Es gibt Software-<br />
Buden wie Microsoft, die kommen mit einem fertigen<br />
Paket. Wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann<br />
kann man an Microsoft eine Fehlermeldung schicken.<br />
Wenn das mehrmals passiert, stürzt das System irgendwann<br />
ab. Dann gibt es aber auch eine andere Haltung von<br />
Software-Entwicklung, die mehr auf Open Source-Modelle<br />
setzt. Im Prinzip gibt es dann einen Kern von Angeboten,<br />
dann öffnen sie ihre Schnittstellen, öffnen ihre Systeme,<br />
da gibt es draußen in der Welt ganz viele fi tte Leute, die<br />
eine Idee dazu haben, wie man diese Software weiterentwickeln<br />
kann, wie man irgendwelche Applikationen bauen<br />
kann. Und so verstehe ich Gemeinwesenarbeit, wie wir sie<br />
als Nachbarschaftsheim oder Stadtteilzentrum machen,<br />
dass wir unsere Systeme öffnen, also das, was Georg<br />
meint mit möglich machen.<br />
Vor einem Jahr las ich an Litfasssäulen auf Plakaten der<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 93
94<br />
Workshop Stadtteil-Entdeckungen<br />
Diakonie: wir kümmern uns. Das ist genau das falsche<br />
Modell, also wir kümmern uns nicht, sondern wir machen<br />
möglich.<br />
Dieses Quartiersmanagement ist <strong>für</strong> mich so eine Denkwelt<br />
von Microsoft und Diakonie. Wir kümmern uns und<br />
hier hast du ein Angebot, wir nehmen dein Feedback<br />
dankend auf und entwickeln daraus was Neues, aber wir<br />
geben dir nicht die Möglichkeit, dir selbst dein Produkt<br />
zu entwickeln. Natürlich rennt auch unsere Kitaleiterin<br />
nicht ständig in den Stadtteil hinaus, das kann sie natürlich<br />
nicht, und auch nicht unser Hortleiter. Wir können<br />
nicht den ganzen Tag draußen im Stadtteil unterwegs<br />
sein, aber wir können unsere Systeme und Strukturen so<br />
bauen, dass sie sich <strong>für</strong> all diejenigen anbieten, die daran<br />
Interesse haben. Die an Projekten bauen, die irgendwelche<br />
Initiativen gründen und diese Struktur bzw. diesen<br />
Kern nutzen wollen. Da entsteht dann in einem Prozess<br />
Gemeinwesenarbeit. Das entwickelt sich immer weiter.<br />
Das ist ein komplett anderer Denkansatz als Quartiersmanagement.<br />
Gabriele Hulitschke: Ich arbeite seit ca. einem Jahr<br />
als Quartiersrätin am Magdeburger Platz, unmittelbar<br />
angrenzend an Schöneberg-Nord. Für mich ist das etwas,<br />
wo man praktisch sich selbst auch aktiviert, wenn man<br />
bürgerschaftliches Engagement erlebt. Ich erlebe das<br />
jetzt sogar öfter in migrantischen Kreisen, die noch diese<br />
andere Denkweise als Großfamilie haben. Es ist über den<br />
Stadtteilverein schon gelungen, <strong>für</strong> einen Mädchentreff<br />
auch Migrantinnen als Betreuerinnen zu engagieren.<br />
Oder dieses Lotsen-Brücke-Projekt, wo wirklich Frauen,<br />
die dieselbe Sprache wie die Bewohnerinnen sprechen,<br />
Ansprechpartner werden, die unabhängig von den Männern<br />
Inhalte vermitteln. Es gibt mittlerweile auch acht<br />
Frauengruppen in dem Gebiet. Da beginnt wirklich Kommunikation.<br />
Wir hatten das Projekt Magistrale, das fünf Jahre lang<br />
fi nanziert wurde. In diesem Jahr haben wir es geschafft,<br />
sie über einen Sponsor selber zu fi nanzieren. Seit dem<br />
letzten Jahr gibt es auch die Kinder-Magistrale, da machen<br />
Künstler Aktionen mit Kindern zu einer bestimmten Thematik.<br />
Das war dieses Jahr das Thema Geld im weitesten<br />
Sinne, also mit Schatz verbuddeln und einer Schnitzeljagd<br />
zu Kunstwerken, um so etwas zu erfahren. Das sind<br />
Sachen, die laufen zu einem hohen Prozentsatz ehrenamtlich<br />
ab, also die Künstler, die oft aus dem Quartier<br />
sind, engagieren sich auch ehrenamtlich. Während die<br />
Organisation, also Presse und die Gesamtkoordination,<br />
fi nanziert wird. Durch solche Veranstaltungen kommt<br />
auch eine Verbindung zum Einzelhandel zustande. Das<br />
sind Aktivitäten, die sind über die Jahre gewachsen.<br />
Daran hat das Stadtteilmanagement vom Magdeburger<br />
Platz einen hohen Anteil.<br />
TN: Die Stadtteileinrichtungen als Open Source, wo jeder<br />
zur Entwicklung beitragen kann, dieses Bild aus der Computer-Welt<br />
hat mir gut gefallen. Das setzt aber ein aktives<br />
Interesse bei allen voraus. Ein Beispiel: Am Kottbusser<br />
Tor gibt es seit vielen hunderten von Jahren Versuche,<br />
da eine Bewegung reinzubringen. Wir haben da mal<br />
einen arabischen Kollegen hingeschickt, der versuchte,<br />
mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Nach seiner<br />
Einschätzung sind 70 % der dort wohnenden arabischen<br />
Menschen Analphabeten. Was ich damit sagen will: wir<br />
brauchen das Hingehen zu den Menschen, man braucht<br />
diese direkte Kommunikation, um wichtige Informationen<br />
zu bekommen. Wir erreichen viele Menschen nur über<br />
unsere hinausreichende <strong>Arbeit</strong>, über Straßen<strong>sozial</strong>arbeit.<br />
TN: Als Gemeinwesenarbeiter und Mitarbeiter eines Nachbarschaftsheims<br />
gehe ich erst mal grundsätzlich davon<br />
aus, dass jeder Mensch was kann und jeder Mensch Möglichkeiten<br />
hat, sich einzubringen. Aber ich bin natürlich<br />
sehr begrenzt in meinen Möglichkeiten, alles zu schaffen.<br />
Ich muss zugeben, dass ich mit meinen Angeboten viele<br />
Leute nicht erreichen kann. Dennoch ist die Alternative<br />
nicht irgendein Programm, das mir sagt, aktiviere jetzt<br />
mal alle. Vielleicht müssen wir unsere Begrenztheit einfach<br />
akzeptieren?<br />
Georg Zinner: Ich will noch mal was zu Dieters Sorge<br />
sagen, dass wir sozusagen Dinge laufen lassen. Das<br />
machen wir nicht. Allein wenn wir informieren, dass es
diese Infrastruktur gibt, - Anfang der 80er Jahre haben<br />
wir das die offensive Information genannt – ist das ja eine<br />
aktive Handlung, das war eine Angebotseröffnung. Aber<br />
das hat dazu geführt, dass wir dann im Grunde genommen<br />
nur hinhören mussten.<br />
Natürlich haben wir auch aufgenommen, dass unser<br />
Stadtteil sich verändert hat, als die türkischen Familien<br />
zugezogen sind und haben eine türkische Einrichtung<br />
geschaffen, haben türkische Mitarbeiter eingestellt usw.<br />
Man muss eine offene Haltung gegenüber Veränderungen<br />
haben und dann Strukturen so aufbauen, dass<br />
sie genutzt werden können, dass sie zur Verfügung stehen,<br />
dass sie nicht an der Bevölkerung vorbei existieren.<br />
Bei vielen Institutionen ist das ja der Fall. Wer geht zum<br />
Beispiel schon freiwillig ins Gesundheitsamt? Aber zu uns<br />
kommen die Leute. Es gäbe bei uns kein stationäres Hospiz<br />
und vielleicht auch kein ambulantes Hospiz, wenn es<br />
nicht eine Gruppe von Ehrenamtlichen gegeben hätte, die<br />
zu uns gekommen ist. Sie waren inhaltlicher Träger dieser<br />
Projekte. Und unsere Stärke war, das aufzunehmen und<br />
auch die wirtschaftliche Stabilität von so einer Einrichtung<br />
sicherzustellen, denn das konnte die Gruppe alleine<br />
nicht leisten.<br />
Ein zweites Beispiel ist Al Nadi in Schöneberg, eine Einrichtung<br />
speziell <strong>für</strong> die arabische Bevölkerung. Das Bildungsproblem<br />
ist bekannt, sie bieten deshalb ehrenamtlich<br />
Alphabetisierungs- und Sprachkurse an. Daraus hat<br />
sich die Initiative von Studenten und Stipendiaten einer<br />
Stiftung entwickelt, die sagte, dass sich alle Stipendiaten<br />
ehrenamtlich engagieren sollten. Diese Stiftung bzw.<br />
diese Stipendiaten haben sich in Berlin zusammengetan<br />
und sorgen jetzt da<strong>für</strong>, dass dort genug ehrenamtliche<br />
Schüler Bildungshilfen <strong>für</strong> arabische Familien in Schulen<br />
anbieten, weil wir keinen Platz haben. So hat das angefangen<br />
und das weitet sich aus. Wir haben jetzt größte<br />
Problem, da organisatorisch hinterherzukommen, diesen<br />
ganzen Nachwuchs jetzt an die notwendigen Stellen<br />
zu transportieren, da<strong>für</strong> müssen wir uns eine Struktur<br />
überlegen, wie wir diese Ehrenamtlichen in die Familien<br />
bringen.<br />
Ein drittes Beispiel: Irgendwann war es eine Verpfl ichtung,<br />
auch <strong>für</strong> alle Einrichtungen des Nachbarschaftsheims,<br />
da es <strong>Arbeit</strong>slosigkeit eben gibt, auch <strong>Arbeit</strong> suchende<br />
Menschen zu beschäftigen, um mit zu ihrer Qualifi zierung<br />
beizutragen. Das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen.<br />
Aus diesem Kreis können wir dann auch wieder Regelarbeitsplätze<br />
besetzen. Es ist nicht so, dass wir da nur<br />
zuschauen, sondern natürlich ist man aktiv. Und eines der<br />
wichtigsten Mittel ist Transparenz, Offenheit und Information.<br />
Information ist schließlich Öffentlichkeitsarbeit, das<br />
ist sozusagen das Wichtigste überhaupt, dass die Leute<br />
wissen, dass es das gibt, dass sie kommen können und<br />
dass sie diese Institution bzw. deren Ressourcen <strong>für</strong> sich<br />
verwenden können.<br />
Ich glaube auch nicht, dass alle unsere Einrichtungen<br />
immer so ausgelastet sind, dass sie nicht auch Stadtteilarbeit<br />
machen können. Unsere Kitas sind glücklich, bei<br />
einem stadtteilorientierten Träger zu sein, auch diejenigen,<br />
die aus dem öffentlichen Dienst zu uns gekommen<br />
sind, das sind inzwischen die meisten bei uns. Ihnen<br />
haben sich neue Dimensionen erschlossen, denn vorher<br />
hatten sie den Stadtteil gar nicht im Blick. Dieser erweiterte<br />
Horizont ist eine Belastung, das ist richtig. Aber<br />
teilweise empfi nden sie diese zusätzliche Belastung als<br />
Gewinn durch die Erweiterung ihrer Möglichkeiten und<br />
ihrer Chancen. Und sie wollen Stadtteil-Kitas werden, also<br />
Einrichtungen, die hinausgehend arbeiten.<br />
Angelika Greis: Ich weiß von einem Praktikanten, der bei<br />
euch in der Einrichtung war, dass er eines Abends mit Kol-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 95
96<br />
Workshop Stadtteil-Entdeckungen<br />
legen durch die Straßen zog, um zu gucken, wo die Kinder<br />
und Jugendlichen sind. Er sagte, das ist dort Standard,<br />
das machen sie regelmäßig. Vielleicht weiß man da auch<br />
viel zu wenig voneinander. Ich kann nur sagen, dass wir<br />
als Nachbarschaftshaus und als Stadtteilmanagement<br />
gemerkt haben, dass Schulen und Kitas, wo 80 bis<br />
90 % Kinder aus Migrationsfamilien <strong>sozial</strong> benachteiligt<br />
sind, in einer völligen Überbelastung hängen. Sie tun, was<br />
sie können innerhalb ihres Kreises, aber sie gucken nicht<br />
mehr nach außen. Ich rede von solchen Einrichtungen,<br />
von denen es zahlreiche in Kreuzberg gibt, in Neukölln<br />
und in anderen Bezirken.<br />
Wenn man etwas gegen Analphabetismus tun will, ist<br />
ganz viel Beziehungsarbeit mit den Menschen notwen-<br />
dig, dass man erst mal mit denen redet, die am nächsten<br />
sind, Leute, die man im Vor-Ort-Büro kennen lernt.<br />
Dadurch entsteht, dass Leute aus der Isolation rauskommen.<br />
Also gerade in Gebieten mit den stark Benachteiligten,<br />
mit Dauerarbeitslosigkeit, ganz vielen Analphabeten,<br />
da entsteht durch die Beziehungsarbeit, dass Mütter<br />
auch mal sagen: ich nehme mir jetzt diesen Raum und<br />
gehe zum Alphabetisierungskurs. Es passiert eben viel<br />
über Beziehungsarbeit, über Kontinuität. Meine Kritik an<br />
dieser Projektarbeit ist die, dass die Leute alle ganz wichtige<br />
Beziehungen aufgebaut haben, bei Projektende aber<br />
dann nichts mehr nachfolgt. Insofern ist Kontinuität ein<br />
zentrales Element solcher Projekte.<br />
Wir haben ein Kiez-Lotsen-Projekt aufgebaut, das ist total<br />
wichtig, weil es in unserem Gebiet Menschen mit vielen<br />
unterschiedlichen Sprachen gibt, die von ihresgleichen<br />
aufgesucht werden. Diese Menschen kommen dann zu<br />
unserer Sozialberatung, viele kommen nur mit Zetteln,<br />
die sie nicht lesen können. Das ist nicht als bürgerschaftliches<br />
Engagement anzusehen. Das sind Leute, die sind<br />
überhaupt keine Bürger, weil sie keinen deutschen Pass<br />
haben und nicht als Bürger wahrgenommen werden, weil<br />
sie z.B. zehn Jahre lang in der Duldung lebten und nicht<br />
erwünscht waren. Das sind Bevölkerungsschichten, die<br />
kommen nicht einfach in die nächste Beratungsstelle,<br />
auch wenn sie am Kottbusser Damm ist. Die haben jetzt<br />
Lotsen, die sie da hinbringen, weil sie sonst nicht hingehen.<br />
Das ist natürlich auch eine <strong>Arbeit</strong>, die wir leisten<br />
müssen.<br />
TN: Das machen wir auch.<br />
TN: Aber das ist eine klare Kooperation mit dem QM, ich<br />
denke, es gibt viele gemeinsame Projekte im Bereich<br />
Gemeinwesenarbeit.<br />
TN: Aus meiner Sicht muss man schon sagen, dass über<br />
das Quartiersmanagement auf jeden Fall neue Ansätze<br />
in die Stadtteilarbeit gekommen sind, auch im Denken,<br />
auch in unserem Stadtteil. Beispielsweise dass man sich<br />
in bestimmten Gebieten wieder der lokalen Ökonomie<br />
zugewendet hat. Es gibt zumindest eine strategische<br />
Zusammenarbeit zwischen Stadtteilzentren, Gesundheitsamt,<br />
Jugendamt und Quartiersmanagement, um<br />
ganz bestimmte Punkte umzusetzen. Damit haben wir<br />
schon eine ganze Menge erreicht, ohne dass wir jetzt<br />
selbst Träger des Quartiersmanagements sind. Das ist<br />
ein Prozess, der in jedem Fall läuft. Ansonsten geht<br />
es generell darum, wie man mit einander pragmatisch<br />
umgehen kann, wenn wir es nicht in der Hand haben, das<br />
System so zu verändern, wie wir das eigentlich gerne hätten.<br />
Da sehe ich auch keine Entwicklung in den nächsten<br />
Jahren.<br />
Was die Quartiersräte angeht, ist meine Position ambivalent.<br />
Einerseits feiern wir sie als Beispiel <strong>für</strong> Partizi-
pation, das haben wir uns immer schon gewünscht usw.<br />
Aber wenn das Geld nicht dahinter wäre, was es dort zu<br />
verteilen gibt, würde dieses Modell in sich zusammenbrechen.<br />
Das sind zumindest meine Beobachtungen.<br />
Wenngleich darüber auch Menschen aktiviert wurden,<br />
die dann auch in irgendeiner Form weitermachen. Aber<br />
es entsteht durch das Quartiersmanagement eine Art<br />
von inszenierter Welt, ganz bestimmte Gremien, die nicht<br />
immer effektiv ist. Wenn dieses Geld direkt in die bereits<br />
vorhandenen Strukturen reinfl ießen würde, das ist meine<br />
These, wäre das effektiver.<br />
Walli Gleim: Mir war die Diskussion ein bisschen unbehaglich,<br />
weil ich fi nde, dass wir gegenseitig offene Türen<br />
eingerannt haben. Du hast das aber schon gesagt, dass<br />
es völlig klar ist, dass wir mit verschiedenen Herangehensweisen<br />
auch verschiedene Bedarfe angehen. Dass<br />
Bürger aus Schöneberg oder Steglitz ganz anders mit solchen<br />
Angeboten wie Raum, Infrastruktur, umgehen als<br />
analphabetische Araber, das ist ja völlig klar. Meine Frage<br />
ist aber: geht es nicht in Wirklichkeit darum, dass wir im<br />
Quartiersmanagement Finanzierungstöpfe haben, einhergehend<br />
aber mit hoch komplizierten Entscheidungsstrukturen,<br />
Antragsverfahren, skeptisch zu sehenden<br />
Beteiligungsmöglichkeiten, zahllosen Verwendungsnachweisen,<br />
und ein großer Teil der Ressourcen und Energien<br />
aufgefressen wird durch dieses endlos komplizierte<br />
Prozedere? Und dass einfach die großzügigen Grenzen<br />
und Spielräume, die wir uns wünschen, eben speziell im<br />
Bereich Quartiersmanagement nicht vorhanden sind. Da<br />
ist wirklich die Frage, wie man damit umgehen kann. Gibt<br />
es Möglichkeiten oder Entwicklungen, die die Sache verbessern?<br />
TN: Das ist die EU-Politik.<br />
TN: Das hat mit der EU nichts zu tun, das wird nur<br />
behauptet, aber das ist falsch.<br />
TN: In der Senatsverwaltung <strong>für</strong> Stadtentwicklung sieht<br />
man die Probleme mit dem Verwaltungsaufwand inzwischen<br />
auch. Es soll künftig einen kleinen Experimen-<br />
tierfonds geben, der diese Bürokratie abbauen soll <strong>für</strong><br />
bestimmte Bereiche. Da<strong>für</strong> soll ein Konzept entwickelt<br />
werden.<br />
TN: Es gibt ja kleinere Summen. Bei uns sind das 10.000<br />
Euro pro Jahr, die relativ unbürokratisch über einen sogenannten<br />
Aktionsfonds mit einer Jury ausgegeben werden<br />
können. Da können Bürger Anträge stellen. Aber der<br />
große Topf ist ganz schwer verfügbar zu machen.<br />
TN: Meines Wissens sind die Finanzen <strong>für</strong> das Quartiersmanagement<br />
eh begrenzt, also von der Planung her. Ich<br />
vereinfache jetzt und werfe Stadtteilarbeit und Gemeinwesenarbeit<br />
in einen Topf: es müsste ja dann darauf<br />
hinauslaufen, dass über die Bezirke die geplanten Mittel<br />
perspektivisch in diese Gemeinwesen- oder Stadtteilarbeit<br />
einfl ießen. Das Anliegen des Quartiersmanagements<br />
ist ja zu aktivieren, zu bewegen. Also darf man nicht aus<br />
dem Auge verlieren, dass das QM zwar nicht auf Dauer<br />
angelegt ist, aber doch auf längere Zeit natürlich, um da<br />
wirklich was in die Gänge zu kriegen. Was dann eventuell<br />
noch zusätzlich unterstützt werden muss, das muss man<br />
dann konkret sehen. Dann müssten ja eigentlich auch<br />
die Erfahrungen gerade aus dem Quartiersmanagement<br />
beim Wirtschaftsamt einfl ießen.<br />
Dann noch eine kurze Bemerkung: Flyer haben vor Jahren<br />
mal funktioniert. Meine Erfahrung ist in meiner Nachbarschaftsarbeit,<br />
dass Geschriebenes gar nicht mehr gelesen<br />
wird. Wenn man dagegen zielgerichtet Menschen<br />
anspricht und sagt: wir suchen das noch, kennst du nicht<br />
jemanden, dann passiert viel mehr. Ich arbeite in einem<br />
Nachbarschaftszentrum und wir machen auch Gemeinwesenarbeit.<br />
Wir erleben alle, dass der Staat sich zunehmend<br />
aus seiner <strong>sozial</strong>en Verantwortung rausnimmt und<br />
Aufgaben gerade an die Nachbarschaftseinrichtungen<br />
übergibt. Es wird von uns immer mehr erwartet, auch<br />
dass ehrenamtliche <strong>Arbeit</strong> geleistet wird. Natürlich brauchen<br />
wir die ehrenamtliche <strong>Arbeit</strong> nach wie vor, sie ist<br />
zum gegenseitigen Nutzen, sowohl <strong>für</strong> die Menschen, die<br />
sich engagieren, als auch <strong>für</strong> die Einrichtungen und Bürger,<br />
die sie benötigen. Aber ich habe doch zunehmend<br />
ein schlechtes Gewissen, wenn wir den Menschen nicht<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 97
98<br />
Workshop Stadtteil-Entdeckungen<br />
mal mehr das Fahrgeld geben können. Sehr viele Ehrenamtliche<br />
haben ein geringes Einkommen, sie engagieren<br />
sich, weil sie eben gebraucht werden wollen, weil sie ihr<br />
Können einbringen wollen. Und wir haben oftmals nicht<br />
die Möglichkeit, ihnen das Fahrgeld zu ersetzen. Ich fi nde,<br />
da müsste eine Lösung gefunden werden.<br />
TN: Ich habe noch eine Frage in die Runde. Mein Projekt<br />
ist im Ostteil der Bernauer Straße, unser Sozialraum ist<br />
kein Quartiersmanagementgebiet, aber drei Meter weiter<br />
links von der Bernauer Straße ist ein Quartiersmanagementgebiet.<br />
In Berlin ist es häufi g so, dass relativ wohlhabende<br />
mit sehr armen Gebieten aneinander grenzen. Wir<br />
grenzen an den Wedding und an den Prenzlauer Berg und<br />
haben im Haus sehr viele Besucher aus dem QM-Gebiet.<br />
Gibt es in der Runde Erfahrungen der Zusammenarbeit,<br />
die ich <strong>für</strong> meine <strong>Arbeit</strong> nutzen kann?<br />
Annette Maurer-Kartal: Unser Einzugsbereich liegt zum<br />
Teil im QM-Gebiet und zum Teil nicht. Warum das so ist,<br />
ist irgendwie unerfi ndlich, denn am Willmanndamm und<br />
an der Großgörschenstraße kippt nicht die Sozialstruktur<br />
um, sondern im Gegenteil, es zieht sich von Norden nach<br />
Süden, und ein Teil vom QM-Gebiet ist so, dass ich mich<br />
frage, warum man es drin haben wollte – es ist so. Frevelhafterweise<br />
besuchen Menschen über die willkürlich<br />
gezogene Sozialraumgrenze hinaus, also Menschen aus<br />
dem falschen Sozialraum, aus dem QM-Gebiet, den Stadtteilladen,<br />
der 300 Meter weit weg liegt. Das ist wirklich<br />
frevelhaft, weil man die <strong>Arbeit</strong> mit diesen Leuten nicht<br />
erwähnen darf. Es werden alle Projekte, die bestehen,<br />
ohne dass das QM zufi nanziert, schamhaft verschwiegen.<br />
Die Geschichte des QM ist zum Teil recht seltsam verlaufen,<br />
die ersten QM wurden implementiert, da wurden wir<br />
nicht mal gefragt, plötzlich waren sie da. Als Träger des<br />
QM wurde eine alte Sanierungsbetreuungsgesellschaft<br />
genommen, die dort schon die Bewohner domestiziert hat,<br />
das waren die Vorerfahrungen. Die Aufgabe dieser Sanierungsberatung<br />
war es gewesen, die Sanierung zügig und<br />
möglichst störungsfrei durchzuziehen. Wir waren damals<br />
daran beteiligt, und unser Anliegen war es, zunächst mit<br />
den Bewohnern ins Gespräch zu kommen. Mit dem Auftreten<br />
des QM war uns diese Aufgabe entzogen.<br />
Inzwischen ist das eine sehr pragmatische Zusammenarbeit,<br />
meistens läuft es auch gut. Wenn das QM kommt<br />
und fragt, ob wir dieses oder jenes kleine Projekt noch<br />
übernehmen können, dann sage ich erst mal: oh, Gott.<br />
Weil der Verwaltungsaufwand dieser Projekte einfach irrsinnig<br />
ist. Das bedeutet Nächte am Computer, nachher<br />
eine Rechnungsprüfung, die schon von mehr als Irrsinn<br />
geprägt ist, schlimmste Vorverfahren. Man muss nicht nur<br />
die Anträge durch diesen Quartiersrat kriegen, es ist noch<br />
viel schlimmer, bis man dann die Bewilligung hat. Dann<br />
jubelt man, wenn man das alles geschafft hat.<br />
Aber durch dieses Verfahren zu kommen, bindet unheimlich<br />
viele Ressourcen und Energie, die wir eigentlich <strong>für</strong><br />
andere Dinge brauchen. Der zweite Wahnsinn ist, dass<br />
die Projekte eine sehr begrenzte Laufzeit haben. Wir dürfen<br />
maximal zwei Anschlussanträge stellen. Wenn es aber<br />
notwendig ist, dass eine Struktur erhalten bleibt, müssen<br />
wir das Projekt im Antrag variieren, um etwas Ähnliches<br />
weiterzumachen. Das ist der reinste Blödsinn. Wir wissen<br />
alle, dass gerade mit ausgegrenzten Menschen die<br />
<strong>Arbeit</strong> langwierig ist, das geht nicht an einem Tag, wir<br />
reden auch nicht von ein oder zwei Jahren, sondern von<br />
einem Jahrzehnt, um was zu bewirken. Und dann so eine<br />
Bewilligungsstruktur!<br />
Die ehrenamtliche Energie von Bürgern wird auch durch<br />
diese Gremien sehr stark in Anspruch genommen. Diese<br />
Gremien nehmen alle Leute in Anspruch, die die Fähigkeit<br />
haben, sich dort bewegen zu können. Andere haben da<br />
keinen Zugang. Die Gremien funktionieren in einer Art,<br />
dass Leute, die das Mitmachen nicht irgendwo gelernt<br />
haben, sofort frustriert wieder aussteigen. Es gibt vom<br />
QM aus nichts, was die Leute befähigt, sich in diesen<br />
Gremien einzubringen, auch keine Struktur, dass man<br />
Sitzungen anders gestaltet, damit Leute da eher mitmachen<br />
können. Es sitzen alle um einen Tisch und reden, es<br />
gibt einen Vorsitz und ein Protokoll. Aber so funktionieren<br />
diese Leute nicht unbedingt. Ich würde mir bei dem QM<br />
eine große Öffnung wünschen.<br />
Wenn bei uns irgendwelche Themen besprochen werden,<br />
sorgen wir da<strong>für</strong>, dass alle die Chance haben sich einzu-
ingen, auch wenn sie nicht so geübt sind, in großem<br />
Kreis was zu sagen. Sich zur Tagesordnung zu melden<br />
und zu erzählen, dass ihr Bad kaputt ist, das ist verpönt in<br />
QM-Runden, aber das sind oft die Dinge, die den Leuten<br />
am Herzen liegen, mit denen kommen sie zuerst rüber.<br />
Unsere Aufgabe ist es, weiterhin zu gucken, dass Leute,<br />
die wenig Teilhabechancen in dieser Gesellschaft haben,<br />
da Möglichkeiten kriegen. Die kommen nicht unbedingt<br />
von selbst und rennen einem die Bude ein mit der Idee<br />
teilzuhaben, sondern das ist ein Prozess, der läuft auch<br />
über Sozialarbeitsangebote und in jeder Einrichtung<br />
anders. Deshalb kann man keine Rezepte <strong>für</strong> ein erfolgversprechendes<br />
Vorgehen geben, sondern man muss<br />
sehr, sehr vielfältig agieren. Wir brauchen immer wieder<br />
neue Ideen <strong>für</strong> neue Zugänge, weil alte nicht mehr funktionieren.<br />
Die Zettel funktionieren nicht mehr. Wir arbeiten<br />
stark mit Communities, die gar nicht lesen. Auch die Deutschen,<br />
die wir erreichen, lesen nicht besonders viel, aber<br />
wir können uns ja schlecht zwischen die Fernsehreklame<br />
klemmen.<br />
TN: Ich fi nde die Debatte darum, dass Gebiete falsch<br />
geschnitten sind, schlichtweg überfl üssig. In Berlin sind<br />
eine Million Mal die Gebiete falsch geschnitten worden<br />
und es ist einfach müßig, darüber zu diskutieren. Wenn<br />
man Mittel, Ressourcen, Personal irgendwie steuern<br />
will, muss man Gebiete schneiden. Wenn man Gebiete<br />
schneidet, wird man sie immer falsch schneiden, weil<br />
das nie der Realität von Menschen entsprechen kann.<br />
Man muss darüber reden, wie man diese Grenzen überwindet.<br />
Ich will noch mal was zu vertanen Chancen sagen. Was<br />
jetzt gesagt wurde, dass wir die Menschen als mündige<br />
Bürger annehmen und ernst nehmen, das steckt<br />
ja hinter der Sozialraumorientierung. Es geht nämlich<br />
in der Sozialraumorientierung um das Interesse und<br />
den Willen des Klienten, um seine Ziele. Damit tut sich<br />
die Sozialarbeit extrem schwer, weil sie nie gelernt hat,<br />
vom Bürger auszugehen. Da hätten wir noch unheimlich<br />
Potenzial. In der ganzen Stadt werden Mittel <strong>für</strong> diese<br />
aktivierende <strong>Arbeit</strong> vergeben, ressourcenorientierte<br />
<strong>Arbeit</strong> aufzubauen, zu entwickeln und zu unterstützen.<br />
Wir vertun gerade wieder eine Chance, weil ich nicht<br />
sehe, dass die Nachbarschaftseinrichtungen mit ihrem<br />
Potenzial diese Mittel in Anspruch nehmen.<br />
TN: Doch.<br />
Georg Zinner: Ich glaube, das ist alles in der praktischen<br />
<strong>Arbeit</strong> viel einfacher, als wir das hier theoretisieren. Ich<br />
habe noch ein Beispiel, weil ich glaube, dass wir als Nachbarschaftsheime<br />
vielen anderen Fach-Trägern gegenüber<br />
etwas voraus haben, nämlich unseren Blick auf den<br />
Stadtteil. Was wir auch voraushaben, das ist unsere Ressourcen-Orientierung,<br />
also dass wir Potenziale nicht bei<br />
den Bürgern wecken müssen, sondern die sind da, diese<br />
Potenziale sind bei jedem Bürger da. Das ist meine feste<br />
Behauptung und auch meine Erfahrung.<br />
Worauf es ankommt und was wir als Nachbarschaftsheim<br />
so gut können, das ist, diese Potenziale aufzunehmen, die<br />
Bürger einzuladen, unsere Infrastruktur in Anspruch zu<br />
nehmen. Die Infrastruktur, das sind Personal, die Räume,<br />
unser Wissen, unser Können, was wir im Kopf haben, was<br />
wir an Erfahrungswerten haben, unsere Art des Umgangs<br />
mit Menschen, dass wir vernetzen können. Dass wir aufgrund<br />
unseres Fachwissens auch eigene Vorstellungen<br />
und Ideen haben, und die vielen Fachleute, die in unseren<br />
Einrichtungen arbeiten. Das sind die Ressourcen, die wir<br />
zur Verfügung stellen.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 99
Input:<br />
Workshop<br />
Organisations-Erfahrungen<br />
Schnelles Wachstum begegnet langsamem Wachstum<br />
Miriam Ehbets Rabenhaus (Köpenick)<br />
Thomas Mampel Stadtteilzentrum Steglitz<br />
Franz Erpenbeck ehm. <strong>Verband</strong> Bremer Bürgerhäuser,<br />
Dreye<br />
Moderation: Elke Schönrock<br />
Elke Schönrock: Beim Wachstum geht es uns nicht so<br />
sehr um die Größe, sondern eher um die Fragen, wie<br />
Organisationen entstanden sind, welche Motivationen<br />
gab es, sich zu verändern oder Dinge zu erhalten, welche<br />
Probleme gibt es damit, dass man wächst oder<br />
nicht wächst. Die Inputs kommen von Miriam Ehbets,<br />
Geschäftsführerin vom Rabenhaus, Nachbarschaftshaus<br />
in Berlin-Köpenick, dann Thomas Mampel, Geschäftsführer<br />
vom Stadtteilzentrum Berlin-Steglitz, sowie Franz<br />
Erpenbeck, ehemaliger Bildungsreferent des <strong>Verband</strong>es<br />
Bremer Bürgerhäuser und ehemaliger Vorstand vom Bürgerhaus<br />
Oslebshausen, sowie kollegialer Berater <strong>für</strong> ein<br />
Stadtteilzentrum in Berlin-Weißensee.<br />
Miriam Ehbets: In unserem Haus und in einer unserer<br />
Broschüren gibt es einen Spruch, der übrigens auch<br />
in der NASA hängt, der nicht unbedingt als Motto gilt,<br />
aber <strong>für</strong> unsere Einrichtung und unseren Verein charakterisierend<br />
ist: „Nach eingehenden mathematischen<br />
Berechnungen und physikalischen Experimenten hat<br />
man herausgefunden, dass Hummeln nicht fl iegen können.<br />
Die Hummel weiß das nicht – und fl iegt doch“.<br />
Das Rabenhaus ist mit der Wende entstanden. Es gab<br />
kunstinteressierte Menschen im Stadtbezirk Treptow-<br />
Köpenick bzw. Köpenick, die schon im Kulturbund organisiert<br />
waren. Der Kulturbund war eine DDR-Organisation,<br />
in der sich Menschen zusammenfi nden konnten, die im<br />
weitesten Sinne an Kunst interessiert waren, das ging von<br />
Philatelisten über Musiker, Maler, Galerien, die im Kulturbund<br />
organisiert waren. Die Leute haben sich während<br />
der Wende zusammengefunden und sagten sich, dass sie<br />
jetzt endlich das machen können, was sie schon immer<br />
machen wollten. Sie konnten frei entscheiden, wie sie das<br />
umsetzen wollten und waren nicht mehr durch die DDR<br />
gedeckelt. Kindertheater wurde organisiert, Kellerjazz,<br />
Maler und Künstler haben eine Galerie in Eigeninitiative<br />
eröffnet. 1991 hat man einen Verein gegründet, der auch<br />
ABM-Stellen hatte, also man versuchte, diese Möglichkeiten,<br />
die sich da geboten haben, zu nutzen.<br />
Dann kamen vom <strong>Verband</strong> Herbert Scherer und Frank<br />
Börner, die guckten, welche Initiativen es im Ostteil Berlins<br />
gibt, wo könnte man Nachbarschaftshäuser initiieren<br />
oder wo könnte sich da etwas entwickeln. Unser Verein<br />
saß damals in einer kleinen Villa, <strong>für</strong> die wir nur mit<br />
Bauchgrummeln den Zuschlag bekamen, weil ein Rückübertragungsanspruch<br />
an die Treuhand gestellt worden<br />
war. Das Schicksal hat uns ereilt, nach zwei Jahren waren<br />
wir das Haus los. Es ist eines der vielen Wunder, dass es<br />
das Rabenhaus immer noch gibt. Wir haben keine Villa<br />
mehr und sitzen jetzt in Räumen, <strong>für</strong> die wir Miete bezahlen<br />
müssen, sind auch schon zweimal umgezogen, aber<br />
wir sind trotzdem immer noch da.<br />
Von der Ausrichtung her sind wir <strong>sozial</strong>-kulturell. Wir haben<br />
mit ganz vielen <strong>kulturelle</strong>n Angeboten angefangen, sind<br />
aber in unserer Geschichte mehr in den <strong>sozial</strong>en Bereich<br />
gewechselt. Angefangen haben wir wirklich mit Kulturarbeit.<br />
Aber durch die Nachbarschaftshausarbeit und die<br />
Schulungen, die wir hatten, und durch den wachsenden<br />
<strong>sozial</strong>en Bedarf vor Ort bekamen wir eine immer mehr<br />
<strong>sozial</strong>e Ausrichtung. Wir haben jetzt ganz viele Beratungsangebote<br />
und gehen inzwischen mehr in die Gemeinwesenarbeit.
Wir haben den Geldmangel immer als Chance empfunden<br />
und versuchten, daraus kreativ etwas zu machen. Wir<br />
wollten nicht zu den Jammer-Ossis gehören, die jammern,<br />
weil sie nicht genug Geld haben, um irgendetwas zu tun,<br />
sondern wir haben uns gesagt: wir haben wenig Geld,<br />
aber holen damit das Optimum raus und schauen, was<br />
wir damit machen und bewirken können.<br />
Momentan versuchen wir, aus dem Mangel, dass wir kein<br />
großes Haus sind und selber nicht unendlich viele Angebote<br />
machen können, wie die Spinne im Netz zu hocken:<br />
wir wissen um alle Angebote, wir sind unheimlich gut vernetzt<br />
in unserer Region und in unserem Bezirk. Wir wissen<br />
um die Angebote der anderen Anbieter, wenn Leute<br />
zu uns kommen, die ein Problem haben, dann kann ich<br />
kompetent beraten und an eine entsprechende Stelle vermitteln.<br />
Wir sind Anschieber und Mitorganisator <strong>für</strong> eine<br />
Vernetzungsstruktur in unserem Bezirk, sind Teil eines<br />
Runden Tisches <strong>für</strong> Soziales, Kultur und Jugend. Zweimal<br />
im Jahr organisieren wir große Treffen, wo man ressortübergreifend<br />
Informationen austauscht und versucht, an<br />
einem Strukturaufbau teilzuhaben.<br />
TN: Habt ihr euch in einer Nische eingerichtet oder wollt<br />
ihr vom Verein aus wachsen?<br />
Miriam Ehbets: Wir haben uns immer als ein pulsierendes<br />
System verstanden. Wenn die Gegebenheiten<br />
von außen es uns ermöglichen, dann vergrößern wir uns<br />
auch. Wir haben immer unterschiedliche Projekte gehabt.<br />
Wir haben auch ein Projekt an anderen Örtlichkeiten<br />
gehabt, aber wenn sich das nicht mehr halten ließ, dann<br />
haben wir das eben aufgegeben und gesagt, dass wir was<br />
Neues probieren. Wenn das nicht mehr geht, dann eben<br />
was anderes. Das ist auch immer eine Entscheidung, die<br />
man <strong>für</strong> sich selber trifft, dass Wandel möglich sein soll<br />
und dass das keine Katastrophe ist, sondern eine Chance<br />
und Möglichkeit.<br />
Momentan haben wir neben der Kerneinrichtung neu<br />
dieses Vernetzungsprojekt, dann haben wir noch einen<br />
Schülerclub und ein Jugendprojekt, was aber aufsuchende<br />
<strong>Arbeit</strong> bedeutet und momentan eine personelle<br />
Belastung <strong>für</strong>s Haus ist.<br />
Es gab eine Zeit, in der verschiedenen Stadtteileinrichtungen<br />
die Trägerschaft <strong>für</strong> Kindertagesstätten angeboten<br />
wurde. Da war die Entscheidung der Vereinsmitglieder,<br />
dass sie diese enorme Verantwortung <strong>für</strong> so einen<br />
Bereich nicht wollten, das war den Vereinsmitgliedern zu<br />
groß. Wir haben da<strong>für</strong> nicht den fi nanziellen Rückhalt,<br />
man wollte sich nicht verschulden. Denn im Ostteil waren<br />
Kitas teilweise sehr marode, man hätte kräftig investieren<br />
und große Kredite aufnehmen müssen. Da haben wir<br />
auch gesagt, wenn die Mitglieder das nicht wollen, dann<br />
drücken wir es ihnen auch nicht auf, denn von der Struktur<br />
her sind das ja unsere <strong>Arbeit</strong>geber. Ich kann sie nicht<br />
vergewaltigen und zu etwas zwingen, wo sie nicht dahinter<br />
stehen. Bei dem, was wir jetzt machen, da stehen alle<br />
Vereinsmitglieder auch voll dahinter.<br />
Thomas Mampel: Bei diesem Tierbeispiel mit der Hummel<br />
fi el mir gleich der Tausendfüßler ein. Kennt Ihr die<br />
Geschichte? Der Tausendfüßler läuft durch den Wald,<br />
ist fröhlich und pfeift. Ein anderes Tier sieht ihn, staunt,<br />
und fragt: Ist ja irre, wie du hier durch den Wald gehst.<br />
Wie koordinierst du diese vielen Füße? Der Tausendfüßler<br />
stutzte – und konnte fortan nicht mehr laufen. Das<br />
beschreibt vielleicht ganz gut wie wir arbeiten, also wir,<br />
das Stadtteilzentrum Steglitz.<br />
Unser Verein wurde 1995 gegründet, wir haben im November<br />
1995 einen kleinen Treffpunkt eröffnet. Damals hieß<br />
unser Verein noch Nachbarschaftsverein Lankwitz. Das<br />
ist ein Teil von Steglitz, in dem wir wohnten. Zusammen<br />
mit meiner Frau und Freunden in der Diakoniestation<br />
haben wir überlegt, was werden soll, wenn wir mit dem<br />
Studium fertig sind. Wir wollten ein bisschen was an<br />
unserem Wohnumfeld verändern, aber natürlich immer<br />
mit der Perspektive und der Absicht, <strong>für</strong> uns selbst eine<br />
<strong>Arbeit</strong> zu schaffen, von der man vielleicht irgendwann<br />
leben könnte. Wir gründeten diesen Verein, anfangs war<br />
das ein kleiner Laden in einer Einkaufspassage. Wir<br />
waren vollkommen überwältigt, wie toll das funktioniert<br />
hat. Es gab eine ganz große Bereitschaft von Leuten,<br />
sich ehrenamtlich zu engagieren. Ich selber habe den<br />
Job die ersten drei Jahre auch ehrenamtlich gemacht.<br />
Wir hatten unglaublich viel Spaß, grandios, wie toll uns<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 101
102<br />
Workshop Organisations-Erfahrungen<br />
alle fanden, gerade aus der Anfangsphase haben wir<br />
unglaublich viel an Bestätigung und Zuneigung gezogen.<br />
Wir hatten ja die Perspektive im Hinterkopf, irgendwann<br />
einmal damit unser Geld zu verdienen, was zwangsläufi<br />
g voraussetzt, dass man bereit ist zu wachsen. West-<br />
Berlin 1995, die Lasten der Wiedervereinigung drückten<br />
uns schon morgens beim Aufstehen kräftig, also da war<br />
nicht mehr viel mit neuen Projekten, die sich entwickeln,<br />
in West-Berlin wurde eher abgewickelt und auch erfahrene<br />
Träger kamen in schwierige Situationen. Und in der<br />
Situation kamen wir an und meinten, wir müssten jetzt ein<br />
bisschen Stadtteilarbeit machen.<br />
TN: Ich kann bestätigen, ich dachte damals, dass ihr<br />
einen Knall habt. Ich sage es ganz ehrlich.<br />
Thomas Mampel: Wir hatten die Bereitschaft zu wachsen<br />
und zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, und<br />
uns war klar, dass wir nur existieren und leben können,<br />
wenn wir dazu bereit sind und irgendwelche Aufgaben<br />
übernehmen. Dann war es eine Mischung aus glücklicher<br />
Fügung und Zufällen, dass man uns immer mal wieder<br />
neue Projekte angeboten hat, die wir übernehmen<br />
konnten. Im Laufe der Zeit sind wir nicht nur zu Aufgaben<br />
und zu Einrichtungen gekommen, sondern sogar zu einer<br />
Finanzierung.<br />
Mittlerweile – 2009 – haben wir ungefähr 80 fest angestellte<br />
Mitarbeiter, wir betreiben Kindertagesstätten,<br />
Schulhorte, eine Jugendfreizeiteinrichtung, einen Nachbarschaftstreff,<br />
eine Senioreneinrichtung, ein Existenzgründungsprojekt.<br />
Wir machen ganz viele verschiedene<br />
Sachen, nicht mehr nur in Lankwitz. Im Jahr 2000 haben<br />
wir unseren Verein umbenannt in Stadtteilzentrum Steglitz.<br />
Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass wir mit dieser<br />
Namensänderung ein großes Stück unserer Identität<br />
aufgegeben haben.<br />
Wir hatten plötzlich eine Jugendeinrichtung, eine Kita.<br />
Und damit hatten wir einen Haufen neue Probleme. Wir<br />
haben ständig Sachen gemacht, von denen wir eigentlich<br />
nicht wussten, wie man sie machen muss. Irgendwie<br />
dachten wir, wir werden das schon hinkriegen, es gab<br />
auch sehr viel Unterstützung aus dem <strong>Verband</strong>. Gisela<br />
Hübner hat mir erklärt, wie eine Kita fi nanziert wird, damit<br />
ich weiß, was ich da tue. Wir haben das eine ganze Weile<br />
gemacht, immer munter drauf los. Als Unternehmen, als<br />
Verein, oder Organisation sind wir immer ein bisschen<br />
der Realität hinterher gehechelt. Wir hatten eine Aufgabe,<br />
haben festgestellt, dass das alles ein bisschen anders ist,<br />
als wir uns das vorgestellt hatten, und versuchten dann,<br />
unsere eigenen Fähigkeiten, unsere Kompetenzen und<br />
vor allem unsere eigenen Strukturen irgendwie daran<br />
anzupassen.<br />
Das hatte zur Folge, dass wir unglaubliche Fehler gemacht<br />
haben. Ich glaube, wir sind der Verein in Berlin, der am<br />
meisten Fördergelder zurückgezahlt hat, weil wir Fehler<br />
gemacht haben. Wir mussten Spendenaktionen machen<br />
oder Leute um Geld angehen, weil wir die Fehler teuer<br />
bezahlen mussten, auch um nicht wieder in neue existenzielle<br />
Probleme zu kommen. Die Aufgaben und die Verantwortung,<br />
die mit bestimmten Wachstumsphasen verbunden<br />
sind, haben wir nicht richtig eingeschätzt. Aber wir<br />
haben auch gelernt, dass diese Fehler uns in der Regel<br />
nicht umbringen, sondern wir irgendwas draus lernen,<br />
was wir <strong>für</strong> die nächste Aufgabe oder Herausforderung<br />
nutzen können.<br />
Ein zweites Problem: unsere Struktur hat sich massiv<br />
verändert. Am Anfang basierte das auf den Mitgliedern,<br />
wir hatten zu unserer besten Zeit 175 Mitglieder, jetzt<br />
haben wir 30 und wir können zufrieden sein, wenn wir<br />
eine beschlussfähige Mitgliederversammlung hinkriegen.<br />
Das hat sich komplett verändert. Ich vermute, dass das in<br />
vielen anderen Einrichtungen auch so ist, aber das wird<br />
nicht gerne offen besprochen.<br />
Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir überlegen, wie wir<br />
das anders gestalten können. Zu den alten Strukturen<br />
können wir nicht zurück. Wir sind in sehr vielen Prozessen<br />
in der Verantwortung, wollen die auch sehr gerne tragen<br />
und wollen auch weiter wachsen. Trotzdem suchen wir<br />
nach anderen Modellen, wie wir NutzerInnen oder Partner<br />
im Umfeld einladen können, an der Entwicklung dieser<br />
Organisation mitzuwirken. Das wurde auch gestern<br />
in einem Workshop schon besprochen unter dem Stichwort<br />
Open Source-Organisation. Wo können wir unsere<br />
Schnittstellen öffnen? An welcher Stelle können wir Leute
einladen, an der Entwicklung von Projekten mitzuwirken,<br />
ohne dass sie sich auf diese klassische Vereinsmeierei<br />
einlassen müssen? Das wollen die Leute nicht, aber sie<br />
wollen an bestimmten Projekten mitarbeiten. Da müssen<br />
wir gucken, dass sich unsere Strukturen in Richtung<br />
Stadtteilzentrum Steglitz 2.0 entwickeln.<br />
Wir haben gelernt, dass Wachstum nur dann in Ordnung<br />
und was Schönes ist, wenn es sich organisch entwickelt.<br />
Damit meine ich, dass in einem halbwegs vernünftigen<br />
Tempo <strong>Arbeit</strong>sbereiche und Projekte dazukommen, die<br />
zu der Vision oder Philosophie der Organisation passen,<br />
zu ihren Ursprüngen. Bei uns klingen diese 14 Jahre so<br />
rasant, aber eigentlich war es im Durchschnitt immer<br />
ein neues Projekt oder eine neue Einrichtung pro Jahr.<br />
Demnach haben wir jetzt 14 Einrichtungen. Das ist relativ<br />
gesund, das kann man schaffen. Ungesund sind große<br />
Beschäftigungsträger, die aus dem Nichts gegründet sind<br />
und plötzlich Maßnahmen mit ein paar hundert Teilnehmern<br />
machen, wo aber keine Substanz vorhanden ist.<br />
Man muss gucken, warum und in welchen Bereichen<br />
man wachsen will. Wachstum an sich ist nicht viel wert,<br />
da kann man auch viel kaputt machen, auch intern. Also<br />
muss man schauen, wie man diese Prozesse gestalten<br />
kann.<br />
TN: Wenn du von wir sprichst, das ist praktisch der Verein?<br />
Thomas Mampel: Ja, wir sind nach wie vor ein e.V.. Für<br />
ein Projekt haben wir jetzt im Sommer eine GmbH gegründet.<br />
Das hat satzungstechnische Gründe und hat mit der<br />
Gemeinnützigkeit zu tun, aber wir sind nach wie vor ein<br />
Verein und werden das auch bleiben.<br />
Miriam Ehbets: Schon in der Gründungsphase und in<br />
der Zielrichtung gibt es große Unterschiede zwischen Ost<br />
und West. Unsere Mitarbeiter, die wir damals hatten, sind<br />
mit einer ganz anderen Ausbildung an die <strong>Arbeit</strong> gegangen.<br />
Das waren keine Sozialarbeiter, es gab überhaupt<br />
keine Sozialarbeiter, die in dem Verein als Hauptamtliche<br />
gearbeitet haben, sondern sie kamen alle aus anderen<br />
Ursprungsberufen. Wir haben wirklich von dieser Vorstellung<br />
gelebt, dass es Fördertöpfe gibt. Wir sind ja in eine<br />
völlig neue Struktur gekommen und wussten überhaupt<br />
nicht, wie das Ganze funktioniert. Man hat aber angenommen,<br />
dass das einfach dazugehört, dass <strong>für</strong> den<br />
Bereich Nachbarschaftsarbeit Fördertöpfe da sind. Und<br />
die waren am Anfang – im Verhältnis zu heute – üppig.<br />
Man kam gar nicht darauf, dass man expandieren muss,<br />
um sich selbst dadurch erhalten zu können. Das hatten<br />
wir noch nicht drin, sondern das haben wir während<br />
des Prozesses erst gelernt, dass das mit dazugehören<br />
könnte.<br />
Franz Erpenbeck: Ich habe in den 70er Jahren in Berlin<br />
studiert. Mit meiner Familie wohnte ich im Märkischen<br />
Viertel. Das heißt also, diese ganzen Geschichten, die es<br />
damals an Einrichtungen <strong>für</strong> Kultur oder Soziales nicht<br />
gab, hat der Forum-Verein, das war ein Nachbarschaftshaus.<br />
damals organisiert, Kinderläden, alles auf Ebene<br />
von „das können wir alles“. Vor allen Dingen waren sie<br />
alle auf dem Wohngemeinschafts-Trip, uns haben sie<br />
erst mal gesagt, wir müssten uns trennen, dann könnten<br />
wir auch mitmachen. In der Hochschule bin ich die halbe<br />
Zeit gewesen, die andere Zeit habe ich Gemeinwesenarbeit<br />
im Märkischen Viertel praktiziert. Das hat mich ganz<br />
wesentlich geprägt. Daher kenne ich auch ganz viele Einrichtungen<br />
aus der Zeit.<br />
Dann habe ich mich in Bremen beworben, das war 1975.<br />
Relativ schnell habe ich meinen gewünschten <strong>Arbeit</strong>splatz<br />
bekommen, nämlich mit zwei anderen Kollegen habe ich<br />
12 Jahre lang Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Erzieher<br />
im staatlichen Praktikantenamt begleitet. Die waren verpfl<br />
ichtet, unsere Angebote wahrzunehmen. Alles verlief<br />
nach festgelegten Regeln.<br />
Bremen war in den 70er Jahren wahrscheinlich die Stadt,<br />
die am meisten Geld <strong>für</strong> Kultur, Gesundheit, Soziales ausgegeben<br />
hat. Damals hat es etwa 70 Millionen DM <strong>für</strong> die<br />
etwa 700 Einrichtungen in Bremen gegeben. Die Millionen<br />
waren innerhalb kurzer Zeit weg, das war nämlich die Zeit<br />
der ABM-Stellen. Nur um zu sagen, dass damals Wohlstand<br />
gewesen ist. Durch die <strong>Arbeit</strong> im Praktikantenamt<br />
habe ich natürlich auch alle Einrichtungen in Bremen kennen<br />
gelernt, das heißt, ich weiß, wie viele Einrichtungen<br />
da miteinander konkurriert haben.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 103
104<br />
Workshop Organisations-Erfahrungen<br />
Diese Erfahrungen habe ich dann genutzt, um zu sagen,<br />
ich habe die Schnauze voll von dieser <strong>Arbeit</strong>, das kann<br />
man nicht ewig machen. Es ist ein langer Kampf gewesen,<br />
bis ich praktisch versetzt werden konnte zu einer<br />
Außenstelle der Behörde, nämlich in den <strong>Verband</strong> Bremer<br />
Bürgerhäuser. Da habe ich schnell gemerkt, dass<br />
das eigentlich das Gleiche wie in der Behörde war. Ich<br />
sollte praktisch als Referent <strong>für</strong> Grundsatzfragen und<br />
Öffentlichkeitsarbeit den Häusern, die dieser Geschäftsstelle<br />
zugeordnet waren, beibringen, wie sie am besten<br />
arbeiten und neue Sachen machen. Das ist natürlich<br />
ein Witz, weil man das als Außenstehender nicht kann.<br />
Das waren gestandene Leute, zum Teil mit Ausbildungen<br />
wie z.B. Schaufenstergestalter, die hatten Gehälter von<br />
Sozialarbeitern. Solche Zustände konnte ich nur als provisorisch<br />
ansehen. Ich meine, es müssen keine Professionellen<br />
sein, sondern es können auch Leute sein, die gut<br />
sind. Aber die zu fi nden, das ist nicht so einfach.<br />
In der Wendezeit habe ich ganz vielen Leuten, die über<br />
den <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> in dieser Hospitationsphase<br />
zu uns kamen, die Möglichkeit gegeben,<br />
dass sie sich das bei uns angucken konnten. Ich kannte<br />
Ralf Jonas als Praktikanten und habe ihn wiederentdeckt,<br />
als ich <strong>für</strong> die Bürgerhäuser arbeitete. Der hat 1988 eine<br />
Anstellung gekriegt und zwar haben die Entscheider in<br />
der Einrichtung nicht gewusst, dass er nicht in der Partei<br />
(= SPD) war. Es war normalerweise so, dass das sein<br />
musste. Er hatte einen Vater, der in der Partei war, deshalb<br />
hat man ihn übernommen. Das muss ich deswegen<br />
sagen, weil er von vornherein gesagt hat, ich mache nicht<br />
nur die Geschäftsführung, sondern ich mache Gruppenarbeit.<br />
So etwas gab es damals sonst nicht.<br />
Ralf Jonas begann in Oslebshausen zu arbeiten, einem<br />
Stadtteil, der zum Hafenbereich gehört. Er hatte mit<br />
Jugendlichen zu tun, die er eigentlich in Heimen unterbringen<br />
wollte, aber die Behörde akzeptierte die Einrichtungen<br />
nicht, die er ausgewählt hatte. Dann hat er<br />
angefangen, mit den Jugendlichen Jonglieren und solche<br />
Sachen zu machen. Das ist der Anfang der Zirkusarbeit<br />
dort im Haus. Und das ist heute das wichtigste Standbein<br />
dieses Hauses, obwohl junge und alte Menschen<br />
da sind.<br />
Wir haben das ganze Haus umgekrempelt nach der Devise:<br />
wer Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen<br />
und lernen will, der muss Selbstständigkeit erlangen. Das<br />
heißt, sie müssen etwas leisten können in dieser Einrichtung,<br />
die müssen etwas mitmachen. Wir haben den Vorstand<br />
auf drei Personen reduziert und damit angefangen,<br />
dass alle, die im Hause sind, regelmäßig an Sitzungen<br />
teilnehmen können, wenn sie das wollen, um über das<br />
was passiert mitzubestimmen. Und wir haben nach Möglichkeit<br />
innerhalb eines Jahres immer wieder Seminare<br />
außerhalb gemacht, damit die Mitwirkung praktisch<br />
ermöglicht wird. Das ist <strong>für</strong> mich das Prinzip, also Verantwortung<br />
vorzubereiten – und das ist gelungen.<br />
TN: Das Haus steht praktisch auf Selbstinitiative, das ist<br />
euer Prinzip?<br />
Franz Erpenbeck: Ja. Es gibt einen Verein, aber der ist ja<br />
nach dem Gesetz nur da<strong>für</strong> da, dass man vom Staat Geld<br />
kriegt. In der praktischen <strong>Arbeit</strong> spielt er keine Rolle.<br />
Elke Schönrock: Da kann es unterschiedliche Auffassungen<br />
geben. Du sagtest, dass im Rabenhaus die Vereinsmitglieder<br />
viel zu sagen haben. Im Stadtteilzentrum<br />
Steglitz wird mittlerweile nach anderen Formen der Organisation<br />
gesucht.<br />
TN: Du sagtest, im Rabenhaus kamen die Leute aus anderen<br />
Berufen. Welche Berufe waren das denn?<br />
Miriam Ehbets: Die Ursprungsmitglieder, die den Verein<br />
gegründet haben, kamen wirklich alle mehr oder weniger<br />
aus dem künstlerischen Bereich, Maler, Musiker, unsere<br />
Ex-Chefi n ist gelernte Druckerin und Setzerin. Ich bin richtig<br />
reingewachsen, denn ich habe erst Studentenjobs im<br />
Rabenhaus gemacht, mein erster Job war mit Kindern zu<br />
kochen. Ich habe Soziologie studiert, also ich bin völlig<br />
verkopft und überhaupt kein Praktiker. Ich bin nur reingerutscht,<br />
weil eine der Kolleginnen, die Erzieherin war, in<br />
Schwangerschaftsurlaub gegangen ist. Dann haben sie<br />
händeringend jemanden gesucht, der einspringen kann,<br />
so sind sie auf mich gekommen. Ich habe erst ein Viertel-
jahr mitgemacht, später habe ich noch mal <strong>für</strong> ein halbes<br />
Jahr Schwangerschaftsvertretung gemacht. Irgendwann<br />
haben die dann gesagt, na ja, obwohl du eigentlich völlig<br />
theoretisch drauf bist, kannst du dir nicht vorstellen, hier<br />
trotzdem mitzumachen? Dann bin ich reingewachsen,<br />
so wie das bei allen hauptamtlichen Mitarbeitern war.<br />
Weil sie irgendwann mal selber Nutznießer waren oder<br />
teilweise da gearbeitet haben und von dem Prinzip und<br />
von dem Flair des Hauses überzeugt waren, sodass sie<br />
gerne mitmachen wollten. Bei uns ist es klein, aber fein,<br />
also sehr kuschelig. Meine Maxime ist: die Leute sollen<br />
reinkommen und sich sofort wohl fühlen, sie sollen sich<br />
sofort zuhause fühlen – und das passiert auch.<br />
TN: Wie viele Leute seid ihr jetzt bei euch?<br />
Miriam Ehbets: Ich bin hauptamtliche Mitarbeiterin.<br />
Unser Haus funktioniert über ehrenamtliche Mitarbeiter,<br />
wir haben immer ein oder zwei Praktikanten, die aus dem<br />
<strong>sozial</strong>en Bereich kommen, wir haben die hauptamtliche<br />
Mitarbeiterin im Schülerclub und Honorarkräfte in dem<br />
Jugendprojekt.<br />
TN: Also zwei fest angestellte Mitarbeiterinnen.<br />
Miriam Ehbets: Ich mache die Logistik im Hintergrund,<br />
die anderen sind Ehrenamtliche. Ich denke, das ist der<br />
Unterschied zu einem Haus, das Jugendarbeit macht. In<br />
einem Haus, wo eher Senioren sind oder Angebote, die<br />
über Kurse laufen, oder Beratungen, die durch Drittanbieter<br />
passieren, ist so etwas möglich, dass das über<br />
Ehrenamt funktioniert. In dem Moment, wo ich wirklich<br />
Jugendarbeit mache, brauche ich da<strong>für</strong> natürlich auch<br />
fest angestellte Mitarbeiter.<br />
Franz Erpenbeck: Das ist nicht nur in der Jugendarbeit so.<br />
Wolfgang Leppin: Thomas sagte, ihr hattet zu Anfang<br />
170 Vereinsmitglieder, als das Ganze am Wachsen und<br />
Gedeihen war. Jetzt sind es 80 Mitarbeiter, aber nur<br />
noch 30 Vereinsmitglieder. Sind diese 30 Mitglieder das<br />
juristisch notwendige Konstrukt, was den regierenden<br />
Vorstand wählt, dann arbeitet der Vorstand, bis irgendwann<br />
wieder mal eine Mitgliederversammlung ist, in allen<br />
zentralen Aufgaben, auch was Neuentwicklungen der Einrichtung<br />
angeht? Oder ist da noch eine Möglichkeit drin,<br />
in die Mitgliedschaft irgendwelche Entscheidungsfragen<br />
einzubringen? Manchmal überlege ich, ob diese ganze<br />
Vereinsstruktur überhaupt noch angemessen ist <strong>für</strong><br />
Einrichtungen, die immer größer werden. Auch in einer<br />
Zeit, wo sehr schnelle Entscheidungen nötig sind, die<br />
eigentlich, von einem bestimmten Demokratieverständnis<br />
ausgehend, breit diskutiert werden sollten. Die aber<br />
oft gar nicht breit diskutiert werden können, weil die Zeit<br />
schlichtweg nicht da ist, um Entscheidungsprozesse voranzubringen.<br />
Die Themen werden auch immer komplexer,<br />
die beraten werden müssen, ist da eine Vereinsmitgliedschaft<br />
überhaupt noch ein sinnvolles Konstrukt? Oder<br />
sind es letztlich der Vorstand und die Geschäftsführung,<br />
die Entscheidungen treffen?<br />
Thomas Mampel: Im Laufe der Zeit haben wir die Erfahrung<br />
gemacht, dass mit diesen ganzen zusätzlichen<br />
Jobs und mit dieser zusätzlichen Verantwortung, mit<br />
diesen Anforderungen an das, was wir wissen müssen<br />
und bewerkstelligen müssen, dass es nicht kompatibel<br />
ist mit einer Vereinsstruktur. Aber das gilt nur <strong>für</strong> uns.<br />
In der Anfangsphase hatten wir 175 Mitglieder, bei den<br />
Mitgliederversammlungen waren dann 50 oder 60 Leute.<br />
Die Leute sind gekommen, weil sie ein klar defi nierbares<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 105
106<br />
Workshop Organisations-Erfahrungen<br />
Interesse daran hatten, was sich in ihrem Wohnumfeld<br />
verändern soll. Im Laufe der Jahre haben sich die Themen<br />
der Mitgliederversammlung vollkommen verändert. Es<br />
gibt einfach Leute, die kriegen einen ganz verschleierten<br />
Blick, wenn die dann im Jahresabschluss oder in einer<br />
Einnahmen-Ausgaben-Übersicht irgendwas von über 1<br />
Million sehen. Tatsache ist aber, dass viele Mitglieder mit<br />
all dem, was da besprochen wird, gar nichts mehr zu tun<br />
haben. Das ist nicht mehr deren Welt. Die kommen dann<br />
auch nicht mehr.<br />
Wir haben es auch im Laufe der Zeit nicht hingekriegt,<br />
diese Vereinsstruktur weiterzuentwickeln. Natürlich kommen<br />
Leute, die sich an bestimmten Projekten beteiligen<br />
wollen, aus unseren Häusern gibt es Sprecher, die regelmäßig<br />
zu Treffen kommen, aber die sind nicht mehr diese<br />
klassische Vereinsstruktur, die den Vorstand wählen, weil<br />
sie etwas mitbestimmen wollen.<br />
Unser Vorstand ist seit sieben oder acht Jahren kontinuierlich<br />
gleich besetzt. Unter nostalgischen Gesichtspunkten<br />
fi nde ich das blöd, da möchte ich eigentlich was<br />
anderes, da möchte ich eine lebendige Mitgliedschaft,<br />
die hoch engagierte Vorstandsmitglieder hervorbringt, die<br />
sehr engagiert und bürgerschaftlich interessiert das Vereinsleben<br />
vorantreiben. Auf der anderen Seite kriege ich<br />
als Geschäftsführer das gar nicht mit den ganzen Anforderungen<br />
in Einklang, die andere Leute an mich stellen.<br />
Ich möchte zum Beispiel, dass meine MitarbeiterInnen<br />
beteiligt sind. Ich möchte gerne, dass unsere Kunden<br />
zufrieden sind. Ich möchte, dass die ZuwendungsgeberInnen<br />
zufrieden sind. Da tritt in meiner Welt das normale<br />
Mitglied in den Hintergrund. Da haben wir den goldenen<br />
Weg noch nicht gefunden und ich habe ihn auch bei anderen<br />
Organisationen noch nicht gesehen.<br />
TN: Ich habe mein ganzes Berufsleben in Nachbarschaftseinrichtungen<br />
verbracht, das heißt, 14 Jahre war ich im<br />
Nachbarschaftsheim Mittelhof und kenne diese ganze<br />
Vereinsgeschichte. Wir hatten 80 Vereinsmitglieder, das<br />
ist ein Traditionsverein, der erste, der nach dem Krieg<br />
gegründet wurde. Jetzt haben wir seit etwa 10 oder 15<br />
Jahren, genau wie Thomas gesagt hat, einen gleich bleibenden<br />
Vorstand und die Mitgliedschaft wird gesteuert.<br />
Man kann da nicht einfach Mitglied werden, es gibt auch<br />
keine Aufrufe, werdet Mitglied, sondern wenn man merkt,<br />
dass die Zahl kritisch wird, dass man irgendwann vielleicht<br />
doch unter zehn sackt, dann schaut man, wer ist zuverlässig<br />
aus den Reihen der Besucher und der Freunde, derjenige<br />
wird dann berufen. Das beobachte ich bei mehreren<br />
Vereinen, wenn das Wachstum der Organisation eine<br />
bestimmte Größenordnung erreicht, <strong>für</strong> die der Verein<br />
nicht mehr in seiner bisherigen Funktion brauchbar ist.<br />
Man versucht, die Organisationsform beizubehalten, aber<br />
sie in einer bestimmten Form zu steuern. Ob das auf die<br />
Dauer dann der richtige Weg ist, das mag dahingestellt<br />
sein. Deshalb fand ich es auch ganz spannend gestern,<br />
als von dieser Öffnung gesprochen wurde, also andere<br />
Wege zu fi nden und das nicht auf diese Vereinskonstruktion<br />
zu reduzieren. Es geht ja darum, dass wir einen<br />
bestimmten Garanten haben müssen, der da<strong>für</strong> sorgt,<br />
dass dieser Verein eine vernünftige juristische Grundlage<br />
hat, um arbeiten zu können.<br />
Thema Wachstum: Am Anfang in den 70er Jahren gab es<br />
einen bestimmten Topf <strong>für</strong> die Nachbarschaftsheime, der<br />
war gleich bleibend, da haben die drum gekämpft. Wir<br />
wollten zunächst nicht, dass sich der <strong>Verband</strong> erweitert,<br />
denn jeder, der dazu kam, griff auf den gleichen Topf zu.<br />
Da war kein Wachstum, sondern wir freuten uns, dass<br />
es eine zugewandte Senatsverwaltung gab, jetzt waren<br />
wir fortschrittlich, machten unsere <strong>Arbeit</strong> und wollten<br />
in diesem Rahmen bleiben. Das hat sich dann Gott sei<br />
Dank geändert. Ich überlege manchmal, ob es nicht so<br />
etwas gibt wie ein Zeitfenster, das irgendwann wieder zu<br />
ist. Denn die ganze staatliche Organisation, die hinter<br />
unserer <strong>Arbeit</strong> steht, hat sich inzwischen grundlegend<br />
verändert. Aufgaben gehen weg vom Staat, das sind<br />
Kernaufgaben. Irgendwann wird dieser Prozess vielleicht<br />
abgeschlossen sein, aber im Moment ist er noch voll im<br />
Gang. Stadtteilzentren sind heute in der Phase der <strong>sozial</strong>politischen<br />
Umstrukturierung deshalb erfolgreich, weil<br />
sie schon immer <strong>sozial</strong>raumorientiert waren und generationsübergreifend<br />
waren, also ein Stück weit die Sparten<br />
verlassen haben.<br />
Das sind zwei Supervoraussetzungen, die dann auch,<br />
wenn man sich in die Richtung begeben hat, greifen. Das
sieht man u.a. am Nachbarschaftsheim Schöneberg,<br />
bei einer ganzen Reihe Einrichtungen, bei denen ganz<br />
deutlich ist, dass da ein enormes Wachstum stattfi ndet.<br />
Wenn man sich aber an dieser Entwicklung nicht beteiligen<br />
will, muss man sich darüber klar sein, dass dieser<br />
Zug abfährt.<br />
Gerade wenn man diese Aufgaben mit übernimmt, darf<br />
man sich nicht vom Kerngedanken entfernen, was Nachbarschaftsarbeit<br />
und stadtteilorientierte <strong>Arbeit</strong> heißt, sondern<br />
dass man dadurch überhaupt erst in die Lage versetzt<br />
wird, die Ressourcen zu haben, um auch Bereiche,<br />
die vielleicht nicht so gut fi nanziell ausgestattet sind,<br />
mit fi nanzieren zu können. Das sind auch meine Erfahrungen.<br />
In diesem Wachstum wird manchmal ein atemberaubendes<br />
Tempo vorgelegt, manchmal hat man das<br />
Gefühl, man verliert sich dabei. Es ist sicherlich gut, <strong>für</strong><br />
das Wachsen ein gewisses Maß zu fi nden und dennoch<br />
nicht auszusteigen und zu sagen: lass den Zug, sollen<br />
andere damit fahren.<br />
Franz Erpenbeck: Zu der Verkleinerung des Vorstandes:<br />
Da ist praktisch gleichzeitig eine Vereinbarung bzw. ein<br />
Vertrag mit dem Geschäftsführer gemacht worden, dass<br />
alle Dinge, die im Haus laufen, die pädagogischer oder<br />
<strong>kulturelle</strong>r Art sind, mit den Leuten, die das gerne möchten,<br />
gemeinsam entscheidet. So ist das festgelegt. Der<br />
Vorstand ist wirklich nur noch das Minimum, was das<br />
Finanzamt akzeptiert. Bei der Satzungsänderung haben<br />
wir feststellen müssen, dass uns vorgeschrieben wurde,<br />
wie unsere Aufgaben heißen – und das ist teilweise eine<br />
Lüge. Also <strong>für</strong> mich ist das einfach Unsinn. In Bremen<br />
ist die Auslagerung von Sozialprojekten aus dem öffentlichen<br />
Dienst inzwischen wieder rückläufi g, weil die Privatisierung<br />
teurer ist.<br />
TN: Ich wehre mich gegen den Begriff Privatisierung, weil<br />
der in einem abwertenden Sinne gebraucht wird, auch<br />
von den Gewerkschaften, …<br />
Markus Runge: Ich bin Mitarbeiter des Nachbarschaftshauses<br />
Urbanstraße in Kreuzberg. Wir sind ein mittlerer<br />
Träger, würde ich sagen, wir sind 55 Jahre alt und haben<br />
zurzeit etwa 100 Mitarbeiter. Wir haben in den letzten 20<br />
Jahren ein größeres Wachstum hingelegt, so um die 50<br />
Mitarbeiter sind in den letzten 10 Jahren vermutlich dazugekommen.<br />
Das hat einerseits mit den 90er Jahren zu tun<br />
und mit der Beobachtung, dass es viele kleine Träger gab,<br />
die sich selber nicht mehr halten konnten. Andererseits<br />
gab es in den letzten 15 Jahren auch konzeptionelle Neuentwicklungen<br />
innerhalb des Hauses, weshalb wir auch<br />
maßgeblich gewachsen sind.<br />
Wir sind gerade sehr besorgt um unseren Verein und die<br />
Mitglieder. Wir haben ungefähr 70 Mitglieder und merken,<br />
dass die Mitgliederzahl deutlich abnimmt bzw. die<br />
Mitglieder immer älter werden und wenig junge Mitglieder<br />
nachrücken. Viele Diskussionen gab es darum, wie wir<br />
uns neue, engagierte Mitglieder in den Verein holen.<br />
Zugleich diskutieren wir auch unter uns Mitarbeitern, wie<br />
viel Wachstum gesund ist. Ich beobachte ein extremes<br />
Wachstum einiger Nachbarschaftshäuser in Berlin, sehr<br />
stark fokussiert auf fi nanzielle Unabhängigkeit, fi nanzielle<br />
Selbstständigkeit und fi nanzielle Spielräume. Das<br />
ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, dennoch sehe ich<br />
eine Gefahr, regionale Bezüge zu verlieren.<br />
Das Nachbarschaftsheim Schöneberg ist das beste Beispiel,<br />
es ist –glaube ich-in mindestens fünf Bezirken aktiv.<br />
Ich frage mich, wie kann man als Nachbarschaftsheim<br />
Schöneberg eine schon in den Namen geschriebene regionale<br />
Identität noch in Tempelhof oder in Charlottenburg-<br />
Wilmersdorf transportieren.<br />
Wir sind da einen Mittelweg gefahren, als Nachbarschaftshaus<br />
Urbanstraße haben wir tatsächlich ausschließlich<br />
einen regionalen Bezug innerhalb des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg.<br />
Es ist <strong>für</strong> uns auch klar, dass wir nicht in<br />
Lichtenberg eine Kita übernehmen würden, wir würden<br />
uns da<strong>für</strong> auch gar nicht bewerben, weil wir sagen, dass<br />
es dem Bild eines Kreuzberger Nachbarschaftshauses<br />
nicht gut tut.<br />
TN: Was wird aus den Vereinen, die wirklich von den Mitgliedern<br />
getragen werden? Was Thomas geschildert hat,<br />
dass sich 170 Leute Gedanken darüber machen, wie sie<br />
ihr Umfeld verbessern können, ist eine rückläufi ge Sache.<br />
Andererseits ist klar, wenn ein Nachbarschaftshaus ein<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 107
108<br />
Workshop Organisations-Erfahrungen<br />
Träger ist, der einen <strong>sozial</strong>en Betrieb mit verschiedenen<br />
Sparten führen muss, dann kann das nicht von Vereinsmitgliedern<br />
gesteuert und auch nicht mal durchblickt werden.<br />
Ich denke, das sind Sphären, die früher oder später<br />
auseinander gehalten werden müssen. Hat jemand<br />
Erfahrung damit, Vereinsstruktur in eine andere Form zu<br />
überführen, Förderverein oder so, und die als Nachbarschaftshaus<br />
oder Stadtteilzentrum, also als Träger, mit<br />
zu pfl egen?<br />
Miriam Ehbets: Ich wollte auf den Gedanken zurückkommen,<br />
ob man selbst gewählt wächst oder ob man sich ausdrücklich<br />
dagegen entscheidet. Natürlich ist es auch so<br />
gewesen, dass man sich bestimmte Sachen nicht hat aussuchen<br />
können. So wie du gesagt hast, man hat manchmal<br />
Glück gehabt, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle<br />
gewesen zu sein. Wir hatten als Nachbarschaftshaus im<br />
Osten, in Treptow-Köpenick, große Schwierigkeiten, überhaupt<br />
die <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> Sichtweise, was ein Nachbarschaftshaus<br />
ist, bei den Anwohnern deutlich zu machen.<br />
Gerade der ressortübergreifende Ansatz hat ganz viel Verwirrung<br />
gestiftet und ganz viele Schwierigkeiten gebracht.<br />
Weil jedes Mal, wenn man sich irgendwo mit integrieren<br />
wollte und irgendwo mittun wollte, oder sich um Fördertöpfe<br />
bewerben wollte, immer gesagt wurde: wieso<br />
bewirbst du dich bei Kultur, ihr seid doch <strong>sozial</strong>. Wenn<br />
wir bei Soziales waren, hieß es, ihr seid doch aus einem<br />
Kulturverein gegründet worden und macht eher Kultur,<br />
wenn wir was mit Jugend machen wollten, sagten sie: nee,<br />
nee, geht mal zur Kultur und bewerbt euch bei denen. Wir<br />
wurden ständig hin- und hergeschoben, sodass wir immer<br />
Schwierigkeiten hatten. Dabei wollten wir bei allem Anteil<br />
haben, um das in den Stadtteil wieder zurückzugeben.<br />
Erst über ewig lange Beziehungsarbeit mit der Verwaltung<br />
hat man dort inzwischen verstanden, was wir wollen und<br />
erkennt das an. Auch indem man solche Fachtage organisiert<br />
wie zum Thema „Rahmenstrategie <strong>sozial</strong>e Stadtentwicklung“.<br />
Ganz langsam entsteht ein Verständnis<br />
<strong>für</strong> den ressortübergreifenden Ansatz unseres Nachbarschaftshauses.<br />
Also auch so was behindert einen in der<br />
Expansion.<br />
Monika Schaal: Pfefferwerk Stadtkultur. Wir sind mit<br />
unserer Nachbarschaftsarbeit bzw. mit unserem Nachbarschaftshaus<br />
einen ganz anderen Weg gegangen.<br />
Unsere Ursprungsgeschichte ist allerdings ähnlich wie bei<br />
euch: dass da auch eine Gruppe von Leuten war, die aus<br />
dem Kulturbereich kamen, die trafen sich 1991 in einem<br />
Wohnzimmer und wollten Nachbarschaftsarbeit bzw.<br />
Stadtteilarbeit machen. Dann gab es irgendwo ein Haus,<br />
dann wurde die Finanzierung verhandelt, ähnlich wie bei<br />
euch. Es gab bei uns Leute, die Jugendarbeit gemacht<br />
haben, andere Bereiche auch. Das Nachbarschaftshaus<br />
und der Verein waren nicht mehr das Zentrum, sondern<br />
das war ein Bereich und nach Fachkriterien wurden<br />
eigene Einrichtungen gegründet, Jugendhilfe, irgendwann<br />
kamen Kitas dazu.<br />
Wir sind in den Jahren seit 1991 auch sehr schnell<br />
gewachsen, wir haben inzwischen 400 Mitarbeiter. Dann<br />
haben wir Ausbildung angefangen. Wir sind jetzt ein<br />
Unternehmen, eine gGmbH, <strong>für</strong> die Stadtteilarbeit und<br />
Gemeinwesenarbeit aber nach wie vor zentral sind, auch<br />
in unserem Leitbild. Wir sind eine gemeinwesenorientierte<br />
Organisation, Kooperation statt Konkurrenz, ganz<br />
viele dieser wichtigsten Aussagen sind nach wie vor <strong>für</strong><br />
uns unverzichtbar, aber wir gehen das jetzt anders an. Ich<br />
bin zuständig <strong>für</strong> die Abteilung Stadtteilarbeit. Das Nachbarschaftshaus<br />
ist immer noch eine ganz zentrale und<br />
wichtige Einrichtung <strong>für</strong> alle, wo wir versuchen, über viele<br />
Kooperations-Ansätze den Gedanken von Unterstützung<br />
durch Stadtteilarbeit in alle unsere Projekte zu tragen: in<br />
alle unsere Kitas, in den Bereich der Ausbildung, in den<br />
Bereich der Jugendhilfe, und dort diesen Ansatz weiter<br />
zu entwickeln.<br />
Im Moment ist ein Beispiel das Nachbarschaftsprojekt,<br />
das in einer Jugendhilfeeinrichtung <strong>für</strong> Kinder in einem<br />
anderen Stadtteil untergebracht ist als in dem, in dem<br />
wir das Nachbarschaftshaus haben. Über die Freiwilligenagentur<br />
soll die <strong>Arbeit</strong> vor Ort im Stadtteil entwickelt<br />
werden, aus dieser Jugendeinrichtung heraus, mit Unterstützung<br />
durch das Nachbarschaftshaus.<br />
Soweit erst mal zum Hintergrund. Stadtteilorientierung<br />
ist nach wie vor eine unserer wichtigsten Grundlagen.<br />
Was mich aber interessiert: <strong>für</strong> uns ist in all diesen
unterschiedlichen fachlichen Entwicklungen, Gremien,<br />
Kooperationen, Verbindungen, der Zugriff auf aktuelle<br />
Informationen wichtig, um zu sehen was läuft und um<br />
schnell mit am Platz zu sein, wenn sich was ergibt. Das ist<br />
schon extrem schwierig <strong>für</strong> uns, wo es Leute gibt, die sich<br />
spezialisieren und in Kooperation arbeiten. Es gibt eine<br />
Abteilungsleitung <strong>für</strong> die Jugendhilfe und <strong>für</strong> die Stadtteilarbeit,<br />
<strong>für</strong> die Kitas.<br />
Wir merken, dass es gar nicht so einfach ist, in so vielen<br />
Bereichen präsent zu sein, die Entwicklungen zu verfolgen,<br />
gut zu reagieren, geschweige denn mitzugestalten,<br />
was dort passiert, die Rahmenbedingungen selber mitzugestalten.<br />
Mich würde interessieren, wie ihr das macht?<br />
Ausgehend von dem, was im Stadtteil passiert, was die<br />
Bedarfe sind, welche Ideen die Leute haben, die mitentwickeln,<br />
aber andererseits dann diese Einrichtungen zu<br />
haben, wo wieder ganz andere Anforderungen sind, die<br />
auch nach anderen Gesetzen funktionieren oder deren<br />
Erfolg nach anderen Gesetzen funktioniert, nicht unbedingt<br />
nur nach dem zu spüren, was vor Ort gewollt ist. Wie<br />
kriegt ihr das zusammen? Wir sind gerade in einem Organisationsentwicklungsprozess,<br />
der gar nicht einfach ist,<br />
weil wir auch immer der Geschichte verhaftet sind, was<br />
wir mal gemeinsam wollten, und zugleich auf die fachspezifi<br />
schen Managementanforderungen achten müssen.<br />
20 Jahre sind zwar eine lange Zeit, aber das war trotzdem<br />
ein schnelles Wachstum, wenn wir jetzt 400 Mitarbeiter<br />
haben. Wie kriegt man das auf die Reihe, wenn eine Eichrichtung<br />
nicht so naturwüchsig entstandenen ist wie ein<br />
Stadtteilzentrum, das seit 50 Jahren existiert?<br />
Renate Wilkening: Ich knüpfe mal am Pfefferwerk an.<br />
Anfang der 90er begann es mit dem Nachbarschaftshaus<br />
Pfefferwerk. Ich hatte damals engen Kontakt zu den Kolleginnen<br />
aus dem Ostteil der Stadt, die in der Christinenstraße<br />
in einer klitzekleinen Altbauwohnung mit Ofenheizung das<br />
Nachbarschaftshaus gegründet haben. Ihr erstes Anliegen<br />
war, auf dem Teutoburger Platz, der vor ihrem Haus lag und<br />
eine grässliche Brache war, mit den Anwohnern zusammen<br />
Nachbarschaftsarbeit zu machen und diesen Platz <strong>für</strong> alle<br />
schön zu machen, <strong>für</strong> Familien, <strong>für</strong> alte Leute, <strong>für</strong> alle Nachbarn,<br />
damit jeder etwas davon hat.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 109
110<br />
Workshop Organisations-Erfahrungen<br />
Das war ihre Ursprungsidee. Ich fi nde es sehr spannend,<br />
wie aus dieser Initiative und aus dieser Idee, <strong>für</strong> die<br />
Nachbarn und <strong>für</strong> sich selber etwas zu schaffen, nun fast<br />
schon ein <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>r Konzern im Stadtteil geworden<br />
ist, mit vielen Dependancen und Initiativen. Da muss<br />
man sehr achtsam sein, dass da bestimmte Dinge und<br />
Menschen nicht unter die Räder kommen. Und man muss<br />
sehen, welche Möglichkeiten man sich schafft. Du hast<br />
das Stichwort Organisationsentwicklung genannt: was<br />
schafft man, wer will das, wer bewegt das, hat das einen<br />
Selbstlauf? Organisiert sich das von selber? Da kommt<br />
eine Anfrage, dann wird das gemacht. Oder wie funktioniert<br />
das alles? Oder da winkt Geld und dann springen<br />
wir da drauf. Also diese Frage können wir wahrscheinlich<br />
heute gar nicht erschöpfend behandeln, sondern wir können<br />
nur ein paar Beispiele geben. Der Pfefferberg ist mir<br />
immer noch sehr nahe aus dieser Entwicklung heraus.<br />
Ich selber komme aus der ganz und gar basisdemokratischen<br />
Bewegung. Ich bin vom Nachbarschaftsheim der<br />
Ufa-Fabrik im Westen Berlins. Ich bin Geschäftsführerin<br />
dort, darüber hinaus bin ich im Internationalen <strong>Verband</strong><br />
der Settlement- und Nachbarschaftszentren und im <strong>Verband</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> Vorstandsmitglied..<br />
In der Ufa-Fabrik haben 1979 hundert Leute ein 18.000<br />
qm großes Gelände besetzt. Das heißt Ufa, weil es ein<br />
Gelände von den Universal-Filmstudios war, auf dem sie<br />
ihre Kopierwerke hatten. In den 70er Jahren und Anfang<br />
der 80er Jahre gab es in Berlin eine große Hausbesetzerbewegung,<br />
weil in dieser Stadt viele Spekulanten Häuser,<br />
die eigentlich noch gut bewohnbar waren, abreißen<br />
ließen. Es gab auch nicht genügend Wohnraum, insofern<br />
gab es die Besetzungen, um sich Häuser anzueignen. Die<br />
100 Leute aus der Ufa-Fabrik waren Studenten, Handwerker,<br />
Künstler, es waren Kinder mit dabei. Die hatten <strong>für</strong><br />
sich schon einen Verein <strong>für</strong> Kunst, Kultur und Handwerk<br />
gegründet, das Soziale spielte keine große Rolle, weil die<br />
sagten: <strong>sozial</strong> sind wir selber, wir leben in Gemeinschaft<br />
in <strong>sozial</strong>en Bezügen.<br />
Es gibt uns jetzt 30 Jahre lang, wir haben gerade das<br />
30jährige Jubiläum gefeiert. Die Prinzipien am Anfang<br />
waren: wir sind offen <strong>für</strong> alle, wir wollen miteinander<br />
leben, wohnen und arbeiten, jeder einzelne kann alles<br />
mitbestimmen. Das führte dazu, dass wir manchmal mit<br />
120 Leuten im Raum saßen und bestimmte Dinge nicht<br />
machen konnten, weil wir das Konsensprinzip hatten,<br />
dass jeder überzeugt „ja“ sagen musste. Die Zeit war<br />
spannend, aber auch furchtbar anstrengend und wir<br />
haben viele Federn gelassen.<br />
Wir sind von diesem Prinzip mehr und mehr dazu übergegangen,<br />
Mitbestimmungsgremien zu schaffen. Es musste<br />
nicht mehr jeder zu jeder Sache gehört und gefragt werden<br />
oder zustimmen. In den ersten acht Jahren ging das<br />
noch, weil alle einen irrsinnigen Enthusiasmus hatten. Es<br />
stand auch immer die Frage im Raum, ob wir geräumt<br />
werden oder nicht. Dann gab es Verhandlungen mit dem<br />
Senat, das Gelände konnte behalten werden, das war<br />
alles gemeinsames Gut. Aber dann gab es die Frage, okay,<br />
jetzt haben wir acht Jahre bewusst gesagt, dass wir keine<br />
Fördergelder nehmen. Wir wollten unabhängig bleiben,<br />
weil in dem Moment, in dem man Fördergelder annimmt,<br />
muss man darüber Rechenschaft ablegen und ist vom<br />
Geldgeber abhängig. Keiner gibt Geld, wenn er nicht<br />
bestimmte Interessen damit verfolgt, auch der Senat<br />
möchte bestimmte Interessen umgesetzt sehen. Das war<br />
<strong>für</strong> uns der Beweggrund, dass wir die ersten Jahre kein<br />
Geld genommen haben.<br />
Dann haben wir gesagt, okay, das ist eine schöne Haltung,<br />
aber wir benötigen auch Geld <strong>für</strong> die gute <strong>Arbeit</strong>,<br />
die wir machen. Mittlerweile ist die Ufa-Fabrik in 30<br />
Jahren gewachsen. Wir haben angefangen mit Leuten,<br />
die dort gelebt und gearbeitet haben. Zuerst war Kunst<br />
und Kultur ein ganz wichtiger Punkt, die Kunst von den<br />
Leuten selber, die gesagt haben, wir sind Artisten, auch<br />
wenn wir es nicht gelernt haben, sondern wir machen<br />
das über learning by doing. Sie haben Theateraufführungen<br />
zusammengestellt, der Ufa-Zirkus ging nach<br />
Hongkong und überall in die Welt, eine Band wurde<br />
gegründet, die es immer noch gibt. Die Ufa-Fabrik hat<br />
inzwischen eine Kinder-Zirkusschule, wo junge Artisten<br />
ausgebildet werden, was ein großer Schwerpunkt ist.<br />
Außerdem bespielen wir das ganze Jahr über vier Bühnen,<br />
da kann jeder Künstler oder jede Gruppe aus der<br />
ganzen Welt kommen, aber das möchten wir doch vom<br />
Kultursenat bezahlt bekommen, was auch geklappt
hat. Also eine Förderung geht über den Kultursenat,<br />
eine Förderung über den Stadtteilzentrumsvertrag.<br />
Unser Wachstum hat dazu geführt, dass wir teilen mussten.<br />
Wir können nicht sagen, dass es nur einen einzigen<br />
Verein gibt, der mit seinen 120 Mitgliedern bis ins letzte<br />
Detail mitbestimmt, sondern wir sagen, wir teilen nach<br />
Sparten, nach Kultur, nach <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n Dingen,<br />
nach Wirtschaftsbetrieben. Wir haben einen Laden, wir<br />
haben eine Bäckerei, die kann man gar nicht vereinsmäßig<br />
machen, weil uns das Kopf und Kragen kosten<br />
würde. Der Verein ist natürlich Hauptgesellschafter, aber<br />
das sind sozusagen die Details. Wir haben ein Restaurant,<br />
was im Einzelbesitz ist. Einer hatte den Mut <strong>für</strong> das<br />
Risiko, er hat einen sehr großen Kredit aufgenommen,<br />
damit war das Restaurant seins. Mittlerweile hat er dort<br />
30 <strong>Arbeit</strong>splätze geschaffen, fest Angestellte, was auch<br />
eine ganze Menge ist.<br />
Das Nachbarschaftszentrum ist der <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> Verein,<br />
in dem wir auch mit Mitgliedern und dem Vorstand<br />
arbeiten, den ich jedes Jahr anfl ehe, dass er wegen der<br />
Kontinuität bleibt. Mitglieder und Vorstände können in der<br />
Regel bei solchen Organisationen gar nicht mehr durchblicken,<br />
unsere Leute wussten nicht, was eine Bilanz ist<br />
oder dass man die machen muss. Die meinten, lasst uns<br />
einfach eine Ausgaben-/Einnahmenrechnung aufschreiben.<br />
Was ein ganz wichtiger Punkt ist: wenn man ein Verein<br />
bleibt, sollte der Vorstand nicht zu groß sein. Ich fi nde<br />
es gut, dass ihr reduziert habt. Ich plädiere <strong>für</strong> wenige<br />
Vorstände, aber diese Vorstände müssen fi t gemacht werden.<br />
Die haben eine hohe Verantwortung und sie haften<br />
auch an manchen Punkten persönlich. Das wissen manche<br />
Vorstände gar nicht, sondern sie denken, ja, macht<br />
das mal mit dem Millionen-Projekt, ist schon in Ordnung.<br />
Und: Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Vorstände<br />
sind nicht nur Aushängeschilder, sondern man<br />
muss ihnen das nötige Rüstzeug verschaffen, also dass<br />
sie zu Fort- und Weiterbildungen gehen, dass sie mit der<br />
Organisation wachsen können und sich in den Bereichen<br />
auskennen.<br />
Bei den Mitgliedern denke ich mittlerweile: wer Mitglied<br />
werden will, das ist schön, aber dieses totale Mitbestim-<br />
mungsmodell – nein. Ich sehe es wie Thomas, dass wir<br />
verpfl ichtet sind, unsere Kunden, das sind die NutzerInnen,<br />
die MitarbeiterInnen, die Zuwendungsgeber, die<br />
Vereinsmitglieder, zufrieden zu stellen. Bei uns sind die<br />
120 Mitglieder aufgeteilt in mehrere Vereine und GmbHs.<br />
Wir gehen pragmatisch davon aus, dass dort, wo sie ein<br />
echtes Interesse haben, etwas zu tun, da sind die Leute<br />
auch gut aufgehoben, nicht als Karteileiche.<br />
TN: Euer Prinzip war, dass ihr euch aufgeteilt habt?<br />
Renate Wilkening: Wir sind von dem großen Verein, der<br />
alles abgedeckt hat, auf zwölf unterschiedliche Rechtsformen<br />
gegangen. Markus hatte angesprochen, wann<br />
und warum Nachbarschaftszentren aus ihren Stadtteilen<br />
herausgehen.<br />
Ein kleines Beispiel da<strong>für</strong>: Wir haben im Nachbarschaftszentrum<br />
Ufa-Fabrik eine Schrei-Baby-Ambulanz<br />
als Modell, mit Unterstützung des Senats, Anfang der<br />
90er Jahre gegründet. Es geht nicht, dass die Leute aus<br />
allen Stadtteilen Berlins immer in die Ufa-Fabrik nach<br />
Tempelhof fahren müssen. Wir wollten gerne, dass sich<br />
andere Nachbarschaftszentren anschließen, also der<br />
Träger Nachbarschaftszentrum Ufa-Fabrik bleibt <strong>für</strong> die<br />
Schrei-Baby-Ambulanz verantwortlich, aber sie soll auch<br />
in anderen Stadtteilen stattfi nden können. Im Wedding,<br />
Osloer Straße, in Kreuzberg und Zehlendorf waren Nachbarschaftseinrichtungen<br />
bereit, das mitzutragen und<br />
mitzumachen. Wenn eine Nachbarschaftseinrichtung<br />
eine gute, wichtige und modellhafte Sache hat, dann soll<br />
sie auch mit den anderen geteilt werden. Das ist auch<br />
<strong>für</strong> mich ein Grund, warum es so einen <strong>Verband</strong> gibt und<br />
solche Austauschmöglichkeiten. Wo es schwache Einrichtungen<br />
in Bezirken gibt, wo wir aber <strong>für</strong> die Idee der<br />
Gemeinwesenarbeit, der Nachbarschaftsarbeit und der<br />
Sozialraumorientierung eintreten, dort können wir vorübergehend<br />
die Trägerschaft übernehmen. Es gibt also<br />
durchaus Dinge, <strong>für</strong> die ein Nachbarschaftszentrum den<br />
Bezirk verlassen kann.<br />
Thomas Mampel: Wenn wir feststellen, früher 150 oder<br />
175 Mitglieder, jetzt nur noch 30, wo sind die geblieben?<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 111
112<br />
Workshop Organisations-Erfahrungen<br />
Ich vermute, die sind nicht weg, sondern die sind noch<br />
da. Nur müssen wir gucken, wie wir andere Wege fi nden,<br />
um sie zu erreichen.<br />
Alles, was ich hier in dieser Diskussion höre, fi nde ich total<br />
spannend, weil es mich darin bestätigt, mich weiter mit<br />
diesem Thema auseinanderzusetzen, wie wir mit dieser<br />
Identitätskrise, die uns ja alle umtreibt, umgehen. Eigentlich<br />
wissen wir alle, mehr oder weniger stark ausgeprägt,<br />
dass wir Unternehmen leiten, aber das wird nie so richtig<br />
benannt. Wir benutzen noch andere Begriffe und andere<br />
Denkmodelle, stellen aber fest, dass die auf unsere Wirklichkeit<br />
überhaupt nicht mehr passen. Mit einem e.V. ein<br />
Unternehmen mit 400 Leuten und vielen Abteilungen zu<br />
gründen, das ist irgendwie ein Spagat, den man kaum<br />
noch hinkriegt. Ein erster guter Schritt wäre, wenn wir in<br />
einem anderen Zusammenhang oder in einer anderen<br />
Tagung darüber reden könnten, wie wir <strong>sozial</strong>e Unternehmen<br />
bauen und wie wir mit unserer Identität umgehen,<br />
wie wir sie ins 21. Jahrhundert mitnehmen und weiterentwickeln<br />
können. Ich vermute, dass wir dauerhaft nicht<br />
lebensfähig sind, wenn wir an den Organisationsmodellen<br />
des vorigen Jahrhunderts festhalten. Es ist interessant,<br />
dass das Nachbarschaftsheim Neukölln und das Stadtteilzentrum<br />
Steglitz die einzigen beiden Nachbarschaftseinrichtungen<br />
in Berlin sind, die twittern. Wir bewegen<br />
uns in <strong>sozial</strong>en Netzwerken, wir versuchen, andere Wege<br />
zu fi nden mit Menschen zu kommunizieren, sie irgendwie<br />
auf uns aufmerksam zu machen, sie einzuladen irgendwie<br />
teilzuhaben. Das habe ich mit Open Source-Organisation<br />
gemeint. Das ist zur Zeit mein Lieblingsthema.<br />
Ich fand es sehr schön, dass Georg Zinner gesagt hat,<br />
er macht seit fünf oder sechs Jahren eine Stadtteilzeitung.<br />
Wir machen das seit 14 Jahren, genau aus diesen<br />
Gründen, weil es Leute im Umfeld gibt, die Themen<br />
haben. Unsere Aufgabe ist es, ihnen eine Bühne oder<br />
eine Plattform zu geben, wo sie diese Themen bearbeiten<br />
und kommunizieren können. Was ich mit Strukturen<br />
öffnen meine: es gibt Bürger-Initiativen im Umfeld, denen<br />
haben wir gesagt, nutzt unsere Geschäftsstelle wie eure<br />
eigene Geschäftsstelle, nutzt unsere Strukturen wie eure<br />
Strukturen, nutzt unsere Öffentlichkeitsarbeit als eure<br />
Öffentlichkeitsarbeit. So werden wir wahrscheinlich auch<br />
wieder eine andere Form von Beteiligung <strong>für</strong> die Organisation<br />
realisieren, als wir das jemals mit diesem klassischen<br />
Vereinsmodell mit Mitgliederversammlung und<br />
Vorstand hätten realisieren können. Aber da sind wir erst<br />
am Anfang.<br />
Wenn wir uns ganz klar darüber sind, dass wir <strong>sozial</strong>e<br />
Unternehmen bauen, kommen wir vielleicht zu der Frage,<br />
an welchem Organisationsmodell wir uns orientieren. Ich<br />
habe <strong>für</strong> mich irgendwann beschlossen, dass wir uns <strong>für</strong><br />
das Unternehmen, was wir da bauen, von der Struktur<br />
her nicht mehr an dem altehrwürdigen Nachbarschaftsheim<br />
orientieren. Da kann ich nichts abgucken. Ich habe<br />
großen Respekt vor der <strong>Arbeit</strong> des Nachbarschaftsheims<br />
Mittelhof, aber es taugt <strong>für</strong> mich nicht als Vorbild, wie<br />
ich ein Unternehmen entwickle. Ich muss gucken, wie<br />
sind Unternehmen im privatwirtschaftlichen Bereich – in<br />
einem ganz anderen Feld – aufgebaut, wie organisieren<br />
die interne und externe Kommunikation, wie entwickeln<br />
sie Produkte, wie verlaufen deren Produktzyklen, solche<br />
Sachen muss ich wissen, wenn ich mein <strong>sozial</strong>es Unternehmen<br />
entwickeln will.<br />
Da sind wir alle ganz am Anfang, aber wir werden letztendlich<br />
nicht darum herum kommen, wenn wir den Leuten<br />
im Stadtteil dauerhaft vernünftige Angebote machen<br />
wollen. Das hat zur Folge, dass wir noch mal sehr bewusst<br />
gucken müssen, wie wir die unterschiedlichen Funktionen<br />
trennen. Trennen ist das Stichwort. Natürlich muss ich<br />
die Unternehmenssteuerung professionalisieren, als<br />
Geschäftsführer bin ich da<strong>für</strong> verantwortlich, aber ich<br />
kann von meiner Kita-Leiterin nicht erwarten, dass sie die<br />
Kita unter Aspekten von Produktzyklen entwickelt, sondern<br />
wir müssen diese Funktionen Unternehmenssteuerung<br />
und fachliche <strong>Arbeit</strong> trennen. Ich muss gucken, wie<br />
die unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben in der<br />
Organisation miteinander kommunizieren.<br />
Bei uns führt das dazu, das kann man lustig fi nden oder<br />
nicht, dass unsere Projektleiter mit einem Blackberry herumlaufen<br />
– das funktioniert. Damit kommen Informationen,<br />
die immer mehr und komplexer werden, in Echtzeit<br />
bei den Leuten an, die damit arbeiten müssen. Da komme<br />
ich mit meiner China-Kladde aus dem 19. Jahrhundert<br />
nicht mehr richtig weiter.
TN: Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Nachbarschaftshäuser<br />
ihre Vorstände auch unter strategischem<br />
Gesichtspunkt wählen. Ich glaube, die Heerstraße hat<br />
letztes Jahr auch Barbara John in den Vorstand geholt.<br />
Es wird also nicht mehr geguckt, ob das Nachbarn aus<br />
dem unmittelbaren Umfeld sind, mit der Identifi kation aus<br />
der Nachbarschaft, sondern wer kann mir strategisch in<br />
der Entwicklung meiner Einrichtung weiterhelfen, den<br />
hole ich rein. Wir sind eher noch rückwärts gewandt und<br />
haben nach wie vor einen Vorstand, der aus Nachbarn<br />
besteht. Vielleicht wäre ein Förderverein ein Modell, in<br />
den man strategisch Leute reinholt, die über Beziehungen<br />
dann Perspektiven schaffen.<br />
TN: Ich komme aus der Fabrik Osloer Straße und bin da<br />
auch schon sehr lange, nämlich seit den 80er Jahren.<br />
Wir haben einen ähnlichen Gründungshintergrund wie<br />
ihn Renate eben ausführlich geschildert hat. Wir waren<br />
sehr basisdemokratisch mit Vorstand, geschäftsführendem<br />
Vorstand und Fabrikrat der immer freitags, wenn<br />
alle mit der <strong>Arbeit</strong> fertig waren, stattfand. Bis tief in die<br />
Nacht, wurde diskutiert, bis es einen Konsens gab. Ganz<br />
so schlimm ist es heute nicht mehr.<br />
Wir haben einen Vorstand und eine Geschäftsführung,<br />
aber wir haben nach wie vor drei- bis viermal im Jahr eine<br />
Mitgliederversammlung, wo jeder seinen Senf beiträgt,<br />
vor allen Dingen zur Nachbarschaftsarbeit. Wir sind aus<br />
der Ehrenamtsschiene entstanden, die Pfadfi nder sind<br />
aufs Gelände gegangen, weil es immerhin auch 4.500<br />
qm hat, fi ngen dort an mit ehrenamtlicher Jugendarbeit,<br />
sie haben Jugendliche betreut, unter dem Motto „leben<br />
und arbeiten in der Fabrik Osloer Straße“.<br />
Sie haben dann angefangen die Fabrik mit anderen Projekten<br />
zu beleben, also wir haben Ausbildungsprojekte,<br />
Gas-Wasser-Installateur und Metallbauer, wir haben die<br />
Gäste-Etage, wir haben ein betreutes Wohnen, wir haben<br />
privates Wohnen. Das größte Projekt der Fabrik ist das<br />
Labyrinth-Kindermuseum, das wohl auch am bekanntesten<br />
ist, das wir als Wirtschaftsbetrieb abtrennen mussten.<br />
Wir haben zurzeit noch einen dreiköpfi gen Vorstand, zu<br />
dem ich auch seit zehn Jahren gehöre. Der Vorstand arbei-<br />
tet ehrenamtlich gemeinsam mit dem Geschäftsführer.<br />
Und genau diese Positionen sind im Moment ein großes<br />
Thema der Auseinandersetzung. Es gibt Streit darüber, ob<br />
man mit der alten Vereinsform noch existieren kann. Die<br />
Mitglieder haben entschieden, dass sie sich nicht vergrößern<br />
wollen, sondern dass wir das Gelände ausfüllen bis<br />
es aus allen Fugen platzt, aber wir gehen nicht raus aus<br />
dem Gelände. Das ist eine Diskussion über die Öffnung<br />
nach außen, die schon fast 30 Jahre geführt wird.<br />
Wir als Nachbarschaftsetage sind der Verein Fabrik Osloer<br />
Straße. Wir haben den Auftrag, die <strong>Arbeit</strong> des Vereins<br />
nach außen zu tragen. Wir bemühen uns da auch redlich.<br />
Wir haben vier fest angestellte Kollegen und Kolleginnen.<br />
Im letzten Jahr sind wir mit dem Nachbarschaftshaus<br />
Prinzenallee fusioniert worden, weil das abgewickelt<br />
wurde. Petra Kindermann kam als vierte Mitarbeiterin<br />
mit zu uns ins Boot. Dieser Fusionsprozess ist noch nicht<br />
abgeschlossen. Wir bauen zur Zeit noch Räume da<strong>für</strong><br />
aus. Aber diese Basisdemokratie ist bei uns immer noch<br />
ein Ansatz, der uns große Probleme bereitet. Wir haben<br />
30 Vereinsmitglieder, die alle auf dem Gelände wohnen<br />
oder arbeiten, der Vorstand sind fünf Leute und wir haben<br />
kein strategisches Mitglied, sondern es ist wirklich so, wie<br />
es früher war. Diese Art der Organisation ist sehr zeitintensiv.<br />
TN: Und das kostet Nerven.<br />
TN: Ja, sehr.<br />
TN: Thomas meinte, dass wir mittlerweile zwar <strong>sozial</strong>e<br />
Unternehmen geworden sind, aber noch in Strukturen<br />
denken und reden, die vorher waren. Diejenigen, die<br />
dieses Wachstum mitgemacht haben und sehen, was<br />
sie damit in ihrem Stadtteil gestalten können, müssen<br />
sich auf der anderen Seite aber auch klar über die Gefahr<br />
sein, dass die Dynamik außer Kontrolle geraten kann. Es<br />
kann eine relativ anonyme Organisation entstehen, wo wir<br />
uns fragen müssen, welches die Identität solch eines <strong>Verband</strong>es<br />
oder solcher Einrichtungen ist, was wir davon vertragen<br />
und was nicht. Ist das nur Historie, so fi ng es mal<br />
an, aber jetzt sind wir ein Dachverband moderner Sozial-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 113
114<br />
Workshop Organisations-Erfahrungen<br />
unternehmen? Oder gibt es so etwas wie einen Kern, der<br />
bei allem Wachstum, bei allen neuen Aufgaben, bei aller<br />
Vergrößerung, zur Identität gehört?<br />
Du hast darauf hingewiesen, dass man darauf achten<br />
muss, wenn man über den lokalen Bereich hinausgeht,<br />
welche Bedrohung das <strong>für</strong> die eigene Identität beinhalten<br />
kann. Alles andere fi nde ich vollkommen in Ordnung,<br />
dass man die gesamte Organisationsstruktur überdenkt<br />
und auch den momentanen Notwendigkeiten anpasst.<br />
Der Kerngedanke muss aber immer erhalten bleiben,<br />
dass nämlich die Menschen im Stadtteil Unterstützung<br />
zur Umsetzung ihrer Anliegen bekommen sollen. Was das<br />
heute heißt, an dem Punkt sollten wir weiter arbeiten.<br />
Thomas Mampel: Ich kriege mit, dass wir als Stadtteilzentrum,<br />
auch als <strong>Verband</strong>, vielleicht gerade Gefahr laufen,<br />
eine Entwicklung zu verpassen. An diesem Wochenende<br />
fi ndet in Berlin zum dritten oder vierten Mal dieser<br />
Vision Summit statt. Da laufen Leute rum, die in unseren<br />
Strukturen wahrscheinlich ganz unbekannt sind. Die<br />
kommen mit einem ganz anderen Weltbild, das sind <strong>sozial</strong>e<br />
Unternehmer, auch in ihrem Selbstverständnis, und<br />
entwickeln <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>e Problemlagen oder <strong>für</strong> Fragen der<br />
Nachhaltigkeit unternehmerische Lösungen. Sie wollen<br />
eine bessere Welt und damit Geld verdienen. Die kommen<br />
gar nicht klar mit einem bestimmten Ballast, den<br />
wir mit uns herumtragen, dass wir alles unter einen Hut<br />
kriegen wollen. Deren Bereich wird immer größer.<br />
Was ich damit sagen will ist nicht, dass wir dieser Entwicklung<br />
hinterher hecheln und alles über Bord schmeißen<br />
sollen, was wir bisher <strong>für</strong> richtig und erhaltenswert<br />
fanden. Sondern dass wir diese Themen aufnehmen<br />
sollten, dass wir gucken, sind unsere Häuser, unsere Einrichtungen,<br />
eigentlich <strong>für</strong> die Fragen, die da draußen eine<br />
Rolle spielen, gut gerüstet und bieten wir inhaltlich und<br />
strukturell, organisatorisch und von unserer wirtschaftlichen<br />
Leistungsfähigkeit her eine Struktur, die zukünftig<br />
eine Rolle spielen kann? Das ist ein Thema <strong>für</strong> einen<br />
eigenen Kongress.<br />
Ich vermute, dass das jetzt so eine spannende Zwischenphase<br />
ist. So wie du sagst, da geht irgendwann ein Zeitfenster<br />
zu, plötzlich wird man wach und die Landschaft ist<br />
eine andere. Da sollten wir wirklich gucken, dass wir den<br />
Anschluss nicht verlieren. Mit dem, was wir alles haben,<br />
fragen wir: was ist eigentlich unsere Vision oder Mission,<br />
wie soll Gemeinwesen, wie soll der Sozialraum, wie soll<br />
eine Stadt aussehen, dass wir was in diese neue Zeit einbringen,<br />
und das Nachbarschaftsheim 2.0 entwickeln.<br />
TN: Mir gibt es einen kleinen Stich, wenn gesagt wird, dass<br />
diese ganzen basisdemokratischen Sachen von damals<br />
nur eine Belastung und zeitaufwändig und nervig sind.<br />
Das ist so. Andererseits wünsche ich mir immer noch eine<br />
Einrichtung, die von einer lebendigen und kompetenten<br />
Mitgliedschaft getragen wird, aber das haben wir in der<br />
Regel nicht, das ist wohl nicht so einfach.<br />
Einen Auftrag haben wir, auch im Vertrag Stadtteilzentren<br />
beschrieben, das ist die Förderung von Partizipation von<br />
Menschen. Also wo bleibt die Partizipation in einem Unternehmen,<br />
was natürlich in gewisser Weise diese breite<br />
Partizipation gar nicht mehr möglich macht? Ich denke,<br />
dass das in die Richtung gehen wird, dass wir wirklich<br />
Unternehmen sind, wir müssen uns dessen bewusst sein.<br />
Aber es sind <strong>sozial</strong>e Unternehmen, die hier entstehen,<br />
und da<strong>für</strong> muss man Organisationsstrukturen aufbauen,<br />
damit dieser Apparat funktioniert. Auf der Vereinsebene<br />
können wir zur Umsetzung unserer umfangreichen Aufgaben<br />
nicht bleiben. Also machen wir Vereine, die juristisch<br />
funktionsfähig sind, kleiner, acht bis zehn Leute, die alle<br />
hoch kompetent sind, und so ein Unternehmen führen<br />
können, daraus sind vier oder fünf Vorstände gewählt.<br />
Die Partizipation der Menschen, mit denen wir arbeiten,<br />
muss in davon abgetrennten und noch zu entwickelnden<br />
Strukturen passieren.<br />
TN: Ich bin ja viel unterwegs in der Welt und gucke mir<br />
Nachbarschaftszentren in anderen Ländern an. Wenn<br />
ich zurückkomme, dann denke ich jedes Mal, dass es<br />
uns hier doch verdammt gut geht. Wir waren in Israel<br />
und haben uns viele Community-Centers angeguckt. Ein<br />
besonderes Community-Center ist im arabischen Teil<br />
im Norden Israels, in einem arabischen Dorf. Das Haus<br />
wurde von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. In diesem<br />
Haus begegneten uns zwei Drusen, ein Mann und
eine Frau. Drusen, das ist eine religiöse Richtung in den<br />
arabischen Ländern und auch in Israel. Die haben uns<br />
berichtet, unter welchen Voraussetzungen und wie sie die<br />
<strong>Arbeit</strong> in ihrem Center gestalten.<br />
Ein wesentlicher Punkt, den die beiden dort machen, ist,<br />
dass sie ein Theater <strong>für</strong> taubstumme Menschen gegründet<br />
haben. Mit diesen Menschen machen sie Theateraufführungen.<br />
Wichtig dabei ist, dass jeder Mensch, der<br />
behindert ist, in der arabischen Welt versteckt wird. Das<br />
ist ein Grund <strong>für</strong> Familien, sich zu schämen. In einem Film<br />
haben wir die Entwicklung gesehen, da meinten Familienmitglieder,<br />
dass sie hoffen, dass ihr Kind eine Stunde vor<br />
ihnen tot ist, weil sie ihr Kind nicht in dieser Welt lassen<br />
wollen. Das Kind saß daneben, war 18 Jahre alt und hat<br />
voll mitbekommen, was gesagt wurde. Da haben diese<br />
beiden Menschen die Vision entwickelt, dass sie mit<br />
diesen behinderten Menschen ein <strong>für</strong> sie lebenswertes<br />
Leben in der Nachbarschaft organisieren. Das ist ihnen<br />
gelungen – mit so gut wie gar keinen Mitteln.<br />
Die sind weit entfernt von einem Nachbarschaftszentrum<br />
2.0, die haben nicht mal einen Computer. Diese Idee und<br />
diese Vision und das, wo<strong>für</strong> diese beiden brennen, was die<br />
bewegen, ich fi nde, das ist lernenswert, also sich davon<br />
eigenen Enthusiasmus zu holen. Das ist eine gute Sache.<br />
Als Hintergrund noch ein anderer wichtiger Punkt: Neda,<br />
eine Frau, Mittvierzigerin, ist eine junge Witwe gewesen,<br />
hat mit 16 geheiratet und ihr Mann starb im Krieg, als<br />
sie 23 war, sie hatte zwei Kinder. Für eine Frau dort heißt<br />
das, dass sie keinerlei gesellschaftlichen Kontakt mehr<br />
pfl egen darf. Entweder zieht sie zu den Schwiegereltern<br />
oder die Schwiegereltern zu ihr, sie darf sich nur noch im<br />
Haus aufhalten und sich um die Kinder kümmern. Neda<br />
ist es gelungen, in dieses Community Center zu gehen,<br />
mit dem Einverständnis ihrer Schwiegereltern, dort zu<br />
arbeiten und andere Frauen, denen es genauso wie ihr<br />
geht, die zu Hause sitzen und völlig weggeschlossen sind,<br />
deren Leben eigentlich mit 23 vorbei ist, dorthin zu holen<br />
und mit ihnen zu arbeiten. Sie hat ihnen sogar <strong>Arbeit</strong> verschafft,<br />
indem sie in Heimarbeit zum Beispiel Adressen<br />
schreiben können. Das Beispiel <strong>für</strong> Nachbarschaftsarbeit<br />
hat mich sehr berührt, genährt von dem Lebenswillen und<br />
dem Enthusiasmus der Menschen, die das machen.<br />
Ich war 1996 in Rumänien und habe dort ein Nachbarschaftszentrum,<br />
so kann man das eigentlich gar nicht<br />
nennen, ein kleines in einem Hinterhof gelegenes Zimmerchen<br />
mit Außenklo, besucht. Eine alte Frau, eine<br />
junge Frau und zwei Jugendliche hatten dort eine Einrichtung<br />
und wollten etwas <strong>für</strong> Familien im Umkreis und<br />
<strong>für</strong> die Straßenkinder aufbauen. Sie hatten dieses kleine<br />
Zimmerchen und waren von niemandem akzeptiert. Sie<br />
hatten durch eines unserer Mitglieder Kontakt zum IFS<br />
gewonnen und durch die Tagung und das Seminar, die wir<br />
dort gemacht haben, konnten wir sie unterstützen. guckt<br />
mal, die sind auf internationalem Gebiet unterwegs, was<br />
in Rumänien viel galt. Durch ihre langjährige, geduldige,<br />
hartnäckige Art und Weise hatten sie erreicht, dass sie<br />
jetzt von der örtlichen Gemeinde ein Haus zur Verfügung<br />
gestellt bekamen, ihre <strong>Arbeit</strong> ist anerkannt. Miorita, die<br />
mittlerweile an die 70 ist, ist zur Ehrenbürgerin dieser<br />
Stadt ernannt worden.<br />
Denen war wichtig nicht aufzugeben, sondern zu sagen:<br />
<strong>für</strong> uns ist diese <strong>Arbeit</strong> wichtig und wir wollen sie machen,<br />
wir geben nicht auf, egal, was passiert. Und wir schaffen<br />
uns starke Verbündete in unserem eigenen Kreis, aber<br />
auch darüber hinaus. Das ist <strong>für</strong> mich das Plädoyer da<strong>für</strong>,<br />
nicht nur alleine <strong>für</strong> sich als Organisation da zu sein, sondern<br />
sich mit anderen zusammenzutun, sich auszutauschen,<br />
zu geben und zu nehmen, und auch das Gute,<br />
was man hat, woanders hinzutragen. Und das nicht nur<br />
im nationalen Rahmen, sondern auch durchaus international,<br />
denn das bringt einen auch immer wieder auf den<br />
Boden.<br />
Wenn man weiß, was woanders los ist ... bei mir führt das<br />
immer dazu, dass ich sehr bescheiden und dankbar bin <strong>für</strong><br />
das, was uns hier ermöglicht wird. Wir haben übrigens alle<br />
unsere Reisen, die wir über den <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> machen, mit Fotos und Reisetagebüchern dokumentiert<br />
und zwar auf der Seite www.stadtteilzentren.de.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 115
Input:<br />
Workshop<br />
Gründungs-Impulse<br />
Neue Initiativen begegnen „alten Hasen“<br />
Georg Zinner Nachbarschaftsheim Schöneberg<br />
Peter Stawenow ehem. Gründer Nachbarschaftszentrum<br />
Bürger <strong>für</strong> Bürger (Mitte)<br />
Ben Eberle Begegnungszentrum Adalbertstr. (Kreuzberg)<br />
Hella Pergande ehem. Rabenhaus (Köpenick)<br />
Moderation: Reinhilde Godulla<br />
Reinhilde Godulla: Fangen wir gleich mit dem Input von<br />
Hella Pergande an, heute Mitarbeiterin von Outreach in<br />
der „Mobilen Kinderarbeit“, vor 20 Jahren war sie Mitbegründerin<br />
des Rabenhauses in Berlin-Köpenick.<br />
Hella Pergande: 20 Jahre zurück – wenn ich mein Leben<br />
im Nachhinein betrachte, dann bin ich ein unheimliches<br />
Glückskind. Die Mauer ist gefallen, Peter Stawenow und<br />
ich waren wahrscheinlich, wie sich herausstellte, die einzigen<br />
DDR-Bürger, die nicht im aktiven Widerstand waren.<br />
Auf einmal konnte man Dinge machen, die man vorher<br />
nie machen konnte. Wir haben zum Beispiel ein Kindertheater<br />
gegründet, auf einmal bin ich Geschäftsführerin<br />
geworden, weil die ABM-Maßnahmen ausliefen und die<br />
ursprünglichen Geschäftsführer erfahren haben, dass<br />
der Senat nicht so gut zahlt, dann waren sie alle weg.<br />
Geschenke, Geschenke, Geschenke – die Zeit war einfach<br />
total toll. Man konnte erst mal machen und alles hat<br />
viel Spaß gemacht.<br />
Herbert brachte schon das kurze Hesse-Zitat in der Einladung<br />
„…und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …“,<br />
aber ich lese Hermann Hesse (Stufen) einfach mal vor:<br />
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend<br />
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,<br />
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend<br />
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.<br />
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe<br />
bereit zum Abschied sein und Neubeginne,<br />
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern<br />
in andre, neue Bindungen zu geben.<br />
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,<br />
der uns beschützt und der uns hilft zu leben.<br />
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,<br />
an keinem wie an einer Heimat hängen,<br />
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,<br />
er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.<br />
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise<br />
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,<br />
nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,<br />
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.<br />
In dem Sinne muss man halt weiter gehen, tun.<br />
Reinhilde Godulla: Wie war eure Neugründung im Rabenhaus?<br />
Oder warst du da gar nicht dabei?<br />
Hella Pergande: Doch, natürlich. Das waren 20 ABM-<br />
Kräfte, keiner von denen wusste wirklich, was er tun<br />
sollte. Da haben wir gesagt, dann gründen wir mal einen<br />
Verein – und saßen plötzlich da mit einem Haufen Kohle.<br />
Da konnten wir uns „goldene Wasserhähne“ (Zitat H.<br />
Scherer) kaufen.<br />
TN: Wie kamt ihr auf die Idee, ein Nachbarschaftsheim<br />
zu gründen?<br />
Hella Pergande: Die Idee wurde uns zugetragen. Wir<br />
saßen in einem netten Haus, irgendwann kamen auch<br />
Leute vom Senat und haben geguckt, was sich lohnt.<br />
Ein Häuschen, das ist ganz nett, ... aber es hat nicht uns<br />
gehört, sondern wurde von der Treuhand verwaltet. Wir<br />
sind dann trotzdem irgendwie in die Förderung reinge-
utscht. Die Treuhand wollte dann 8.000 DM Miete, da sind<br />
wir in eine Wohnung gezogen. Eigentlich ist es ein Wunder,<br />
dass sie das Rabenhaus nicht geschlossen haben.<br />
TN: Und nach der Wohnung?<br />
Hella Pergande: Eine neue Wohnung, dann noch eine<br />
Wohnung, Theater eingeräumt, Theater ausgeräumt, also<br />
immer auf Achse, und immer geguckt, wie kommt man<br />
mit dem bisschen klar, was der Senat ausspuckt. Nach<br />
etwa 3 Jahren stellte eine Kollegin fest: „Ich glaube, jetzt<br />
ist die Wende vorbei, schade.“<br />
Ehrenamtliche hatten auch einfach Mitleid mit uns und<br />
haben enorm viel geholfen. Das war eine schöne Zeit. Wir<br />
sind von diesem Haus mit Garten in eine Wohnung gezogen<br />
und von der in den Laden.<br />
TN: Nachdem die Wende vorbei war?<br />
Hella Pergande: Genau.<br />
TN: Wie viele sind von damals noch mit dabei?<br />
Hella Pergande: Der Vorstand ist noch da, einige andere auch.<br />
Reinhilde Godulla: Du hast also die Erfahrung der Neugründung.<br />
Georg Zinner: Es hat immer neue Initiativen gegeben,<br />
auch in den 70er und 80er Jahren. Wir waren auch am<br />
Anfang eine neue Initiative aus Sicht der alten Nachbarschaftsheime,<br />
denn als ich berufl ich ins Nachbarschaftsheim<br />
eingestiegen bin, zu der Zeit gab es sieben in Berlin.<br />
Die waren eigentlich am Ende mit ihren fachlichen Themen,<br />
die waren alle gleichzeitig am Ende und wussten<br />
nicht, was sie machen sollten, um die Leute zu erreichen<br />
und welche Angebote man macht.<br />
1978 habe ich da angefangen, das war eine depressive<br />
Phase, in Westdeutschland hatte es die Studentenbewegung<br />
gegeben, anschließend kam die Sozialarbeiterbewegung,<br />
Diskussion um Gemeinwesenarbeit, es entstanden<br />
die Bürger-Initiativen, dann kam die Kinderladen-Bewe-<br />
gung. Die Nachbarschaftszentren hatten daran irgendwie<br />
keinen praktischen Anteil, obwohl sie an der Diskussion<br />
sehr stark beteiligt waren. Ich habe das so erlebt, dass<br />
man sich nicht entscheiden konnte zwischen dem Alten<br />
und dem Neuen. Als ich im Nachbarschaftsheim Schöneberg<br />
anfi ng, da war das einzige, was funktioniert hat,<br />
die Altenarbeit. Das war <strong>Arbeit</strong> mit Ehrenamtlichen, mit<br />
Gruppen in einer sehr autoritären Struktur, aber sie hat<br />
funktioniert. Alles andere hat praktisch nicht funktioniert,<br />
es gab einen Stadtteilarbeiter, aber der wusste gar nicht,<br />
was er den ganzen Tag über machen sollte. Es gab einen<br />
Kindergarten bzw. eine Kindertagesstätte voller Orientierungslosigkeit,<br />
weshalb die Nachbarschaft ihre Kinder gar<br />
nicht geschickt hat.<br />
Für mich war das aber gleichzeitig die Chance, etwas<br />
Neues anzufangen. Dieses Neue war schon überall<br />
sichtbar, überall waren die Kinderläden entstanden, die<br />
Bürger-Initiativen waren da, später haben sich Selbsthilfe-Gruppen<br />
etabliert und suchten Anlaufstellen. Man<br />
musste nur versuchen, das alles zusammen zu bringen,<br />
also die eigene Einrichtung da<strong>für</strong> zu öffnen, dass diese<br />
Initiativen andocken konnten. Man musste nur konkrete<br />
Angebote machen, die einen unmittelbaren Nutzen <strong>für</strong> die<br />
Bürger hatte, also nicht nur offene <strong>Arbeit</strong>, sondern konkrete<br />
Angebote machen. Man musste sozusagen immer<br />
was machen.<br />
In unserem Fall sind türkische Familien zugezogen. Und<br />
weil wir ein Haus <strong>für</strong> alle sein wollten, mussten wir etwas<br />
<strong>für</strong> die türkische Bevölkerungsgruppe machen. So entstand<br />
der türkische Frauenladen, und nach und nach<br />
kam dann alles andere. Es war der Versuch, ganz praktische<br />
konkrete Angebote zu schaffen, und der Versuch,<br />
Transparenz herzustellen, in die Öffentlichkeit zu gehen,<br />
zu werben, Flyer bzw. das Faltblatt zu verteilen und sich<br />
wieder bekannt zu machen, dann lief das eigentlich alles<br />
von selber.<br />
Die Diskussion im <strong>Verband</strong>, die gestern auch in einer<br />
<strong>Arbeit</strong>sgruppe zum Thema Gemeinwesenarbeit in den<br />
Einrichtungen aufgefl ammt ist, hat das ein bisschen<br />
widergespiegelt, was es da <strong>für</strong> eine Haltung gab. Ich war<br />
ein absoluter Anhänger davon, Einrichtungen zu schaffen,<br />
wo Bürger sich treffen können, wo Bürger ihre Sachen<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 117
118<br />
Workshop Gründungs-Impulse<br />
machen können, also wo wir eine dienende Struktur sind.<br />
Ich verwende gerne das Wort Dienstleister, Treuhänder,<br />
wir müssen uns zur Verfügung stellen. Wir dürfen auch<br />
vorhandene Initiativen stärken, Kinder und Jugendliche<br />
müssen gefördert und unterstützt werden, Erwachsene<br />
muss man ernst nehmen, also da gibt es unterschiedliche<br />
Herangehensweisen. Aber letztlich geht es immer darum,<br />
die Fähigkeiten und Potenziale der Menschen zu wecken,<br />
zu fördern, Initiativen zu ermöglichen und Räume da<strong>für</strong> zu<br />
schaffen. Das war das, was in den 80er Jahren umgesetzt<br />
wurde und uns wieder ins Gespräch gebracht hat.<br />
Das gilt auch <strong>für</strong> die Wendezeit. Der Senat hatte inzwischen<br />
gemerkt, welche umfangreichen Potenziale sich<br />
auftun, wenn man ehrenamtliche <strong>Arbeit</strong> fördert, Initiativen<br />
von Menschen unterstützt, Sozialarbeit nicht als Pfl aster<br />
auffasst, sondern mit den Stärken der Menschen arbeitet.<br />
Wo<strong>für</strong> wir manchmal auch belächelt worden sind. Wir<br />
heißen <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong>, aber wer hier<br />
die Kulturarbeit einführte, der hat eins auf den Deckel<br />
gekriegt, das kann man nachlesen. Ich habe das nicht<br />
immer kapiert, aber es war so.<br />
Diese Entwicklung in den 80er Jahren, die einige Nachbarschaftsheime<br />
hier in Berlin genommen haben, die<br />
hat uns nach der Wende in die Position gebracht, dass<br />
der Senat ein Modell vorzeigen konnte, hinter dem Nachbarschaftszentren<br />
standen als eine moderne Form, die<br />
mit Sicherheit der Bürgerschaft entgegenkam. Warum<br />
ist diese Form so modern gewesen? Weil die herkömmlichen<br />
gesellschaftlichen Institutionen ihre Bindungskraft<br />
verloren hatten, ob das Familie war, Kirchengemeinden,<br />
Parteien, Gewerkschaften, Sportvereine, die<br />
Leute müssen sich dort festlegen. Sie haben immer in<br />
bestimmten Lebenslagen Orte gesucht, wo sie Rat und<br />
Unterstützung bekommen, was Nachbarschaftsheime<br />
in dem Moment nicht bieten konnten. Deswegen war<br />
die neue Struktur so wichtig. Dann konnte ganz schnell<br />
in der Wendezeit von den Nachbarschaftsheimen ausgehend<br />
auch eine Beratung geleistet werden, die dann<br />
auch in anderen Stadtteilen angeboten werden konnte.<br />
Speziell die Alten freuten sich darüber, dass in ganz<br />
Berlin eine sehr interessante neue Debatte entstanden<br />
war. Und dass die im Ostteil der Stadt sehr schnell auf-<br />
gegriffen, akzeptiert und angenommen wurde, hat uns<br />
erheblich voran gebracht. Da war zur richtigen Zeit die<br />
richtige Idee da, so würde ich das sagen, die viele Leute<br />
annehmen konnten.<br />
Peter Stawenow: Es gibt Meilensteine oder Entwicklungsabschnitte<br />
in jedem Leben, wo jeder über sich selber<br />
nachdenkt: Was habe ich erreicht? Wie weit bin ich<br />
gekommen? Was habe ich geschafft oder wie geht es<br />
weiter? Da<strong>für</strong> gibt es verschiedene Anlässe, normalerweise<br />
wenn man die Schule verlässt, die Ausbildung abgeschlossen<br />
hat, krank wird oder auch eine einschneidende<br />
gesellschaftliche Veränderung, wie es beim Zusammenbruch<br />
der DDR war. Das war auch so ein Punkt, wo man<br />
sich selber gefragt hat, ob das, was man bisher gemacht<br />
hat, richtig oder falsch war. Oder ob die Werte, an die man<br />
geglaubt hat, noch aktuell sind. Man hat sich selber hinterfragt<br />
und musste sich auch selber wieder einen Platz<br />
suchen.<br />
Zur Wendezeit war ich 26/27 Jahre alt und war hauptamtlich<br />
im Jugendverband der FDJ tätig, bin also kein „Widerstandskämpfer“<br />
gewesen, war aber immer bemüht, etwas<br />
zu verändern und zu bewegen. Ich hatte die Vorstellung,<br />
je höher man in einer Funktion ist, umso mehr kann man<br />
verändern oder bewegen. 1988 bin ich nach Berlin in<br />
den Zentralrat geschickt worden, um dort die Fragen der<br />
Berufsausbildung, Lehrlingswohnheime, Informatikausbildung<br />
voranzubringen und Kurse einzurichten, wo<strong>für</strong><br />
ich viele Gespräche mit Lehrlingen in den Wohnheimen<br />
geführt hatte. Dann kam die Wende 1989 und man hat<br />
gesehen, wie die führenden Funktionäre dort alle fl uchtartig<br />
die Plätze verlassen haben. Ich sagte, das kann doch<br />
nicht sein. Das Kapitel muss man ordentlich zu Ende bringen.<br />
1991 hatte ich dieses Kapitel abgeschlossen, ohne<br />
dass eine Insolvenz erfolgen musste, und habe mich dann<br />
als letzter Hauptamtlicher dort selber entlassen.<br />
Dann war dieser Punkt erreicht, dass ich mich fragte, was<br />
ich nun mache und wie es weitergeht. Es war unheimlich<br />
viel Neues, was sich 1991 in dieser ersten Periode der<br />
Nachwendezeit alles entwickelt hat. Es war viel Verunsicherung<br />
da, <strong>für</strong> die Menschen war alles neu, angefangen<br />
bei einer Lohnsteuerkarte, die man sich besorgen musste,
oder einen Lohnsteuerjahresausgleich zu machen, sich<br />
bei der Krankenkasse anzumelden. Viele sind aus der Kirche<br />
ausgetreten, um keine Kirchensteuer zu bezahlen,<br />
obwohl sie irgendwann mal getauft wurden. Es gab viele,<br />
viele Dinge, die anders waren.<br />
Dieses Nachdenken, was man tun kann, doch auch mit<br />
dem Anspruch, etwas zu bewegen und zu verändern, kann<br />
man alleine machen, wobei fraglich ist, ob man dann zu<br />
den richtigen Ergebnissen oder Antworten kommt. Oder<br />
man sucht sich Menschen, mit denen man darüber reden<br />
kann, um mit ihnen gemeinsam den richtigen Weg zu fi nden.<br />
Auf der Suche nach Veränderung bin ich dann auf den<br />
<strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> gestoßen, ich traf<br />
interessante Menschen wie Georg Zinner, Herbert Scherer<br />
und andere. Was habe ich aus diesen Gesprächen<br />
mitgenommen? Einerseits, dass es wirklich wichtig ist,<br />
in den Diskussionen ein eigenes Selbstverständnis zu<br />
fi nden. Ich komme noch darauf zurück, dass es natürlich<br />
aktueller denn je ist, diese Diskussion zu führen. Ich<br />
musste ein bisschen schmunzeln über das, was Georg<br />
jetzt erzählt hat, weil das genau die Argumente waren,<br />
mit denen wir überlegt haben, wie man das, was man als<br />
Idee hat, umsetzen kann. Wir brauchen Einrichtungen, wir<br />
brauchen Menschen, die mitmachen. Auch der Gedanke,<br />
nicht den Menschen etwas bieten zu wollen, sondern die<br />
Menschen sollen sich selber etwas bieten, sich als Diener<br />
zu verstehen, Leute zum Handeln zu motivieren. Dann<br />
stellt sich natürlich die Frage, wie man das umsetzt, denn<br />
die Idee ist das eine, das andere ist die Realisierung.<br />
Ich habe dann als ABM-Kraft angefangen und ein Konzept<br />
<strong>für</strong> einen Nachbarschaftsladen entwickelt, auf das<br />
wir alle stolz waren. Die vier B’s dieses Konzeptes waren:<br />
Beratung, Betreuung, Begegnung und Bildung, das sind<br />
vier wichtige Komplexe, die den Menschen helfen konnten,<br />
in dieser Zeit klarzukommen. Bildung verstanden wir<br />
in unterschiedlichsten Formen, nicht nur Berufsbildung,<br />
Weiterbildung oder Qualifi zierung, wobei ja viele einen<br />
Weg fi nden mussten, nach ihrer <strong>Arbeit</strong>slosigkeit überhaupt<br />
in einem Beruf unterzukommen. Sondern auch<br />
Bildung in Form von Berufsorientierung, Bildung in Form<br />
von Reisen, denn man bildet sich, indem man andere<br />
Kulturen und andere Länder kennen lernt. Das war ja in<br />
der DDR nicht so möglich. Oder auch Bildung in Form von<br />
Nachhilfeunterricht, wo sich Menschen generationsübergreifend<br />
helfend Lesen, Schreiben und Rechnen beige-<br />
bracht haben. Ich könnte das jetzt weiter fortsetzen, also<br />
Bildung, Beratung, Begegnung und Betreuung.<br />
Um diese Idee umzusetzen, mussten wir Räumlichkeiten<br />
fi nden. Wir haben lange gesucht. In der Strelitzer Straße<br />
lag das Gebäude, das wir schließlich gefunden hatten,<br />
und zwar genau dort, wo es einen Fluchttunnel zwischen<br />
Ost und West gegeben hatte. Mensch, dachten wir, als<br />
wir dieses Gebäude sahen, das hat <strong>für</strong> uns etwas Symbolisches.<br />
Die Gegend war zugleich Ost und West, also Mitte<br />
und Wedding, die dort aufeinanderprallen.<br />
Wir haben überlegt, ob wir wieder dasselbe machen<br />
wollten, wie es zu DDR-Zeiten war, nämlich was Fertiges<br />
hinzustellen und zu warten, bis die Leute kommen.<br />
Oder sagen wir nur: das sind die Räume, die<br />
ihr nutzen könnt, wie Georg Zinner gesagt hat. Damit<br />
haben wir angefangen; eine Befragung in der Nachbarschaft<br />
gemacht;Leute konnten sich ehrenamtlich engagieren,<br />
Handarbeitszirkel, Nachhilfeunterricht oder im<br />
Kulturbereich. Die Bürger haben dann dieses Zentrum<br />
selber ausgestattet. Der Malzirkel hat Bilder gemalt,<br />
die dort aufgehängt wurden. Der Handarbeitszirkel hat<br />
Gardinen genäht. Damit haben die Menschen das als<br />
ihre Einrichtung angenommen, als ihr Zentrum, was<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 119
120<br />
Workshop Gründungs-Impulse<br />
wichtig wurde im späteren Überlebenskampf, weil<br />
vieles als ABM-Maßnahme zeitlich begrenzt war.<br />
Ich will nur noch zwei wichtige Episoden schildern, die<br />
mich geprägt haben. Wir haben nicht nur offene Türen vorgefunden.<br />
Sondern bei manchen Gesprächspartnern war<br />
auch eine tiefe Distanz zu spüren – in zwei Richtungen: im<br />
Westteil der Stadt, nach dem Motto: jetzt kommen Neue,<br />
jetzt wollen die auch noch was von dem Finanzkuchen<br />
abhaben. Aber teilweise auch bei den neuen Initiativen<br />
untereinander im Ostteil der Stadt, weil nur sieben Einrichtungen<br />
von der Senatsverwaltung gefördert wurden.<br />
Es gab aber viel mehr Initiativen. Da spielte Konkurrenz<br />
eine Rolle.<br />
Wir gehörten nicht zu den sieben geförderten Einrichtungen.<br />
Der Bezirk Lichtenberg, das war der Wahlbezirk<br />
des Jugendsenators Krüger, der als nackter Mann auf<br />
einem Plakat zu sehen war. Der Jugendsenator wollte,<br />
dass in seinem Wahlkreis ein Nachbarschaftszentrum<br />
entstehen sollte. Dann wurde eben gleich eins aus dem<br />
Boden gestampft, bzw. es wurde zunächst mal ein Zelt<br />
aufgebaut.<br />
Reinhilde Godulla: Aber das war ja schon 1995/1996.<br />
Peter Stawenow: Ja, das gehört zu dieser Überlebenskampfphase.<br />
Da hat sich dann ausgezahlt, dass die Bürger<br />
schon so verwurzelt und aktiv waren. Wir waren wie in<br />
unserer Startphase wieder an dem Punkt angekommen,<br />
wo man darüber nachdenken musste, was Gemeinwesenarbeit,<br />
Nachbarschaftszentren oder Stadtteilzentren zur<br />
Verbesserung eines Sozialraums beitragen können.<br />
Ben Eberle: Mein Sohn war gerade geboren, er war vier<br />
Monate alt, als mich Freunde anriefen, dass die Mauer<br />
gefallen ist. Mein Kopf sagte, dass das ein großes Ereignis<br />
ist, aber emotional war ich nicht so dabei. Ich sagte, ja,<br />
das ist toll, aber mein Sohn, Gott sei Dank, der schläft<br />
gerade, ich habe ein bisschen Ruhe. Dann kamen viele<br />
Freunde vorbei, die zur Mauer wollten, ich war so froh,<br />
dass ich endlich schlafen konnte, dass ich nicht mitgegangen<br />
bin.<br />
Dann habe ich 1994 bei der <strong>Arbeit</strong>erwohlfahrt angefangen,<br />
das Begegnungszentrum zu leiten. Das ist eine Einrichtung,<br />
die aus der Immigrations<strong>sozial</strong>arbeit entstanden<br />
ist, ein Beratungszentrum <strong>für</strong> türkische Mitbürger.<br />
Die waren auch eine Kultureinrichtung, fokussiert auf<br />
die Immigrations<strong>sozial</strong>arbeit. Das hat alles nicht mehr<br />
so wie gewollt funktioniert, darum wurde ein neues Konzept<br />
entwickelt. Das hatte noch nicht mit meiner <strong>Arbeit</strong> zu<br />
tun, aber das war mein Einstieg. Damals war das große<br />
Thema die <strong>Arbeit</strong> mit älteren Migranten. Ich habe mit der<br />
damaligen Koordinatorin ein neues Konzept <strong>für</strong> das Haus<br />
geschrieben. Das Haus ist am Mariannenplatz, ungefähr<br />
20 Meter von der ehemaligen Mauer entfernt. Das war<br />
ein recht großes Haus, das heißt, auch mit viel Potenzial,<br />
aber es war im Gemeinwesen nicht verankert. Das Haus<br />
war sehr bezogen auf die Situation der türkischen Migranten.<br />
Wir überlegten, welche Ressourcen wir haben und<br />
was man tun könnte. Es hat sich angeboten bzw. es hat<br />
geradezu danach geschrien, sich in Richtung Gemeinwesenarbeit<br />
zu orientieren, also den Schwerpunkt auf die<br />
türkischen Migranten beizubehalten, aber die Einrichtung<br />
im Stadtteil mehr bekannt zu machen bzw. zu etablieren,<br />
so ähnlich, wie Georg das beschrieben hat.<br />
Das war nicht so leicht bei der AWO umzusetzen, weil <strong>für</strong> sie<br />
die Gemeinwesenarbeit ein wenig fremd war. Das hat etwas<br />
mit dem zentralistischen Blick auf die <strong>Arbeit</strong> zu tun. Irgendwann<br />
sagten sie aber: gut, mach mal, mal schauen, was daraus wird.<br />
In der Wendezeit fühlten sich teilweise die Migranten, mit<br />
denen wir zu tun hatten, erst mal als Opfer. Plötzlich war
die Fokussierung auf Ost und West und nicht mehr auf<br />
die Integration der Migranten. In Ostberlin gab es auch<br />
viele Angriffe durch Rechtsradikale, weswegen mich<br />
Leute davor gewarnt haben, in den Osten zu fahren. Die<br />
Migranten fühlten sich überrollt von der Wende. Das ist<br />
eine Haltung, mit der sich die Gemeinwesenarbeit auseinander<br />
setzen musste. Wir haben versucht, dieses Bild<br />
zu überwinden und geschaut, wo es im anderen Stadtteil<br />
schöne Sachen gibt, wie man Leute kennen lernen kann,<br />
denn Begegnungen sind sehr wichtig. Aber sie sind auch<br />
problematisch wegen der Hemmschwellen und Vorurteile.<br />
Unsere Erfahrung war, dass die Menschen oft mit inneren<br />
Bildern und nicht mit eigenen Erfahrungen arbeiten. Wir<br />
versuchten, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen.<br />
Eine andere relevante Entwicklung <strong>für</strong> die Gesellschaft<br />
war, dass die großen Wohlfahrtsverbände an Macht eingebüßt<br />
haben. Die großen Wohlfahrtsverbände haben<br />
zwar noch einen zentralen Stellenwert, aber durch die<br />
Zusammenführung der beiden Teile Deutschlands hatten<br />
sie im Osten nicht diese festen Strukturen wie im Westen.<br />
Das alles führte dazu, dass Stück <strong>für</strong> Stück die institutionelle<br />
Förderung <strong>für</strong> die großen Wohlfahrtsverbände …<br />
abgebaut wurde.<br />
Das werte ich nicht, das ist einfach eine historische Tatsache.<br />
Die Idee der Nachbarschaftshäuser brachte zu<br />
diesem Zeitpunkt eine Veränderung des <strong>sozial</strong>politischen<br />
Blickwinkels. Sie führte dazu, dass nicht mehr so sehr institutionelles<br />
Fachwissen die <strong>Arbeit</strong> bestimmte. Sondern<br />
man ging jetzt davon aus, dass es vor Ort unterschiedliche<br />
Bedürfnisse gibt, unterschiedliche Notwendigkeiten,<br />
schließlich können die Menschen vor Ort das am besten<br />
einschätzen, wie man vorgehen muss, um genau die<br />
erforderliche Struktur zu fi nden.<br />
Mit der Wende kamen <strong>für</strong> uns neue Möglichkeiten, um<br />
neue Projekte zu machen, neue Kooperationen einzugehen.<br />
Ein positives Beispiel war <strong>für</strong> uns damals ein <strong>für</strong> den<br />
11. September 2001 geplantes Treffen zwischen älteren<br />
Mitgliedern türkischer Gemeinden und älteren jüdischen<br />
Menschen. Die große Frage war, ob angesichts der Auswirkungen<br />
des 11. September in New York das Treffen klappen<br />
würde, aber es sollte trotzdem stattfi nden. Daraus<br />
wurde inzwischen eine lebendige Kooperation zwischen<br />
dem jüdischen Kulturverein und dem AWO Begegnungszentrum.<br />
Die älteren Menschen konnten teilweise schlecht<br />
Deutsch sprechen, aber wir werden weiterhin regelmäßig<br />
zu Treffen eingeladen und die älteren Türken gehen dorthin.<br />
Es fi nden nicht immer die großen Gespräche statt,<br />
aber man hat nach wie vor Interesse aneinander. Das ist<br />
ein Beispiel <strong>für</strong> die Erweiterung unserer Gemeinwesenarbeit,<br />
die auch dadurch möglich wurde, dass die Strukturen<br />
nach der Wende aufgebrochen wurden.<br />
Reinhilde Godulla: Hast du Erfahrungen mit Einrichtungen<br />
im Ostteil der Stadt? Oder Diskussionen geführt?<br />
Ihr wart ja ganz dicht an der Grenze.<br />
Ben Eberle: Wir haben mehrere Kooperationen mit einer<br />
großen Einrichtung in Pankow, aber da geht es nicht um<br />
die Grundsätze der Gemeinwesenarbeit, sondern immer<br />
um die Schnittstellen Integration, Begegnung, Leute<br />
kennen lernen, Bürgergesellschaft. Da fi nden wir immer<br />
wieder sehr gute Kooperationspartner, die Möglichkeiten<br />
sind unbegrenzt, das ist immer eine Frage der Bereitschaft<br />
und der Beteiligung von Bürgern.<br />
Peter Stawenow: Ich kann das aus eigenem Erleben nur<br />
bestätigen. 1991 und 1992 gab es eine Phase, in der die<br />
traditionellen Nachbarschaftseinrichtungen nachdenken<br />
mussten, wie diese neuen Entwicklungen genutzt werden<br />
könnten. Wir haben durch unsere Fragestellungen<br />
und unsere Neugier das Nachdenken über sich selbst<br />
mit angeregt.<br />
Ein Beispiel dazu: Ein türkisches Mädchen aus dem Wedding<br />
und ein deutscher Junge aus Mitte haben gemeinsam<br />
mit einer Nachhilfelehrerin, die 70 Jahre alt war,<br />
die deutsche Sprache und Rechnen geübt. Da hat man<br />
sehr schnell gemerkt, dass die Menschen alle dieselben<br />
Probleme haben, egal, ob aus Ost oder West, auch was<br />
<strong>Arbeit</strong>slosigkeit und andere Dinge betrifft. Wenn man sich<br />
begegnet und darüber spricht, kann man Vorurteile und<br />
die geistige Mauer in den Köpfen abbauen.<br />
Die Politik hat das damals noch gar nicht verstanden.<br />
Wenn Stadträte oder der Bürgermeister in unsere Einrichtung<br />
kamen, fragten sie, was wir eigentlich machen.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 121
122<br />
Workshop Gründungs-Impulse<br />
Da sagt man: hier ist Kinderarbeit, Jugendarbeit, das ist<br />
Seniorenarbeit, das ist Gesundheit und das Soziales.<br />
Da habe ich dem damaligen Sozialstadtrat, jetzt Bürgermeister<br />
von Mitte, gesagt: Sagen Sie mir doch, was<br />
das ist, wenn ein türkisches Mädchen und ein deutscher<br />
Junge mit einer älteren Frau Mathe-Nachhilfeunterricht<br />
machen? Ist das generationsübergreifende <strong>Arbeit</strong>? Ist<br />
das Ost-West-Integration? Ist das Ausländer-Integration?<br />
Ist das Gruppenarbeit? Ist das Einzelfallhilfe? Ist das<br />
Selbsthilfe? Ich habe einfach ein paar Fragen gestellt,<br />
um das Nachdenken über die Antworten anzuregen. Das<br />
waren gute Gespräche, die wir miteinander hatten. Das<br />
sind auch Dinge, die den Entwicklungsprozess auf beiden<br />
Seiten beeinfl usst haben.<br />
Durch diese gesellschaftlichen Veränderungen haben<br />
sich türkische Mitbürger aus Westberlin zurückgesetzt<br />
gefühlt, so nach dem Motto, jetzt kommen die Ostdeutschen<br />
als „Ausländer“ 1. Klasse, und das hat Empfi ndlichkeiten<br />
ausgelöst.<br />
TN: Was war denn das Selbstverständnis der neuen Initiativen,<br />
mit dem ihr angetreten seid? Und was war das<br />
Selbstverständnis der „alten Hasen“, auf die ihr damals<br />
getroffen seid? Wie hat sich das gegenseitig beeinfl usst?<br />
Welche Werte sind diskutiert worden? Und was ist seit<br />
damals passiert, das ist ja 20 Jahre her?<br />
Käthe Tresenreuter: Ich bin die Gründerin und Vorsitzende<br />
des Sozialwerks Berlin. Wir haben das damals alle<br />
erlebt. Herr Zinner war damals ja der Vorsitzende vom<br />
Paritätischen, ich war seine Stellvertreterin. Wir haben<br />
damals sehr gut zusammengearbeitet. Manchmal gab es<br />
verschiedene Meinungen, Herr Zinner war eben Hauptamtlicher,<br />
ich war ehrenamtlich. Ich habe selber die Fachgruppe<br />
Ältere Menschen gegründet, die heute 36 Jahre<br />
alt ist. Ich habe sofort da<strong>für</strong> plädiert, dass die Senioreneinrichtungen<br />
aus dem Osten in den Paritätischen aufgenommen<br />
werden. Das war nicht so ganz einfach, weil<br />
nicht alle da<strong>für</strong> waren.<br />
Sie haben auch gleich Seminare <strong>für</strong> den östlichen Teil<br />
der Stadt und die Umgebung eingeführt. Da waren sehr<br />
viele, die wir später begleitet haben. Wir haben einen<br />
<strong>Arbeit</strong>skreis Selbsthilfe/Ehrenamtlichkeit <strong>für</strong> die neuen<br />
Bundesländer aufgebaut. Wir haben uns ganz stark vom<br />
Paritätischen aus bemüht, die Gemeinschaft zwischen<br />
Ost und West herzustellen. Gerade auch <strong>für</strong> ältere Menschen<br />
gilt, dass sie nicht genügend in der Gesellschaft<br />
repräsentiert sind. Sie haben nicht den Stellenwert, den<br />
ich mir wünsche. Wir sind ganz stark auf Selbsthilfe und<br />
Ehrenamtlichkeit angewiesen.<br />
Wir hatten Seniorenfreizeitstätten vor 25 Jahren in Berlin<br />
aufgebaut, jetzt schlafen diese Freizeitstätten so langsam<br />
ein, ohne dass dies groß bekannt wurde. In einigen<br />
Bezirken gibt es noch welche, in einigen gibt es sie kaum<br />
oder gar nicht mehr. Das ist etwas, was wir Älteren sehr<br />
stark kritisieren. Ich habe inzwischen, nach 40 Jahren<br />
verantwortlicher ehrenamtlicher Tätigkeit, viele Kämpfe<br />
durchgestanden, wie z.B. auch den Kampf um unser<br />
Haus, wo<strong>für</strong> wir belächelt wurden, weil so was ja gar nicht<br />
mit voller Ehrenamtlichkeit funktionieren kann – und es<br />
funktioniert doch.<br />
Gisela Hübner: Der Titeltext dieser <strong>Arbeit</strong>sgruppe ist<br />
schön, „jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“. In einer<br />
anderen Runde sagte ich schon, ich denke, die Wendezeiten<br />
waren <strong>für</strong> die westlichen Leute noch mal eine neue<br />
Herausforderung. Wie funktionierten die neuen Einrichtungen?<br />
Beratung, Unterstützung und Kontakte gab es,<br />
ausgestattet waren sie zunächst mit ABM-Kräften und<br />
– bis auf einige wenige - überhaupt nicht abgesichert.<br />
Tatsächlich kam es darauf an, dass die Menschen<br />
Gemeinschaftseinrichtungen, die in DDR-Zeiten unter<br />
fragwürdigen Vorzeichen existiert haben, irgendwie in<br />
die neue Zeit hinein nehmen und mit neuen Inhalten und<br />
Werten ausstatten konnten. Und dann passierte es, dass<br />
sich dort sehr viele Menschen ehrenamtlich und freiwillig<br />
beteiligt haben.<br />
Die Debatte zwischen den Professionellen, also den<br />
Sozialpädagogen, Sozialarbeitern, Erziehern, darüber,<br />
was ehrenamtliche Einbindung in unsere <strong>Arbeit</strong> bringen<br />
konnte, war damals noch am Anfang. Das war aber<br />
ein Punkt, der lange Zeit heiß umstritten blieb. Ich höre<br />
immer noch Georg Zinner sagen, wenn die Mitarbeiter<br />
nicht dahinter stehen, wird es mit der ehrenamtlichen
<strong>Arbeit</strong> nichts. Die Mitarbeiter müssen davon überzeugt<br />
sein, dass das einen Wert hat, dass ihnen nichts weggenommen<br />
wird, dass das also eine Bereicherung ist.<br />
Dass an diesem Punkt bei uns langsam eine Bewegung<br />
in Gang kam, hatte wirklich was damit zu tun, dass man<br />
plötzlich merkte, wie erfolgreich das ehrenamtliche Element<br />
war und wie lebendig, was da neben uns entstand.<br />
Es war manchmal mühsam, seine MitarbeiterInnen und<br />
Kollegen dazu zu bringen, das auch zu sehen und da in<br />
neue Bewegung zu kommen. Diese Erweitung der <strong>Arbeit</strong>,<br />
die Übernahme von neuen Aufgaben, war ja auch in den<br />
westlichen Einrichtungen in dieser Zeit mit Lernen und<br />
neuem Denken verbunden. Auf einander zuzugehen war<br />
<strong>für</strong> mich immer leicht, weil ich das Unterschiedliche von<br />
Ansätzen auch respektieren und anerkennen konnte. Ich<br />
habe auch in diesem Sinne geworben <strong>für</strong> die <strong>Arbeit</strong>. Das<br />
hat bei uns sehr viel ausgemacht.<br />
Georg Zinner: Ich will noch einmal auf Frau Tresenreuter<br />
zurückkommen und auf dieses Selbstverständnis.<br />
Was Frau Tresenreuter geleistet hat, war, dass sie in<br />
einer Gruppe von Ehrenamtlichen mit ihrem unbändigen<br />
Willen da<strong>für</strong> gekämpft hat, dass man einen Treffpunkt<br />
schaffen kann, unabhängig von fi nanzieller Förderung,<br />
aus der Kraft der Ehrenamtlichkeit, aus der Idee heraus.<br />
Das haben wir im Wohlfahrtswesen der 80er Jahre ganz<br />
entschieden abgelehnt. Wir wollten eine ordentlich fi nanzierte<br />
Projektförderung vom Senat, wir fühlten uns sozusagen<br />
nur als eine Unterabteilung vom Senat und wollten<br />
die sichere Staatsknete haben. Eigentlich ist ja alle Sozialarbeit<br />
irgendwann mal in Bürger-Initiativen entstanden,<br />
so dass ich glaube, dass nicht wir die Treibenden sind,<br />
sondern die Initiativen kommen immer von den Bürgern,<br />
von den Ehrenamtlichen, da, wo was nicht stimmig ist, da<br />
melden sie sich zu Wort. Es ist unsere Aufgabe, das aufzugreifen<br />
und aufzunehmen, die Struktur bereitzustellen,<br />
damit sich das etablieren kann.<br />
Ich bin davon überzeugt, dass beides zusammen das<br />
Ideale ist, die professionelle Kompetenz in Verbindung mit<br />
dem bürgerschaftlichen Engagement macht uns eigentlich<br />
unschlagbar und etabliert uns fest. Die Ehrenamtlichen<br />
sind unsere besten Vertreter in der Öffentlichkeit,<br />
unsere Multiplikatoren gegenüber der Politik, die besten<br />
Fürsprecher. Aber darum geht es ja nicht nur, sondern<br />
um ihre gesellschaftliche Teilhabe, um die Erhaltung ihrer<br />
energiegeladenen Ansprüche an die Gesellschaft.<br />
Die Werte damals liefen teilweise darauf hinaus, dass<br />
wir ausreichend fi nanziert sein wollten, um normal arbeiten<br />
zu können und sichere Stellen zu haben – und das<br />
reichte uns eigentlich. Es gab einige wenige, die darüber<br />
hinaus gedacht haben. Erst später entstanden Initiativen<br />
zu einer Veränderung, das Geschäft fi nanziell unabhängig<br />
zu machen und zu etablieren.<br />
Diese Unabhängigkeit habe ich auch auf anderen Ebenen<br />
versucht <strong>für</strong> unsere Einrichtung zu schaffen, daran<br />
habe ich über Jahre gearbeitet und bin stolz darauf,<br />
dass wir das heute sind. Man könnte uns heute alle<br />
Zuwendungen streichen, das Nachbarschaftsheim<br />
würde weiter existieren. Diese Fähigkeit erwirbt man<br />
sich nur über eine breite Verankerung durch ehrenamtliches<br />
Engagement. Unabhängigkeit ist in meinen<br />
Augen <strong>für</strong> uns sehr wichtig, das ist ein sehr wichtiges<br />
Gut. Damit kann man Sachen initiieren und machen,<br />
die man sonst nicht machen könnte.<br />
Reinhilde Godulla: Frage an Evelyn: Ihr habt auch nach<br />
der Wende aufgebaut, wie war das? Wie habt ihr Ideen<br />
aufgegriffen und eigene Ideen eingebracht?<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 123
124<br />
Workshop Gründungs-Impulse<br />
Evelyn Ulrich: Wir hatten natürlich einerseits den Vorteil,<br />
dass unsere damalige Geschäftsführerin in der Gründungsphase<br />
sofort geguckt hat, was kann ich wo lernen.<br />
1991 hat sich der Verein gegründet, ab September haben<br />
wir die ersten Mitarbeiter eingestellt. Sie hatte ein Studium<br />
<strong>für</strong> Sozialmanagement angefangen und hat sich<br />
dadurch eine Menge an theoretischem Wissen angeeignet,<br />
was man auch braucht, um standfest zu sein. Das war<br />
auch die Phase, wo jeder davon geträumt hat, dass man<br />
wirklich alles, was an Möglichkeiten da ist, nutzen kann,<br />
sowohl aus dem Ostteil als auch aus dem Westteil. Also<br />
dass man Dinge, die man <strong>für</strong> würdig hielt, behalten kann,<br />
und Dinge, die man aus dem anderen Teil toll fand, dass<br />
man das irgendwie zusammenstecken kann. Das ist dann<br />
irgendwann doch ein Stück verloren gegangen. Was es<br />
Gutes auf der Ostseite gab, das wurde ja erst mal wirklich<br />
alles zerkloppt. Da muss ich den Leuten aus der DDR erst<br />
mal ein großes Kompliment machen, denn sich von einem<br />
Tag auf den anderen auf eine total neue Gesellschaft einzustellen,<br />
das will ja erst mal gemacht sein. Aber trotzdem<br />
war es ja so, dass man das Neue wollte.<br />
Eigentlich war in der DDR <strong>für</strong> mich gesellschaftliches<br />
Engagement eine Selbstverständlichkeit. Natürlich war<br />
das auch politisch geprägt, aber schon als Kinder in der<br />
Schule haben wir selber die Nachhilfe organisiert. Wir<br />
haben immer geguckt, ob der andere in der Schule mitkommt<br />
oder nicht. Das war auch dann in der Jugendorganisation<br />
so, dass man nicht nur den Blick auf die Kleinen<br />
hatte, sondern immer auch darüber hinaus, wie geht es<br />
dem anderen, wie kann man den mitnehmen. Zumindest<br />
in der <strong>sozial</strong>en <strong>Arbeit</strong> war das immer so, schon zu DDR-<br />
Zeiten. Aber das wurde eigentlich dann nach der Wende<br />
erst mal alles zurückgefahren.<br />
Wir haben uns glücklicherweise an dem Projekt <strong>für</strong> bürgerschaftliches<br />
Engagement, das Birgit Weber initiiert<br />
hat, beteiligt. Das war 1995, wo wir sehr viele Leute<br />
befragt haben, was sie von bürgerschaftlichem Engagement<br />
heute halten. Wir haben über 100 Leute befragt,<br />
die uns bestätigt haben, dass bürgerschaftliches Engagement<br />
in der DDR total normal war, obwohl sie es nicht als<br />
solches empfunden haben, sondern sie haben es einfach<br />
gemacht. Heute sehen sie es eher als schwierig an sich<br />
zu engagieren, weil sie nicht das Gefühl haben, dass ihr<br />
Engagement wirklich gesellschaftlich gewollt ist, weil es<br />
immer als Konkurrenz von anderen Institutionen empfunden<br />
wird. Wir haben aber glücklicherweise die Erfahrung<br />
gemacht, auch in unserem Verein, dass sich Leute von<br />
Anfang an gefunden haben, die diesen Verein mit begleitet<br />
haben, weil der sonst heute nicht mehr existent wäre.<br />
Es gab immer Menschen, die den Verein als Mitglieder<br />
unterstützen wollten, natürlich auch als ehrenamtliche<br />
Begleiter. Das ist ein spannendes Feld, wie man sich neu<br />
sortiert und auf eine völlig andere Art engagiert. Ehrenamt<br />
hat <strong>für</strong> mich inzwischen ein völlig anderes Gewicht<br />
bekommen.<br />
Reinhilde Godulla: Aber wie war das zu Beginn, gab es<br />
eine Neugierde zu schauen, wie die Nachbarschaftsheime<br />
im Westteil der Stadt sind? Habt ihr Kontakt aufgenommen?<br />
Seid ihr dort hingegangen?<br />
Evelyn Ulrich: Ja. Wir haben uns in der Wendezeit sehr<br />
viel angeguckt. Sehr schön war auch das Hospitationsprojekt,<br />
als ich 14 Tage im Nachbarschaftshaus in Bremen<br />
sein konnte und alle Facetten da miterlebt habe. Eigentlich<br />
wollte ich im Nachbarschaftshaus schlafen, aber die<br />
Wohnung wurde gerade renoviert. Dann hat ein Kollege<br />
gesagt: du kommst einfach mit zu mir. Dann haben wir im<br />
Ehebett geschlafen – deutsche Einheit bzw. Wiedervereinigung<br />
mal anders. Das hat noch mal deutlich gemacht,<br />
dass die Neugier aufeinander sehr groß war, dass das<br />
Lernen voneinander wirklich gewollt war. Man ist immer<br />
mit offenen Armen empfangen worden, alle haben mir<br />
erzählt, wie gut sie mit einander reden konnten, was die<br />
alles wussten, was wir auch wissen sollten. Und sie waren<br />
auch an unserer Geschichte interessiert: wo kommst du<br />
her, warum bist du gerade jetzt auf der Suche nach Nachbarschaftsarbeit?<br />
Diese Zeit habe ich sehr genossen,<br />
auch die Anregung und Inspiration <strong>für</strong> meine <strong>Arbeit</strong>.<br />
Gisela Hübner: Ist diese Offenheit, dieses Aufeinanderzugehen,<br />
Unterschiede zu würdigen, die Öffnung nach<br />
außen usw., wirklich ein besonderes Merkmal der Nachbarschaftsheime?
Evelyn Ulrich: Ich muss eindeutig sagen – ja, weil diese<br />
offenen Arme habe ich nicht überall in der Gesellschaft<br />
gefunden, aber dort in den Nachbarschaftseinrichtungen<br />
sehr wohl.<br />
TN: Als Kind war ich Mitglied im Club der internationalen<br />
Freundschaft, da haben wir selber Treffs mit ausländischen<br />
Kindern organisiert, ein bisschen Englisch gesprochen,<br />
also echt Kontakt gekriegt, das war ganz normal. In der<br />
Schule hast du dich engagiert, Schüler haben Nachhilfe<br />
gemacht. Während des Studiums war ich Übungsleiter <strong>für</strong><br />
Leichtathletik, es gehörte einfach dazu und man wollte<br />
es auch. Es hat mir keiner gesagt, du musst das machen,<br />
sondern man wollte nicht bloß studieren, sondern sich<br />
irgendwo am Leben beteiligen.<br />
Oder dann in der Hausgemeinschaft, ich wohnte in Berlin<br />
in einem Haus mit 36 Familien bzw. Mietparteien. Da<br />
haben wir gemeinsam die Grünanlagen gepfl egt, die eine<br />
hat Suppe gekocht, der nächste Salat gemacht, Kinderfest<br />
haben wir gefeiert, Weihnachten bzw. Nikolaus gab es<br />
Geschenke. Es gab eine Entsorgungsaktion <strong>für</strong> Altpapier,<br />
da<strong>für</strong> gab es auch Geld. Das waren ganz normale Aktivitäten<br />
und ein Teil des Normalen. Das wurde von vielen<br />
Menschen nach der Wende einfach weitergemacht. Was<br />
<strong>für</strong> mich leider eine Enttäuschung war, dass ein Teil der<br />
Menschen sich zunehmend aufgegeben hat, also auch<br />
Leute, die vorher sehr aktiv waren. Ich arbeite jetzt im<br />
Nachbarschaftsheim Bürger <strong>für</strong> Bürger in Mitte seit über<br />
sieben Jahren. Wir haben zunehmend auch Leute aus<br />
dem Wedding, die sich ehrenamtlich engagieren, aber es<br />
gab irgendwo bei einem Teil unserer Bürger einen Bruch,<br />
zum Teil auch altersbedingt, zum Teil aus Resignation.<br />
Man muss bei manchen Menschen erst mal das Interesse<br />
<strong>für</strong> ehrenamtliche <strong>Arbeit</strong> wieder wecken.<br />
Ich habe auch mal im Nachbarschaftshaus Am Berl in<br />
Hohenschönhausen gearbeitet, danach in Mitte. Die<br />
Bevölkerung ist überall anders, also es gibt unterschiedliche<br />
Bedingungen, es gibt verschiedene Anforderungen,<br />
bei den Besuchern gibt es Niveau-Unterschiede. In der<br />
Nachhilfearbeit ist es inzwischen so, dass wir in der<br />
Woche ca. 50 Schüler haben, damals waren es sechs bis<br />
acht. Mehr als diese 50 verkraften wir auch nicht. Inzwi-<br />
schen kommen 95 % der Schüler mit Migrationshintergrund.<br />
Insofern haben sich auch die <strong>Arbeit</strong>sbedingungen<br />
verändert.<br />
Reinhilde Godulla: Ich würde gerne noch mal auf die<br />
Neugierde aufeinander kommen, wie man voneinander<br />
gelernt hat, das Annehmen von Ehrenamtlichkeit.<br />
Hella Pergande: Wir haben nicht da weitergemacht, wo<br />
wir was hatten, sondern wir haben geguckt, was gibt es<br />
Gutes. Also diese Herzenswärme, Herzlichkeit, Offenheit,<br />
Wissbegierde, daraus wollten wir was machen.<br />
Aber mit Demokratie haben wir Ossis keine Erfahrung<br />
gehabt, wir hatten keine Demokratie, aber gerade deshalb<br />
und umso mehr eine genaue Vorstellung davon,.<br />
Das wollten wir einsetzen und es dann demokratisch<br />
machen. Wir waren keine ausgebildeten Sozialarbeiter,<br />
wir waren unter uns, die Ehrenamtlichen hatten<br />
den gleichen Stand wie wir, bloß dass wir eben immer<br />
ein bisschen Geld <strong>für</strong> unsere Tätigkeit gekriegt haben,<br />
aber es war eine Gleichwertigkeit. Ich glaube, das war<br />
gut an unserem Start. Wir haben zusammen gelernt,<br />
wir haben gemeinsam die anderen Einrichtungen angeschaut,<br />
Ehrenamtliche und Hauptamtliche. Wir wollten<br />
alle etwas wissen und lernen, das war einfach wunderbar.<br />
Man ist einfach losgezogen und hat sich viel erzählen<br />
lassen.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 125
126<br />
Workshop Gründungs-Impulse<br />
Aber man war natürlich auch misstrauisch, oh, Gott, ein<br />
<strong>Verband</strong> schon wieder, da hat man sich sein Leben lang<br />
um FDJ und so gedrückt, jetzt kommen die Verbände<br />
mit irgendwelchen Satzungen und Statuten. Was wir an<br />
Nachbarschaftshäusern gesehen haben, das hat uns<br />
gefallen: so leben wir, wir leben hier in der Nachbarschaft,<br />
mit Nachbarn, egal, wer sie sind, was sie sind, und wir<br />
machen mit denen was gemeinsam, das war wichtig.<br />
Aber in manchen Häusern waren wir auch total schockiert<br />
über die Üppigkeit der Ausstattung, die uns schon in der<br />
Eingangshalle entgegenschlug. Da dachten wir: so was<br />
erreichen wir nie.<br />
Gisela Hübner: Bei den Besuchen, die stattfanden, waren<br />
die Gespräche zwischen uns immer sehr gut. Aber einmal<br />
hörte ich im Anschluss eine Bemerkung in dieser Richtung:<br />
die schwimmen hier im Geld - und wir haben noch<br />
nicht mal Klopapier.<br />
Hella Pergande: Das fi nde ich interessant, wie war das<br />
denn <strong>für</strong> euch nachher, als das Geld geteilt werden<br />
musste? Wir kommen einmal zu Besuch und dann sollt<br />
ihr schon von eurem „Spielzeug“ abgeben. Ich kenne<br />
noch die Diskussionen, in denen man im Westen sagte:<br />
ach, jetzt sind wir auch noch die Putzfrau los. Ich fragte<br />
dann: Welche Putzfrau? Wir haben selber saubergemacht.<br />
TN: Ich war von Anfang an mit dabei, als die Nachbarschafts-<br />
und Begegnungsstätte Club Spittelkolonnaden<br />
gegründet worden ist. Ich war in einem ABM-Projekt,<br />
das damit anfi ng, sich erst mal zu informieren. Ich hatte<br />
keine Ahnung von Sozialarbeit, wir kamen alle berufl ich<br />
aus völlig unterschiedlichen Richtungen und waren da<br />
zusammengewürfelt, einem Verein angeschlossen, den<br />
es jetzt nicht mehr gibt. Wir haben in der Leipziger Straße<br />
in Mitte geguckt, weil da viele Leute von der Wende betroffen<br />
waren, im negativen Sinne. Also Wissenschaftler und<br />
Künstler, die Leute, die in den Ministerien gearbeitet<br />
haben, sie waren alle weg vom Fenster und ohne <strong>Arbeit</strong>.<br />
Unsere Aufgabe war, eine Möglichkeit zu fi nden, den Leuten<br />
dort irgendwo eine Heimstatt zu geben, damit sie<br />
sich erst mal treffen konnten, aber auch an ihre Bereitschaft<br />
anzuknüpfen, ein Ehrenamt zu übernehmen, um<br />
dort etwas entstehen zu lassen, was vielleicht auch <strong>für</strong><br />
die Bevölkerung im weiteren Sinne von Nutzen ist.<br />
Wir haben dort relativ schnell 29 Interessengemeinschaften<br />
ins Leben gerufen. Wir haben ihnen erst mal nur<br />
Räume zur Verfügung gestellt, was ja auch wichtig war.<br />
Direkt vor Ort gab es wenig Möglichkeiten, sich anders<br />
zu orientieren. Nach und nach ist dazugekommen, dass<br />
man eigene Möglichkeiten <strong>für</strong> sich erschlossen hat. Wir<br />
waren jetzt nicht der Verein, der sich eine Satzung gegeben<br />
und sich das auf die Fahne geschrieben hat, sondern<br />
wir haben einfach <strong>sozial</strong>es Engagement gemacht, mit den<br />
Bürgern, die dort gewohnt haben. Wir haben <strong>für</strong> ihre Interessen<br />
etwas geboten, sie zusammengeführt.<br />
Jetzt haben wir das Stadtteilaktiv gegründet, was eigentlich<br />
auf den Anfang zurückzuführen ist. Die, die sich damals<br />
aus dem Wohngebiet schon aktiv mit eingebracht haben,<br />
<strong>für</strong> andere eine Heimstatt zu sein, die sind zum Teil heute<br />
in diesem Stadtteilaktiv, das <strong>für</strong> die Oma von nebenan, <strong>für</strong><br />
den Opa auch da ist und ihre Probleme aufgreift. Mit der<br />
Zeit sammelt man Erfahrungen, indem man mit anderen<br />
ins Gespräch gekommen ist und viel Austausch hatte. Mit<br />
Elke haben wir viel gemacht, weil wir auch auf der Suche<br />
waren, wie man so etwas machen kann, auch wenn man<br />
keine <strong>sozial</strong>e Ausbildung hat.<br />
Ich habe zwar einen normalen Menschenverstand und<br />
Gefühl, ich kann danach auch urteilen, aber wichtig
war ja die Handhabung, wie man das macht, damit es<br />
auch effi zient ist. Ich denke, da haben wir schon einen<br />
ganz großen Schritt nach vorne getan. Seit 2000 ist das<br />
Sozialwerk des DFB unser Träger und gemeinsam haben<br />
wir dort sehr, sehr viel erreichen können. Also ich muss<br />
sagen, auf der Grundlage dessen, was bei uns vorhanden<br />
ist, also zwei Räume, und das dann zu verbinden mit den<br />
vielen unterschiedlichen Aktivitäten, die sich herausgebildet<br />
und den Wünschen nach Betätigung entsprochen<br />
haben, ob das die Sprachkurse <strong>für</strong> unsere Senioren sind,<br />
die ohne Ende genutzt werden, da könnte ich immer wieder<br />
noch anbauen, überhaupt kein Problem. Aber dass<br />
wir jetzt ganz kleine und junge Menschen zu uns haben<br />
ziehen können, ist eine Bereicherung, wo wir immer wieder<br />
neu zufassen. Also diese Foren jetzt hier sind <strong>für</strong> mich<br />
so ein Grund, wo ich vieles höre und überlege, was ich <strong>für</strong><br />
uns davon mitnehmen kann. Das fi nde ich ganz toll.<br />
TN: Ich möchte noch mal bekräftigen, wie toll unser<br />
Ansatz ist, also dass das, womit wir als Nachbarschaftshaus<br />
arbeiten, also unsere Werte, unsere Haltungen und<br />
unsere Methoden so etwas von zeitgemäß und fortschrittlich<br />
sind. Wir haben uns vor 20 Jahren als Bürger-Initiative<br />
gegründet, der Moabiter Ratschlag: Stadterneuerung,<br />
Bürgerbeteiligung, es ging um Gemeinwesenarbeit. Wir<br />
haben Mitte der 90er Jahre angefangen, eigene Projekte<br />
zu machen. Vorher waren wir ein Dachverband und<br />
haben dann angefangen zu gucken, welche Ressourcen<br />
und Potenziale es in Moabit gibt. Wir haben ganz viel<br />
entdeckt, wo man anknüpfen und etwas aufbauen kann,<br />
und zwar mit Menschen, die irgendwo aktiv sind. Daraus<br />
sind Projekte entstanden, aber auch Einrichtungen. Es<br />
haben Menschen aus unterschiedlichen Berufen mitgemacht,<br />
die aber das Engagement verbunden hat und der<br />
Wille, in Moabit etwas zu bewegen. Was wir dann noch<br />
brauchten, das waren eben <strong>sozial</strong>arbeiterische Methoden,<br />
die haben wir uns noch geholt und dann auch Einrichtungen<br />
gegründet.<br />
Ich bin der Meinung, dass die zum Teil sehr erfolgreich<br />
sind, weil wir nicht den rein <strong>sozial</strong>arbeiterischen Ansatz<br />
verfolgen, sondern das Ganze, wie man eben in der Nachbarschaftsarbeit<br />
so arbeitet. Die Verbindung dessen zu<br />
fi nden, das ist ein Wahnsinnserfolg. Und Sozialraumorientierung<br />
…, das machen wir längst, wir sind wirklich<br />
hier mit die Spitze der Bewegung, und das ist ein Ansatz,<br />
der sich bestätigt hat, denn die anderen kommen langsam<br />
nach und versuchen auch, sich in diese Richtung<br />
zu entwickeln.<br />
Reinhilde Godulla: Dann seid ihr praktisch auch aus der<br />
Nachwende?<br />
TN: Ja, ja, aber wir haben uns nicht so eingeordnet.<br />
Heute mit unseren 20 Jahren sind wir ein Baustein aus<br />
der anderen Richtung.<br />
TN: Ihr habt das einfach gemacht.<br />
TN: Ich möchte noch andere Generationen von Gründungs-Initiativen<br />
erwähnen. Ich habe in Berlin Nachbarschaftsarbeit<br />
in der Prinzenallee angefangen. Nach ein<br />
paar Jahren habe ich das Nachbarschaftshaus Prinzenallee<br />
geleitet. Das hatte seinen Ursprung in der Hausbesetzerbewegung,<br />
die gerade in Berlin auch <strong>für</strong> die Nachbarschaftshäuser<br />
eine wichtige Bewegung gewesen war.<br />
Durch die Hausbesetzerbewegung wurden viele Impulse<br />
gesetzt und in die Stadtteile getragen wie z.B. das Thema<br />
Demokratie – oder wie sollen wir uns im Stadtteil organisieren.<br />
Beim Nachbarschaftshaus Prinzenallee und<br />
bei der Fabrik Osloer Str., das sind die beiden aus der<br />
Zeit, die ich am besten kenne, war das zentrale Thema<br />
Basisdemokratie und in diesem Zusammenhang Räume,<br />
Strukturen und Personen zur Verfügung stellen, die die<br />
Leute im Stadtteil darin unterstützen, zu befähigen und zu<br />
ermuntern, sich selbst zu organisieren, <strong>für</strong> ihre Interessen<br />
zu streiten und einzutreten.<br />
Das lief damals nicht unter dem Schlagwort „bürgerschaftliches<br />
Engagement“, aber es ging auch hier darum,<br />
sich <strong>für</strong> den Stadtteil zu engagieren, was ja ein ganz klassisches<br />
bürgerschaftliches oder zivilgesellschaftliches<br />
Engagement ist. Ich leite jetzt das Nachbarschaftshaus<br />
Pfefferberg, eine klassische Gründungs-Initiative der<br />
Nachwendezeit. Ich hatte damals von der Prinzenallee<br />
aus schon viel mit dem Pfefferwerk zu tun, auch mit dem<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 127
128<br />
Workshop Gründungs-Impulse<br />
Nachbarschaftshaus. Ende der 90er Jahre haben wir eine<br />
ganz große Nähe genau an diesem Punkt Basisdemokratie<br />
wieder gefunden, Organisierung im Stadtteil, und ein<br />
politisches Selbstverständnis von Nachbarschaftsarbeit.<br />
Das ist <strong>für</strong> uns immer noch sehr wichtig und ein tragendes<br />
Element, dass wir an vielen Punkten sagen, wir wollen<br />
nicht einfach nur Ehrenamt fördern, sondern wir wollen<br />
das zivilgesellschaftliche Engagement fördern. Uns ist<br />
das nach wie vor eine zentrale Aufgabe, dass wir eine<br />
Infrastruktur sind, die wir zur Verfügung stellen, und in<br />
der wir Menschen dazu ermutigen und Ressourcen zur<br />
Verfügung stellen, dass sie <strong>für</strong> ihre eigenen Belange eintreten.<br />
Ich kann das längst nicht <strong>für</strong> alle in dieser Gründungs-Initiative<br />
zur Wendezeit sagen, <strong>für</strong> den Moabiter Ratschlag<br />
könnte ich es sagen, weil ich die auch noch ein bisschen<br />
näher kenne, <strong>für</strong> das Pfefferwerk kann ich das sagen, bei<br />
dir habe ich es rausgehört, das Schlagwort Demokratie,<br />
da habe ich mich schon gefreut, dass das mal endlich<br />
jemand sagt. Das war doch ein zentrales Thema und<br />
sollte es doch immer noch sein.<br />
Georg Zinner: Das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Es<br />
kommt darauf an, die Einrichtungen den Bürgern zurück<br />
zu geben. Die <strong>sozial</strong>e <strong>Arbeit</strong> fängt eigentlich immer ehrenamtlich,<br />
bürgerschaftlich, zivilgesellschaftlich an. Es gibt<br />
einen Mangel, daran entzündet sich Engagement. Dann<br />
wird es irgendwann institutionalisiert. Etwas anders war<br />
es nach dem zweiten Weltkrieg, als die Amerikaner die<br />
Initiative ergriffen, Nachbarschaftsheime zu gründen,<br />
weil sie den Deutschen die Demokratie bringen wollten.<br />
Allerdings haben sich die Nachbarschaftsheime<br />
damals erst einmal auf die Hilfe bei der dringendsten<br />
Not konzentriert. Die Leute brauchten etwas zu essen,<br />
sie brauchten Wärme und Kleidung. Aber später haben<br />
sie sich natürlich mit den anderen Fragen auch auseinandergesetzt.<br />
Zur Krise der Nachbarschaftsheime<br />
kam es, als sie nicht mehr ausreichend wahrgenommen<br />
haben, was um sie herum an demokratischen Bestrebungen<br />
entstanden ist. Überall in der Gesellschaft gärte<br />
es, Bürger-Initiativen schossen aus dem Boden. Die<br />
Neuorientierung ging dann im Kern darum, sich diesen<br />
Impulsen zu öffnen. Das ist weitgehend gelungen und<br />
wir konnten eine unserer Hauptstärken entwickeln, die<br />
darin besteht, dass Bürger, die sich engagieren, bei uns<br />
eine unterstützende Infrastruktur zur Verfügung gestellt<br />
bekommen und nach ihrer eigenen Facon selig werden<br />
können. Das Nachbarschaftsheim kann durchaus<br />
eigene Impulse setzen, aber den Bürgern wird nichts<br />
vorgeschrieben. Ich möchte noch etwas sagen zu der<br />
Kombination zwischen Ost und West und zwischen<br />
neuen und alten Einrichtungen, warum die funktioniert<br />
hat. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir uns als<br />
Nachbarschaftsheim immer auch beschränkt haben<br />
auf unseren Einzugsbereich. Deswegen waren wir keine<br />
Konkurrenten. Wir mussten keine Einrichtungen im Ostteil<br />
der Stadt und im Umland gründen. In dieser Frage<br />
gab es Differenzen innerhalb der Wohlfahrtsverbände.<br />
Der Paritätische, dessen Vorsitzender ich damals war,<br />
hat aber eine klare Haltung eingenommen. Wir wollten<br />
dem Osten nichts überstülpen, sondern ermuntern<br />
und befähigen. Für die Nachbarschaftshäuser war das<br />
auch ganz klar. Das wäre ja auch ein Widerspruch zu all<br />
unseren Grundideen gewesen und hätte niemals funktionieren<br />
können, wenn wir z.B. ein Nachbarschaftshaus<br />
in Köpenick gegründet hätten ... Von daher war es<br />
eigentlich relativ einfach und unkompliziert.<br />
Wir waren daran interessiert, dass neue Nachbarschaftseinrichtungen<br />
im Ostteil der Stadt entstanden, weil wir
davon überzeugt waren, dass wir dadurch an <strong>sozial</strong>politischer<br />
Bedeutung gewinnen würden. Das war nicht<br />
immer so gewesen, im <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
hatte es in den vorausgegangenen Jahren auch die Haltung<br />
gegeben, sich <strong>für</strong> neue Initiativen zu verschließen,<br />
weil man <strong>für</strong>chtete, die Fördertöpfe, die zu dieser Zeit<br />
unter sieben Einrichtungen aufgeteilt wurden, mit weiteren<br />
Häusern teilen zu müssen. Da hatte es bittere<br />
Debatten gegeben, aber als es zur Wende kam, hatten<br />
sich bei uns schon die Position durchgesetzt, dass wir<br />
von einer Öffnung nur gewinnen könnten. Wir hatten zu<br />
diesem Zeitpunkt schon eine ganze Reihe neuer Nachbarschaftsprojekte<br />
aus dem Westen in unseren <strong>Verband</strong><br />
aufgenommen.<br />
Reinhilde Godulla: War in dieser Hinsicht die Wende<br />
auch ein Gewinn <strong>für</strong> den <strong>Verband</strong>, <strong>für</strong> die Nachbarschaftsheime?<br />
Ben Eberle: Zwei Sachen fallen auf – <strong>für</strong> mich persönlich<br />
und <strong>für</strong> meine <strong>Arbeit</strong>. Bei den KollegInnen aus dem Osten<br />
war jetzt viel die Rede von einer sehr unaufgeregten, einer<br />
selbstverständlichen Art des bürgerschaftlichen und<br />
ehrenamtlichen Engagements: sie waren einfach aktiv, es<br />
gehörte eben dazu. So nehme ich das auch sehr stark bei<br />
den Migranten wahr. Die fühlen sich nicht angesprochen,<br />
wenn die Forderung erhoben wird, dass sie sich bürgerschaftlich<br />
engagieren oder ehrenamtliche <strong>Arbeit</strong> machen<br />
sollen. Sie tun es einfach – in Moscheen, in Sportvereinen,<br />
bei der Hilfe <strong>für</strong> ihre Nachbarn, das gehört selbstverständlich<br />
dazu. Es ist manchmal schade, dass das nicht<br />
mehr wahrgenommen wird.<br />
Meine Aufgabe bei der <strong>Arbeit</strong>erwohlfahrt ist die Integration,<br />
also nicht die Stadtteilarbeit an sich, sondern die<br />
Integration. Diese Stadtteilarbeit ist ja ein normales Instrument,<br />
um diesen Gedanken der zivilen Gesellschaft<br />
oder Bürgergesellschaft voranzubringen. Aber die Aufgaben<br />
einer Zivilgesellschaft verändern sich immer. Was<br />
sind die Instrumente, die wir momentan brauchen? Was<br />
sind die Herausforderungen einer Zivilgesellschaft? Wir<br />
müssen auch immer gucken, wie wir die Leute beteiligen,<br />
die keinen so leichten Zugang dazu haben.<br />
Ich glaube, das nimmt die Nachbarschaftsheimbewegung<br />
auch als Wert wahr, dass auch die weniger Bemittelten<br />
einen Zugang dazu haben müssen. Wie schafft man das,<br />
dass die auch die Kulturtechniken haben, die sie brauchen,<br />
um sich äußern und einbringen zu können und sich<br />
als aktiv Beteiligte an Demokratie und Zivilgesellschaft<br />
zu erfahren.<br />
Peter Stawenow: Es wurde gefragt, was sich bei uns verändert<br />
hat, was sich in den traditionellen Nachbarschaftseinrichtungen<br />
verändert, welche Veränderungen haben<br />
wir auch gemeinsam bestritten oder erreicht. Da wurden<br />
jetzt viele Beispiele gebracht.<br />
Wenn man das noch mal auf die Einrichtungen im Osten<br />
oder auf die Einrichtung, in der ich war „Bürger <strong>für</strong> Bürger“<br />
bezieht, dann ist die erste Erkenntnis, dass die Menschen<br />
selber wissen, was <strong>für</strong> sie gut ist. Das war <strong>für</strong> mich<br />
ein Umdenkungsprozess. Nicht, dass jemand anderes<br />
ihnen sagt, was gut oder notwendig ist, sondern die Menschen<br />
bestimmen selber, was sie <strong>für</strong> notwendig erachten,<br />
ob es Nachhilfe ist oder eine Bürger-Initiative, ob sie<br />
einen Malzirkel haben wollen oder was auch immer. Sie<br />
haben das Bedürfnis und wir bieten die Rahmenbedingungen<br />
dazu.<br />
Ein weiteres Umdenken war auch, dass man Territorialgrenzen<br />
ziehen muss, also einen Einzugsbereich <strong>für</strong> eine<br />
Einrichtung, weil man nicht überall sein kann. Dann sind<br />
inhaltliche Grenzen zu ziehen, das war <strong>für</strong> mich auch ein<br />
wichtiger Lernprozess. Georg hat auch gesagt, dass es<br />
Quatsch gewesen wäre, wenn das Nachbarschaftsheim<br />
Schöneberg in Wilmersdorf oder in Pankow versucht<br />
hätte, eine Einrichtung anzupfl anzen. Man muss inhaltliche<br />
Grenzen ziehen, wodurch die Angebote bei jeder Einrichtung<br />
anders aussehen, weil die Bevölkerung anders<br />
ist und sie anders mitwirkt. Die inhaltliche Begrenzung<br />
ist auch sinnvoll, weil man nicht alles machen kann,<br />
obwohl man vielleicht denkt, es wäre etwas notwendig<br />
oder wichtig. Auch die Erwartungshaltung der Bürger ist<br />
zu begrenzen und irgendwelche eigenen Ansprüche, weil<br />
man nicht die ganze Welt verändern kann. Und man muss<br />
auch persönliche Grenzen erkennen, weil man nicht sich<br />
und andere psychisch und physisch überlasten kann.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 129
130<br />
Workshop Gründungs-Impulse<br />
Ganz wichtig war auch, an dem Konzept und am Inhalt<br />
dranzubleiben und nicht bei der Jagd nach Finanzen,<br />
weil ja jede Menge Fördertöpfe aufgemacht worden sind,<br />
den Grundgedanken zu verraten, indem man sagt, jetzt<br />
mache ich mal das, weil es Fördergeld da<strong>für</strong> gibt.<br />
Was hat sich aus Ostsicht in den West-Einrichtungen<br />
verändert? Durch die Fragestellungen, durch die Entwicklung,<br />
die vorangegangen ist, war die Frage auch da,<br />
sich über Qualitätskriterien zu verständigen. Ich weiß<br />
noch, wie wir im <strong>Verband</strong> große Diskussionen geführt<br />
haben über Qualitätsentwicklung, „Offen <strong>für</strong> alle“, „Hilfe<br />
zur Selbsthilfe“, Verbindung von haupt- und ehrenamtlicher<br />
<strong>Arbeit</strong>, partnerschaftliches Zusammenarbeiten,<br />
generationsübergreifende <strong>Arbeit</strong> usw., das sind alles<br />
<strong>Arbeit</strong>sgrundlagen, die 1995, 1996 und 1997 in diesem<br />
gemeinsamen Entwicklungsprozess herausgearbeitet<br />
wurden.<br />
Aus diesen Bemühungen, die Grundidee nicht zu verraten,<br />
hat man dann überlegt, wie kann man sich fi nanziell<br />
unabhängiger machen, weil die Gefahr bestand, von der<br />
Georg Zinner vorhin gesprochen hat, dieser Drang nach<br />
der Sicherheit institutioneller Förderung oder reglmäßiger<br />
Förderung aus dem Staatshaushalt. Das kannten wir aus<br />
der DDR auch. Man hat vom Staat Geld bekommen, den<br />
Auftrag erfüllt und zum Jahresende das Ganze abgerechnet.<br />
Diese Gefahr bestand jetzt wieder. Auf der anderen<br />
Seite gibt es auch eine andere Gefahr. Wir haben wir ein<br />
eigenes Anliegen und selbst bestimmte Aufgaben. Aber<br />
uns herum wachsen die Aufgaben, die von anderen nicht<br />
mehr erledigt werden. Zwar ist es richtig, dass sich die<br />
Nachbarschaftseinrichtungen zu Stadtteilzentren weiterentwickeln<br />
– und dass sie Ehrenamt und bürgerschaftliches<br />
Engagement fördern, dass sie sich mit Rechtsextremismus<br />
auseinandersetzen, Jugendarbeit machen und<br />
vieles mehr. Dabei muss man aber aufpassen, dass man<br />
sich nicht unter Wert verkauft, weil das Bezirksamt oder<br />
der Senat sagt, ja wir sparen eine Jugendeinrichtung<br />
ein oder machen eine Seniorenfreizeitstätte zu. Da sparen<br />
wir Geld. Da sparen wir 5 Euro und da<strong>für</strong> erhält das<br />
Nachbarschaftszentrum 2 Euro mehr, damit es die <strong>Arbeit</strong><br />
mit macht. Auch auf diesem Weg der Finanzierungsmathematik<br />
kann man in Gefahr geraten, seine Grundidee<br />
aufzugeben.<br />
Diese Schlussbemerkung ist von meiner Seite auch<br />
nicht polemisch gemeint: Dadurch, dass wir uns überall<br />
umschauen konnten, hatten wir einen unglaublichen<br />
Vorteil. Wir brauchten Fehler oder Fehlentwicklungen, die<br />
Einrichtungen im Westteil oder die länger existierenden<br />
Einrichtungen gemacht haben, nicht zu wiederholen und<br />
konnten diese vermeiden. Das hat auch dazu geführt,<br />
dass wir bestimmte Entwicklungsprozesse schneller<br />
gemacht haben.<br />
Reinhilde Godulla: Sabrina, wie nimmst du das wahr,<br />
diese „alten Hasen“ im Westteil der Stadt und die frischen<br />
Initiativen im Ostteil der Stadt, du kommst ja aus Baden-<br />
Württemberg.<br />
Sabrina Blum: Ich komme aus Biberach, zwischen Ulm<br />
und Ravensburg, also ganz aus dem Süden. Für mich<br />
sind das hier alles „alte Hasen“, weil unser Haus erst<br />
2000 gegründet wurde. Ich weiß nicht, ob es eines gibt,<br />
was noch später gegründet wurde, aber wenn ich diese<br />
Geschichte anhöre, dann sind das hier <strong>für</strong> mich alles „alte<br />
Hasen“.<br />
Reinhilde Godulla: Ich glaube, das Haus am Lietzensee<br />
in Berlin wurde nach 2000 gegründet.
Sabrina Blum: Ich habe jetzt diese Diskussion verfolgt<br />
und auch schon gestern versucht, mich in die Situation<br />
in Berlin rein zu versetzen, weil ich auch noch sehr jung<br />
bin, also ich war 6 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist.<br />
Ich habe eigentlich davon gar nichts mitbekommen, auch<br />
weil ich weit vom Schuss gewesen bin und im Süden nicht<br />
mitbekommen habe, wie das hier in der Hauptstadt zugegangen<br />
ist.<br />
Aber ich habe den Eindruck, dass Westberlin und Ostberlin<br />
sehr stark von der Situation profi tiert haben, dass<br />
eben im Osten bürgerschaftliches Engagement sehr stark<br />
betrieben worden ist. Ich denke, dass der Westen davon<br />
einfach stark profi tiert hat und dadurch sehr viele Ehrenamtliche<br />
gewinnen konnte.<br />
Wir haben dagegen eine komplett andere Situation, denn<br />
<strong>für</strong> uns ist es wahnsinnig schwer, Ehrenamtliche zu fi nden.<br />
Dieses Selbstverständnis ist bei uns einfach nicht<br />
vorhanden. Die Leute gehen zur <strong>Arbeit</strong>, sind froh, wenn<br />
sie zu Hause sind und nichts mehr machen müssen. Die<br />
Senioren, zumindest bei uns im Haus, sind mittlerweile<br />
zu alt geworden und können nichts mehr machen, weil<br />
es zu anstrengend ist. Unser Haus ist ja auf Initiative von<br />
Senioren gegründet worden, das waren neun oder zehn<br />
Jahre Kampf. Es ist schließlich gebaut worden, aber inzwischen<br />
sind sie wirklich zu alt, um aktiv noch etwas zu<br />
bewerkstelligen.<br />
Sie kommen immer noch zum Handarbeitstreff oder zum<br />
Begegnungscafe, aber das war’s dann auch schon, also<br />
die Situation ist eine völlige andere und ich kann leider<br />
nichts auf mich übertragen.<br />
TN: Mal sehen, vielleicht doch.<br />
Gisela Hübner: Sie sollten Frau Tresenreuter erst mal<br />
gleich einladen!<br />
Käthe Tresenreuter: Mich hat sehr beeindruckt, dass es<br />
doch viele Bürger-Initiativen und auch bürgerschaftliches<br />
Engagement in Ihren Reihen gegeben hat. Offi ziell wurde<br />
ja das bürgerschaftliche Engagement erst vor fünf Jahren<br />
von den staatlichen Stellen „entdeckt“. Darüber habe ich<br />
mich immer ein bisschen geärgert. Ich meine, wir, die wir<br />
Jahre lang bzw. über Jahrzehnte Erfahrungen haben, wir<br />
wurden ja überhaupt nicht in diese neuen Aktionen bürgerschaftliches<br />
Engagement mit einbezogen. Wenn ich<br />
an die Eröffnung denke, da saßen neun Personen, davon<br />
waren sieben Professoren, also von der Praxis war da nix<br />
zu sehen.<br />
Ich fi nde das so gut, dass wir hier auch gespürt haben,<br />
wie schwer es doch <strong>für</strong> einige war, und dass wirklich viel in<br />
der ehemaligen DDR vorhanden war. Ich bin ein bisschen<br />
unbedarft hier zur Tagung gekommen. Da Herr Stawenow<br />
jetzt bei uns aktiv ist, wir planen ein neues Modell, <strong>für</strong> das<br />
er zuständig ist, bin ich sehr dankbar, dass mir klar geworden<br />
ist, dass Sie es bei dem Anfang nach der Wiedervereinigung<br />
teilweise sehr schwer hatten. Wir hatten eine ganz<br />
andere Basis hier und versuchten, wirklich die Türen zu<br />
öffnen und den Kontakt ganz bewusst herzustellen. Ich<br />
gebe zu, nur in der <strong>Arbeit</strong> <strong>für</strong> ältere Menschen.<br />
Und eins darf ich noch sagen: Bitte sehen Sie nicht nur<br />
die Ehrenamtlichkeit, sehen Sie auch die Selbsthilfe als<br />
Zukunft. Das ist genauso wichtig, da kann man mit Selbsthilfe<br />
noch mehr Menschen motivieren als teilweise mit<br />
Ehrenamtlichkeit.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 131
Input:<br />
Workshop<br />
Berufs-Bilder<br />
Ausbildung begegnet Praxis<br />
Prof. Dr. Stephan Wagner Paritätische Bundesakademie<br />
Sarah Steiner Outreach (Karow)<br />
Moderation: Herbert Scherer<br />
Herbert Scherer: Wir besprechen heute ein wichtiges<br />
Thema. Unser Gast ist Prof. Dr. Stephan Wagner, der<br />
seit gestern neues Vorstandsmitglied unseres <strong>Verband</strong>es<br />
ist.<br />
Stephan Wagner: Ich bin Sozialarbeiter von Beruf, den<br />
habe ich in den 70 er Jahren an einer FH gelernt, das<br />
ist die Ausbildung, die ich sozusagen mit dem Herzen<br />
gemacht habe. Ich habe dann in den 80er Jahren an der<br />
FU Soziologie studiert, weil es damals in der Sozialarbeit<br />
keine Aufstiegsmöglichkeiten in Richtung Kombination<br />
von Praxis und Wissenschaft gab, das ging nur über<br />
die Referenzwissenschaften. Das ist heute anders, da<br />
sind wir ein Stück weiter. Ich bin also Soziologe und bin<br />
in diesem Fach Professor geworden. Als Professor an<br />
Fachhochschulen machte ich die Erfahrung, dass sich<br />
deutsche Fachhochschulen in einem rasanten Tempo<br />
von der Praxis entfernen. Man nimmt nur noch die Wissenschaft<br />
wahr.<br />
TN: Ist die Wissenschaft schneller oder langsamer als die<br />
Praxis?<br />
Stephan Wagner: Das hat schon Hegel gesagt: die Eule<br />
der Weisheit beginnt ihren Flug am Ende des Tages. Wissenschaft<br />
kann immer nur erkennen, was geschehen ist.<br />
Der Versuch, zu antizipieren, was in der Zukunft ist, funktioniert<br />
nur selten.<br />
Herbert Scherer: Stephan Wagner war Professor in Jena,<br />
ist Geschäftsführer der Paritätischen Akademie. Er hat<br />
gleichzeitig in einem Kooperationsprojekt mit der staatlichen<br />
Fachhochschule <strong>für</strong> Sozialarbeit in Berlin, der<br />
Alice-Salomon-Hochschule, einen Master-Studiengang<br />
berufsbegleitend aufgebaut und dabei ein naturgemäß<br />
ein neues Verhältnis zwischen Theorie und Praxis hergestellt.<br />
Wir sind eine überschaubare Gruppe, deswegen schlage<br />
ich vor, dass wir eine kleine Vorstellungsrunde machen,<br />
um festzustellen, was jeden mit dem Thema des Workshops<br />
verbindet.<br />
TN: Ich habe Stadtplanung studiert und bin über die<br />
Jugendarbeit zur Gemeinwesenarbeit und Stadtteilarbeit<br />
gekommen, mein nebenberufl iches Steckenpferd ist Sozialraumorientierung.<br />
Ich arbeite in einem Projekt mit, das<br />
deren Grundsätze in den Bezirken vermittelt.<br />
Sabine Weskott: SOS-Familienzentrum Berlin/Stadtteilzentrum<br />
Hellersdorf-Nord. Beim Umzug der Alice-Salomon-Hochschule<br />
von Schöneberg nach Hellersdorf gab<br />
es viele Vorbehalte gegen das neue Umfeld. Gemeinwesenarbeit<br />
ist an der ASH leider kein Schwerpunkt,<br />
es hängt eher an einzelnen Personen, was in diesem<br />
Bereich angeboten wird. Mittlerweile öffnet sich die<br />
Hochschule immer mehr <strong>für</strong> die <strong>Arbeit</strong> im Stadtteil. Wir<br />
haben gemessen an der kurzen Entfernung vergleichsweise<br />
wenige Praktikanten von dort, aber es sind mehr<br />
geworden. Ich bin Sozialarbeiterin und bin relativ früh<br />
in die Stadtteilarbeit reingerutscht.
Herbert Scherer: Ich habe Germanistik studiert und bin<br />
nach meinem Studium in die praktische Jugendarbeit eingestiegen,<br />
weil ich plante, an einer Fachhochschule zu<br />
unterrichten. Da<strong>für</strong> brauchte man neben einem theoretischen<br />
wissenschaftlichen Hintergrund auch praktische<br />
Erfahrung. Das Leben ist dann etwas anders gelaufen.<br />
Ich wurde Geschäftsführer eines Jugendverbandes und<br />
bin darüber vor 20 Jahren in die <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
gekommen. Da bin ich dann Geschäftsführer geworden.<br />
Zwischendurch hatte ich an der Alice-Salomon-Hochschule<br />
in Schöneberg <strong>für</strong> zwei Jahre Lehraufträge und von daher<br />
Einblick in die Ausbildung dort. In den nächsten Wochen<br />
beginne ich einen Lehrauftrag an der Katholischen Hochschule.<br />
Insofern bin ich jetzt sehr neugierig auf das Spannungsverhältnis<br />
zwischen Theorie und Praxis. Und auch<br />
darauf, wieder neue Studentengenerationen kennen zu<br />
lernen.<br />
Margret Staal: Ich komme von der Bundesvereinigung<br />
sozio-<strong>kulturelle</strong>r Zentren. Ich habe in den 70er Jahren<br />
einen der ersten Diplom-Pädagogik-Studiengänge absolviert<br />
mit der Aussicht, damit keinen <strong>Arbeit</strong>splatz zu bekommen,<br />
außer an der Hochschule. Wir waren zwar hoch qualifi<br />
ziert, hatten aber von Praxis keine Ahnung und <strong>für</strong> diese<br />
Berufsfelder wollte man uns nicht einstellen. Ich habe mir<br />
einen anderen Weg gesucht, ich habe dann als Sozialarbeiterin<br />
hier in Berlin in einer Kindertagesstätte gearbeitet.<br />
Dann bin ich aufs Land gegangen und habe dort<br />
ein sozio-<strong>kulturelle</strong>s Zentrum mit aufgebaut, habe also in<br />
der praktischen <strong>Arbeit</strong> all das gelernt, was man braucht,<br />
um so eine Geschäftsführung und die inhaltliche <strong>Arbeit</strong><br />
eines sozio-<strong>kulturelle</strong>n Zentrums zu betreiben. Ich habe<br />
den Landesverband mit aufgebaut, bin da im Vorstand,<br />
jetzt bin ich auch viel auf Bundesebene unterwegs.<br />
Mich interessiert das Thema besonders, weil wir, die<br />
kulturpolitische Gesellschaft und die Bundesvereinigung<br />
sozio-<strong>kulturelle</strong>r Zentren, gerade auf Bundesebene<br />
Befragungen und eine Untersuchung gemacht haben: zur<br />
Wirkungsweise von Sozio-Kultur. Wie unterscheidet sich<br />
Sozio-Kultur von <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n Zentren? Wo überlappen<br />
sich die Bereiche? Wo gibt es Berührungspunkte oder<br />
Gemeinsamkeiten? Der Blickwinkel bezog sich auch auf<br />
die Studiengänge in den Hochschulen. Was muss in den<br />
Studiengängen in den Hochschulen geändert werden?<br />
Kulturwissenschaft, Management, es gibt ja viele verschiedene<br />
Titel mit gleichem Inhalt oder gleiche Titel mit<br />
ähnlichen oder unterschiedlichen Inhalten, es ist ja viel<br />
passiert in dem Bereich. Was muss die Ausbildung dort<br />
beinhalten, um tatsächlich vorzubereiten <strong>für</strong> die Mitarbeit<br />
oder die Geschäftsführung in einer solchen Einrichtung?<br />
Dieter Oelschlägel: Ich habe eine andere Geschichte, die<br />
parallel läuft, also Gemeinwesenarbeit und Ausbildung.<br />
Ich war bis 2004 Hochschullehrer in Duisburg, habe in<br />
Berlin studiert, da war ich der dritte Diplom-Pädagogik-<br />
Student, den es in Deutschland gab. Dann habe ich im<br />
Nachbarschaftsheim Heerstraße-Nord gearbeitet, bin<br />
dann von Berlin nach Kassel, danach an die Universität<br />
in Duisburg. Vorwiegend habe ich auch an der Universität<br />
Kassel Projektstudien gemacht, sehr stark mit dem<br />
Versuch, die Theorie mit der Praxis zu verbinden. Ich bin<br />
heute u.a. ehrenamtlich in einem Quartiersmanagement<br />
tätig.<br />
Sarah Steiner: Ich arbeite seit Juli bei Outreach in Karow<br />
und bin Berufsanfängerin. Ich habe in Holland Sozialpädagogik<br />
studiert. Ursprünglich komme ich aus Krefeld, das<br />
ist am Niederrhein, also relativ nah an der holländischen<br />
Grenze. Ich soll über mein Studium berichten, das war an<br />
der Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Nijmegen.<br />
Herbert Scherer: Sarah Steiner ist Impulsgeberin, weil wir<br />
hören wollen, was gerade aktuell in Holland läuft.<br />
Selda Karacay: Ich bin seit dem 1. Oktober beim Pfefferwerk<br />
Stadtkultur angestellt. Ich habe Sozialpädagogik<br />
studiert, auch in Holland, in Enschede. Ursprünglich<br />
komme ich aus Nordrhein-Westfalen. Damals habe ich in<br />
Rheine gewohnt, das liegt in der Nähe von Enschede. In<br />
Holland wird sehr praxisnah ausgebildet, also ich habe<br />
berufsbegleitend studiert, nebenbei arbeitete ich in einer<br />
Grundschule. es gibt dort einen Studiengang <strong>für</strong> Studierende<br />
aus Deutschland, der auf Deutsch läuft. Wir mussten<br />
viel aus der Theorie mit der Praxis verknüpfen.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 133
134<br />
Workshop Berufs-Bilder<br />
TN: Ich arbeite jetzt in der Stadtentwicklung und habe in<br />
Frankfurt Soziologie und Erwachsenenbildung studiert.<br />
Sarah Steiner: Mein Studienfach heißt übersetzt „Kulturelle<br />
Sozialpädagogik“. Das Studium hat einen sehr<br />
hohen Praxisanteil, die Schwerpunkte liegen bei der<br />
aktivierenden <strong>Arbeit</strong> mit Gruppen und im Projektmanagement.<br />
Im ersten Jahr ist ein 3-monatiges Praktikum von 24-<br />
Wochenstunden vorgesehen, im zweiten Jahr ein 8-monatiges<br />
Praktikum von 8-Wochen-Stunden, das dritte Jahr<br />
fi ndet komplett als Voll-Praktikum von 10 Monaten statt.<br />
Das Bachelor-Studium dauert insgesamt vier Jahre, der<br />
Abschluss wird in Deutschland als äquivalent zum Diplom<br />
Sozialpädagogik FH anerkannt. Das ist vielleicht interessant,<br />
dass ein holländischer Bachelor in Deutschland<br />
einem Diplom entspricht.<br />
Herbert Scherer: Das ist gleichgestellt?<br />
Sarah Steiner: Genau. Ich habe einen Bachelor of Social<br />
Work. Man kriegt aber zu diesem Bachelor eine Unterlage,<br />
die besagt, dass er in allen Bereichen gleichgestellt ist mit<br />
dem Diplom Sozialpädagogik FH. Das wird in Kooperation<br />
mit einem deutschen Institut in Köln, das internationale<br />
Vergleiche von Studiengängen und Studienabschlüssen<br />
anstellt, defi niert.<br />
Herbert Scherer: Ist das bei Ihnen auch so?<br />
Selda Karacay: Ja, also Bachelor, das war 2005 nicht<br />
so ganz klar. Ich hatte als Diplom-Sozialpädagogin zum<br />
Beispiel in Berlin das Problem, dass ich eine staatliche<br />
Anerkennung meines in Holland gemachten Bachelor<br />
beantragen musste. Das brauchte ich aber in Nordrhein-<br />
Westfalen nicht, weil sie da die Schule in Holland sehr gut<br />
kennen. Jedenfalls musste ich hier zur Senatsverwaltung<br />
und die Anerkennung beantragen, was ich überhaupt<br />
nicht verstanden habe. Und ich musste nachweisen, dass<br />
sich der Unterricht über das Rechtswesen, z.B. zur Sozialgesetzgebung,<br />
auf deutsche Gesetze bezog.<br />
Herbert Scherer: Die staatliche Anerkennung hat es dann<br />
gegeben?<br />
Selda Karacay: Ja, ja, auf jeden Fall.<br />
Sarah Steiner: Einer der Schwerpunkte war das <strong>sozial</strong>pädagogische<br />
kreative <strong>Arbeit</strong>en: Es wurden Fächer<br />
angeboten wie Sport, Tanz und Bewegung, Drama, künstlerische<br />
Gestaltung, audiovisuelle Medien und Musik.<br />
In diesen Fächern wird man darin ausgebildet, sie mit<br />
Gruppen anzuwenden und das als Mittel der <strong>sozial</strong>pädagogischen<br />
<strong>Arbeit</strong> zu benutzen. In der ersten Zeit lernt<br />
man diese Fächer erst mal kennen. Im zweiten Jahr entscheidet<br />
man sich <strong>für</strong> zwei Fächer, im vierten Jahr hat<br />
man dann nur noch das Hauptfach. Man wird spezialisiert,<br />
aber man wird nicht als Dozent oder Tanzlehrer oder<br />
ähnlich ausgebildet, sondern wirklich um diese Fächer als<br />
Mittel anzuwenden.<br />
Der holländische Leitsatz bei diesem Studium heißt: Mit<br />
Kopf, Herz und Hand <strong>für</strong> Menschen arbeiten, auf diese<br />
Verbindungen legen die Holländer besonders großen<br />
Wert. Der andere Schwerpunkt ist das leitende Projektmanagement,<br />
dass man Organisation und Finanzierung<br />
von Projekten lernt, was von Anfang an in Teamarbeit<br />
erarbeitet wird. Teamarbeit ist auch das Thema Nummer<br />
1 während des Studiums, in jedem Jahr muss man sich<br />
mit acht verschiedenen Gruppen auseinandersetzen.<br />
Wobei ich sagen muss, dass ich dabei sehr viel gelernt<br />
habe, also die Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen<br />
Menschen, jedes Mal eine neue Rolle in einer neuen<br />
Gruppe zu fi nden.<br />
Ich würde sagen, das Studium ist zweigeteilt, nämlich<br />
einerseits diese anleitende und begleitende Funktion in<br />
den Fächern, andererseits das Projektmanagement und<br />
die organisatorische Seite. Das Studium ist eher im sozio<strong>kulturelle</strong>n<br />
Sektor angesiedelt, was bedeutet, man schaut<br />
in die Sektoren Kunst und Kultur, Tourismus, Sport, sozio<strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> und Bildungsarbeit in der Erwachsenenbildung<br />
hinein. An diese Sektoren wird man herangeführt,<br />
dann entscheidet man sich im zweiten Jahr <strong>für</strong> einen Sektor,<br />
bei mir war das Kunst und Kultur, was dann wiederum<br />
eher zu Bildungsarbeit führt.
Die Stärken des holländischen Studiums sehe ich vor<br />
allem in dem Refl ektieren und Analysieren der eigenen<br />
persönlichen Struktur und des persönlichen Werdegangs.<br />
Teilweise hat es fast schon therapeutische Aspekte, weil<br />
man gezwungen wird, immer wieder auf seine eigenen<br />
Kompetenzen zu schauen, die zu refl ektieren und eine<br />
persönliche Zielsetzung nach jedem Block zu defi nieren.<br />
Das holländische Jahr ist in vier Blöcke eingeteilt. Nach<br />
jedem Block schaut man zurück: was habe ich erreicht,<br />
was habe ich nicht erreicht? Die Ziele werden dann in das<br />
weitere Studium mitgenommen.<br />
Stephan Wagner: Das ist ausgesprochen praktisch orientiert.<br />
Sarah Steiner: Genau. Man wird in einem Fach angeleitet,<br />
was ungefähr übersetzt „persönliche Weiterentwicklung“<br />
heißt. Da werden die jeweiligen Ziele besprochen, es wird<br />
auch refl ektiert: wie ist es in dem konkreten Fall, bist du<br />
sicher, dass du die Kompetenz erreicht hast, usw. Es wird<br />
ganz genau geschaut und auch an ganz kleinen Zielen<br />
gearbeitet. Viele Sachen werden anhand der praktischen<br />
<strong>Arbeit</strong> erklärt, die dann in der Theorie noch refl ektiert werden.<br />
Es gibt eine klare Struktur, der Unterricht ist sehr<br />
verschult und fi ndet in kleinen Gruppen statt. Diese klare<br />
Struktur nimmt man dann auch ins spätere <strong>Arbeit</strong>sleben<br />
mit, zum Beispiel, dass man bei jeder Sitzung, die man<br />
hat, wechselnd einen Protokollschreiber und einen Sitzungsleiter<br />
benennt. Insofern lernt jeder, eine Sitzung zu<br />
leiten. Ich merke jetzt, dass so etwas einen großen Wert<br />
hat.<br />
Im Nachhinein beurteile ich eine gewisse Oberfl ächlichkeit<br />
als schlecht. Es hat mir in Holland die inhaltliche<br />
Vertiefung von praktischen Zielen gefehlt. Es wird vieles<br />
nur angerissen, was teilweise durch die praktische<br />
Erfahrung ausgeglichen werden kann. Aber es liegt<br />
eben an einem selber, ob man bei interessanten Themen<br />
noch eigene Recherchen anstellt, um ein Thema<br />
gut zu erfassen.<br />
TN: Können Sie noch etwas zur Abschlussarbeit sagen?<br />
Sarah Steiner: Ganz unterschiedlich, man macht viele<br />
Prüfungen – also einmal die praktischen <strong>Arbeit</strong>en in der<br />
Gruppe, die bewertet werden. Man macht Projektarbeiten,<br />
das sind einerseits fachliche Themen. Die werden an<br />
fi ktiven oder auch realen Projekten erarbeitet, die man<br />
organisiert und initiiert, und die dann auch bewertet werden.<br />
Und auf der anderen Seite ganz normale, theoretische<br />
Klausuren und auch die ganz normale mündliche<br />
Prüfung.<br />
Die Abschlussarbeiten sind auch sehr unterschiedlich,<br />
sie werden auch in Gruppen gemacht. Das sind reale,<br />
praktische Fragestellungen, die von Organisationen an<br />
die Hochschule herangetragen werden und die in der Projektgruppe<br />
gelöst werden sollen. Ich habe zum Beispiel<br />
mit meiner Gruppe <strong>für</strong> eine Organisation <strong>für</strong> internationale<br />
Zusammenarbeit ein Thema in Richtung Organisa-<br />
tionsentwicklung bearbeitet, und zwar deren Corporate<br />
Identity analysiert und dazu ein Empfehlungsschreiben<br />
entwickelt und auch ein praktisches Teambuilding entwikkelt<br />
und mit ihnen durchgeführt.<br />
Stephan Wagner: Wird das auch schriftlich niedergelegt?<br />
Sarah Steiner: Ja, das wird schriftlich beschrieben. Auf<br />
der einen Seite steht die ganze Entwicklung dieses Prozesses,<br />
mit der qualitativen Auseinandersetzung, also der<br />
qualitativen Untersuchung, mit unserer Empfehlung, plus<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 135
136<br />
Workshop Berufs-Bilder<br />
die praktische Durchführung des Teambuilding, was dann<br />
auch als Implementierungsansatz <strong>für</strong> die Organisation<br />
gelten sollte.<br />
Herbert Scherer: Das war jetzt schon ein Hinweis. Wurde<br />
das in holländischer Sprache geschrieben?<br />
Sarah Steiner: Ja, ich habe auf Holländisch studiert.<br />
Herbert Scherer: Sie sagten, Sie hätten einen deutschsprachigen<br />
Studiengang besucht.<br />
Selda Karacay: Mein Studium in Holland verlief anders,<br />
sehr praxisorientiert. Es gab auch viel Theorie, aber die<br />
musste man in die Praxis umsetzen. Wir haben auch sehr<br />
viel in Gruppen gearbeitet, wo wir uns mit unseren unterschiedlichen<br />
Meinungen auseinandersetzen mussten. Es<br />
gab immer eine Moderation und einen Protokollführer,<br />
immer abwechselnd. Nach jedem Modul gab es Prüfungsbogen<br />
mit Multiple Choice. Wir wurden immer überprüft.<br />
Das alles fand ja berufsbegleitend statt.<br />
Herbert Scherer: War es inhaltlich das gleiche Studium?<br />
Selda Karacay: Nein, das unterscheidet sich. Zum Beispiel<br />
Gesprächsführung hat oft stattgefunden, auch theoretisch.<br />
Ich fand immer sehr interessant, dass wir viel mit<br />
Rollenspielen gearbeitet haben, auch das Fach Drama<br />
hatten wir über drei Monate. Aber wir mussten immer<br />
dazu <strong>Arbeit</strong>en schreiben, entweder in der Gruppe oder<br />
einzeln.<br />
Die Abschlussprüfung beinhaltete, dass man eine Diplomarbeit<br />
zu viert oder fünft geschrieben hat, aber je mehr<br />
Leute, desto umfangreicher und umso mehr Seiten<br />
musste die <strong>Arbeit</strong> haben. Ich habe meine Diplomarbeit<br />
alleine geschrieben. In die Diplomarbeit fl ießt alles das<br />
ein, was man in den vier Jahren an theoretischem Wissen<br />
beigebracht bekommen hat.<br />
Stephan Wagner: Es gibt aber nicht wie in Nijmegen eine<br />
Praxisaufgabe, die man lösen muss?<br />
Selda Karacay: Nein, solche Aufgaben hatten wir bereits<br />
die ganzen vier Jahre.<br />
Stephan Wagner: Ich habe mit den Leuten in Enschede<br />
gesprochen. Wenn ich die richtig verstanden habe, ist es<br />
bei ihnen im berufsbegleitenden Studium so, dass sie<br />
während des Studiums auch ganz eng mit den <strong>Arbeit</strong>sstellen<br />
zusammenarbeiten. War das bei Ihnen auch so?<br />
Selda Karacay: Um berufsbegleitend in Enschede zu<br />
studieren, muss man im <strong>sozial</strong>en Bereich ein Praktikum<br />
machen oder angestellt sein. Ich war in einer Grundschule<br />
angestellt, die in einem <strong>sozial</strong>en Brennpunkt lag. Das muss<br />
im <strong>sozial</strong>en Bereich stattfi nden, damit man die Theorie<br />
von der Schule in die Praxis umsetzen kann. Ich fand das<br />
manchmal sehr schnell, wenn man ein Thema hatte, das<br />
man schriftlich und praktisch umsetzen musste. Danach<br />
gab es immer noch mal eine Refl ektion. Es gab auch Studenten,<br />
die nicht refl ektieren wollten. Wir hatten einen<br />
Studenten aus Münster, der hatte schon in Deutschland<br />
studiert und konnte sich praktisch nicht in unser Studiensystem<br />
integrieren. Der musste ausscheiden, weil die<br />
Holländer viel Wert auf die Refl ektion legen.<br />
Herbert Scherer: Was waren Ihre Motive, zum Studium<br />
nach Holland zu gehen?<br />
Sarah Steiner: Bei mir war das Motiv ganz einfach. Ich<br />
bin mit einer Freundin zufällig an die Hochschule gegangen,<br />
weil die einen Tag der offenen Tür hatte. Zu dem<br />
Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, was ich berufl ich<br />
machen wollte. Ich war künstlerisch sehr engagiert und<br />
wollte gerne in dem Bereich etwas machen. Mir gefi el es<br />
dort gut und ich hatte keine bessere Idee, was ich machen<br />
wollte, also habe ich mich da<strong>für</strong> entschieden. Das hat sich<br />
aber dann <strong>für</strong> mich auch als richtig erwiesen, also ich war<br />
da von Anfang an sehr zufrieden und es hat mir gefallen.<br />
Diese Entscheidung hatte aber keinen tieferen Sinn.<br />
Selda Karacay: Ich hatte mit einem Hauptschulabschluss<br />
meine erste Ausbildung als Kinderpfl egerin gemacht. Dann<br />
habe ich lange in Kitas usw. gearbeitet. Irgendwann hörte
ich sehr viel Gutes über die Hogeschool von Enschede,<br />
dass man dort sehr praxisorientiert arbeitet. Aber ich hatte<br />
kein Abitur. Dann habe ich, was in Deutschland nicht möglich<br />
ist, dort eine Aufnahmeprüfung machen müssen.<br />
Stephan Wagner: Die Zugänge sind offener.<br />
Selda Karacay: Ja. Ich wollte noch was draufsetzen, weil<br />
mir das nicht reichte, was ich bis dahin gemacht hatte.<br />
Deshalb habe ich dann in Holland studiert. Erst plante<br />
ich, dass ich noch mein Abitur mache, hatte mich auch<br />
bei den Abendschulen angemeldet, aber dann hätte ich<br />
noch acht Jahre zusätzlich gebraucht. So dachte ich, dass<br />
ich es in Holland probiere, weil ich nichts verlieren kann,<br />
entweder ich bestehe oder nicht. Ich hatte ja sowieso meinen<br />
unbefristeten Vertrag an der Grundschule. Aber ich<br />
bestand die Aufnahmeprüfung.<br />
TN: In welche Richtung ging diese Prüfung?<br />
Selda Karacay: Es wurden extra Bücher vorgegeben, zum<br />
Beispiel von Hermann Hesse, die mussten wir analysieren,<br />
Inhaltsangaben machen, auch was wir daraus erkennen<br />
usw., also zu Deutsch. Die Prüfung ging sechs bis acht<br />
Stunden, ich weiß es nicht mehr, in den verschiedenen<br />
Fächern, in Politik wurde auch ein Buch vorgegeben.<br />
TN: Die Bücher wurden vorher benannt und man konnte<br />
sich darauf vorbereiten?<br />
Selda Karacay: Genau, ja. Es gab noch ein anderes<br />
Fach, wo man auch analysieren musste, also es wurde<br />
überprüft, ob man analysieren kann, ob man Zusammenhänge<br />
erkennt<br />
Herbert Scherer: Gab es in dem Studiengang viele<br />
Quereinsteiger?<br />
Selda Karacay: Ja, in meiner Klasse waren z.B. alle<br />
berufstätig, viele in der Jugendhilfe, eine hat in einer Kita<br />
gearbeitet, sie hatte eher Schwierigkeiten, wir kamen aus<br />
verschiedenen Bereichen.<br />
Stephan Wagner: Und Sie hatten Ihren <strong>Arbeit</strong>splatz in<br />
Deutschland?<br />
Selda Karacay: Ja. Von uns wurde verlangt, dass wir sehr<br />
viel selbstständig arbeiten, die Selbstständigkeit war das<br />
A und O. Ganz wichtig war die Gruppenarbeit und das fl exible<br />
Denken, das Kooperative.<br />
TN: Wie war das zeitlich strukturiert?<br />
Selda Karacay: Einmal in der Woche waren wir Studenten<br />
dort. Und <strong>für</strong> jede Woche bekamen wir immer Aufgaben<br />
<strong>für</strong> zuhause mit, also es war schon ein bisschen stressig.<br />
Aber meine <strong>Arbeit</strong> mit den Kindern gestaltete sich<br />
dadurch sehr interessant. Wir hatten auch ein ganzes<br />
Jahr Supervision, was ich vorher in Deutschland nicht<br />
kannte, im Team zum Beispiel, oder <strong>für</strong> die Bearbeitung<br />
von Themen.<br />
Stephan Wagner: Was haben Sie beide <strong>für</strong> das Studium<br />
bezahlt?<br />
Selda Karacay: Das wurde immer teurer. Im ersten Studienjahr<br />
habe ich ungefähr 800 Euro bezahlt, im zweiten<br />
Jahr waren es um die 1.000 Euro, das ging dann bis<br />
1.250 Euro.<br />
Stephan Wagner: Also insgesamt ungefähr 4.000 Euro.<br />
Selda Karacay: Ja, in den vier Jahren.<br />
Sarah Steiner: Bei mir waren es jährlich 1.500 Euro,<br />
wobei man als deutsche Studentin beantragen konnte,<br />
dass man 2/3 wieder zurückbekommt, weil das zu Zeiten<br />
war, als es in Deutschland noch keine Studiengebühren<br />
gab. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber dadurch war es<br />
so geregelt, dass die Holländer die ausländischen Studenten<br />
gefördert haben. Ich glaube, das war von der<br />
Europäischen Union so geregelt, dass alle Europäer, die<br />
in Holland studierten, diese Rückerstattung beantragen<br />
konnten. Das heißt, ich habe unter dem Strich 500 Euro<br />
im Jahr bezahlt. Diese Möglichkeit ist jetzt weggefallen.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 137
138<br />
Workshop Berufs-Bilder<br />
Stephan Wagner: Es gibt inzwischen im deutschen<br />
Grenzbereich zu Enschede Landkreise, die Verträge mit<br />
der Hogeschool Enschede haben und die die komplette<br />
Ausbildung ihres Personals in Holland machen, weil sie<br />
in Deutschland mit den Fachhochschulen nicht zufrieden<br />
sind, denn es wird das bevorzugt, was die Hogeschools<br />
an Praxisbezug liefern. Da ist eine Entwicklung im Grenzbereich<br />
spürbar, wo die Holländer, obwohl sie teurer sind,<br />
den deutschen Schulen Konkurrenz machen.<br />
TN: Haben Sie vorher schon Holländisch gekonnt?<br />
Sarah Steiner: Nein, ich musste das lernen. Ich bin zwar<br />
grenznah aufgewachsen, aber ich hatte nie Bezüge nach<br />
Holland. Es gibt eine Firma, die praktisch die Monopolstellung<br />
hat zum Erlernen des Holländischen. Dort muss man<br />
einen Test absolvieren, woraufhin man eingestuft wird,<br />
ob man zwei, vier oder sechs Wochen Holländisch lernen<br />
muss. Bei mir waren es sechs Wochen, ich konnte kein<br />
Wort. Ich fand auch Holländisch nie einfach. Viele sagen,<br />
die Sprache erinnert an das Deutsche, aber <strong>für</strong> mich war<br />
das völlig Chinesisch. Bei dem Test habe ich überall a)<br />
angekreuzt, weil ich nichts verstanden habe. Dann absolviert<br />
man eben diesen 6-Wochen-Kurs, was bedeutete,<br />
dass ich fünf Tage in der Woche von 8 bis 16 Uhr Unterricht<br />
hatte. Am Ende hat man fünf verschiedene Prüfungen,<br />
schriftlich, mündlich, man wird im Hören geprüft,<br />
also es wird eine Kassette abgespielt und dazu muss man<br />
Fragen beantworten.<br />
Herbert Scherer: Haben Sie während des Studiums in<br />
Holland gewohnt?<br />
Sarah Steiner: Ich habe erst in einem Dorf auf deutscher<br />
Seite gewohnt, weil ich damals in Nijmegen nichts<br />
gefunden habe. Es ist dort teuer und ganz schwierig, da<br />
überhaupt ein Zimmer zu bekommen, weil die eine große<br />
Wohnungsnot haben. Das dritte Jahr habe ich in Berlin<br />
verbracht, mein praktisches Jahr, im vierten Jahr habe ich<br />
dann in Holland gewohnt, da hatte ich ein Zimmer.<br />
Ich hatte also diese Sprachschule absolviert, danach<br />
hatte ich Grundkenntnisse, aber es war doch schwierig,<br />
dem Unterricht zu folgen. Das hat vor allem das erste<br />
Jahr sehr anstrengend gemacht, also vom ersten Block<br />
habe ich inhaltlich wenig verstanden. Das musste ich<br />
dann durch Nachlesen nacharbeiten, weil es natürlich<br />
schriftlich etwas einfacher ist, wenn man die Unterlagen<br />
vor sich hat. Dann kommt man auch relativ schnell in die<br />
Sprache rein.<br />
TN: Waren viele deutsche Studenten da?<br />
Sarah Steiner: Ja. Viele deutsche Studenten gehen auch<br />
deshalb nach Holland, weil es dort an der Hogeschool keinen<br />
Numerus Clausus gibt. Das Studium der Sozialpädagogik<br />
wurde damals auch schon in Teilzeit angeboten,<br />
wir hatten noch Vollzeit. Das Studium, was ich gemacht<br />
habe, also die „Kulturelle Sozialpädagogik“, wird mittlerweile<br />
auch in Teilzeit auf Deutsch angeboten. Das war<br />
damals noch nicht so. Ich fand es auch sehr spannend,<br />
über diesen Weg noch eine andere Sprache zu lernen,<br />
insofern hat mich das nicht abgeschreckt. Ich dachte mir,<br />
so schwierig kann es nicht sein. Dann fand ich die Sprache<br />
zwar nicht so einfach wie ich dachte, aber es hat ja<br />
irgendwie gepasst.<br />
Selda Karacay: Meine Ausbildung war zwar in Teilzeit,<br />
aber ich kann von mir sagen, dass es sich zwar Teilzeit<br />
nennt, aber es ist absolut nicht Teilzeit, weil da wirklich<br />
viel gemacht werden muss. Man arbeitet ja die ganze<br />
Woche. Am Anfang fi el mir dieses ganze Refl ektieren<br />
sehr schwer, das war anfangs schon eine Umgewöhnung.<br />
Das hat auch eine <strong>kulturelle</strong> Komponente, weil wir nicht<br />
so gerne refl ektieren. Aber irgendwann bist du dann an<br />
dem Punkt, wo du automatisch refl ektierst, auf der <strong>Arbeit</strong><br />
denkst du mit, dann kommen diese ganzen Berichte, die<br />
du schreiben musst, das war alles <strong>Arbeit</strong> und Studium in<br />
einem.<br />
Sarah Steiner: Bei uns war es so, dass sich die deutschen<br />
Studenten am Anfang sehr darüber lustig gemacht<br />
haben, ja, wir refl ektieren, wir schreiben wieder eine<br />
Refl ektion. Im Nachhinein merkt man erst, dass es <strong>für</strong><br />
die <strong>Arbeit</strong> schon viel gebracht hat, und dass es doch <strong>für</strong>
den persönlichen Werdegang etwas ganz Wertvolles war.<br />
Zu dem Zeitpunkt war mir das nicht so bewusst, da war<br />
das eher lästige Zusatzarbeit, dass man im Job arbeitete<br />
und hinterher auch noch alles refl ektieren muss.<br />
Was ich bei den Gruppenarbeiten auch extrem fand, man<br />
musste sich am Ende gegenseitig bewerten, was sehr heftig<br />
war. Da wurde knallhart gesagt, du kriegst fünf Punkte,<br />
weil du einen Fehler gemacht hast, ich gebe mir selber<br />
zehn. Oder auch dass ein Holländer sagte: ich sehe meine<br />
<strong>Arbeit</strong> in dem Block nicht als 100 %ig an, ich gebe mir nur<br />
sechs Punkte.<br />
TN: Waren die holländischen Studenten das eher<br />
gewohnt? Ist Selbstrefl exion und Selbstbewertung dort<br />
eher ein Thema?<br />
Sarah Steiner: Das Gefühl hatte ich schon, dass die das<br />
schon gewöhnt waren, mehr als wir hier, das war da schon<br />
in der Schule so.<br />
Selda Karacay: Also es gibt immer Feedback-Runden da,<br />
auch dieses gegenseitige Loben oder wir mussten auch<br />
viel Selbstkritik üben, das fand ich sehr fremd.<br />
Sarah Steiner: Man lernt, wie man ein Feedback gibt.<br />
Herbert Scherer: Das hat mit einer Kultur zu tun, die in<br />
diesem Land und unter den Leuten gepfl egt wird. Ist es<br />
denn so, dass man in Deutschland einen refl ektierenden<br />
Mitarbeiter gar nicht haben will, sondern der soll gehorchen<br />
und das machen, was die Geschäftsführung sagt?<br />
Was <strong>für</strong> einen Hintergrund hat es, dass die Ausbildung in<br />
Deutschland anders ist?<br />
Stephan Wagner: Der Hintergrund ist wohl, dass wir<br />
eine andere Geschichte haben in der Entwicklung der<br />
Ausbildung der <strong>sozial</strong>en <strong>Arbeit</strong>, die sich wenig auf die<br />
Praxis bezogen hat. Wir hatten Anfang der 70er Jahre<br />
den Übergang von den Höheren Fachschulen zu den<br />
Fachhochschulen. Das ist in den ersten Jahren ganz gut<br />
gegangen. Dann hatten wir, das war eine Katastrophe<br />
in meinen Augen <strong>für</strong> die Ausbildung, in den frühen 70er<br />
Jahren auf einmal massenweise gut ausgebildete Wissenschaftler,<br />
Theoretiker, die aber an den Universitäten<br />
keine Chance hatten, Karriere zu machen. Dann sind die<br />
über Umwege gegangen, ich habe das selber erlebt. Als<br />
Berufungsvoraussetzung an den Fachhochschulen ist die<br />
Habilitierung weggefallen, stattdessen wurden fünf Jahre<br />
Praxis verlangt, dann wurden also Praktika, Mitgliedschaft<br />
in Jugendverbänden, usw., das wurde auf einmal<br />
alles gerechnet, obwohl das überhaupt nichts damit zu<br />
tun hatte.<br />
Wir haben dann einen massiven Einfl uss von theoretischen<br />
Wissenschaftlern in den Fachhochschulen<br />
gehabt. Das bedeutete, dass wir ganz stark in Richtung<br />
Theorie gegangen sind, wir sind weggegangen von der<br />
Praxis. In der Regel haben wir in den Fachhochschulen,<br />
wenn es hochkommt, bei 30 bis 60 Professoren nur fünf<br />
oder sechs Leute, die mal einen Klienten als Sozialarbeiter<br />
gesehen haben.<br />
Das ist auch ein widersprüchlicher Prozess. Wir haben<br />
jetzt auf der einen Seite den Vorteil, dass die Fachhochschulen<br />
in Deutschland Masterstudiengänge machen,<br />
dass wir eine Öffnung Richtung Promotion kriegen. Das<br />
hat aber die Ausrichtung in Richtung Theorie gefördert,<br />
was der Nachteil daran ist. Wir haben eine Sache nie<br />
diskutiert, die alle kennen. Wenn man mit Kollegen aus<br />
der Praxis spricht, ist denen in der Regel allen der Praxisschock<br />
bekannt. Die Leute, die wir am Ende der Aus-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 139
140<br />
Workshop Berufs-Bilder<br />
bildung in die Praxis entlassen, sind geschockt von dem,<br />
worauf sie stoßen. Das kann nur der Fall sein, wenn Theorie<br />
und Praxis auseinander fallen. Wir sind also einen völlig<br />
anderen Weg als die Holländer gegangen. Heute haben<br />
wir dadurch eine Situation, dass wir sehr praxisfern und<br />
sehr theoretisch ausbilden.<br />
Selda Karacay: Ich habe ja ein Diplom ausgehändigt<br />
bekommen, auf dem steht, dass ich Diplom-Sozialpädagogin<br />
bin. Dann habe ich auch noch mal ein interna-<br />
tionales Diplom bekommen, wo ich auch international<br />
zum Beispiel meinen Master noch draufsetzen kann und<br />
berechtigt bin, auch außerhalb von Deutschland zu studieren.<br />
In Holland gibt es keine Noten mehr. Im ersten Studienjahr<br />
haben wir noch Noten bekommen, 10 war ein<br />
sehr gut plus. Irgendwann wurde das in der Hogeschool<br />
abgeschafft, zwischendurch kommt das auch mal wieder<br />
vor, aber am Ende heißt es immer bestanden oder nicht<br />
bestanden.<br />
Sarah Steiner: Bei mir war das nicht so. Bei uns gab es<br />
immer Noten von 1 bis 10, bis 5,5 war alles bestanden,<br />
darunter fi el man durch.<br />
Selda Karacay: Genau, bei 5,5 war das so. Aber das<br />
wurde mit dem zweiten Jahr anders gemacht, bestanden<br />
oder nicht bestanden. Wir konnten damit erst mal nicht<br />
so richtig umgehen, weil wir eine Note wollten. Wir wollten,<br />
dass da 8, 9 oder 10 steht, weil wir aus Deutschland<br />
kommen. Deutsche sind daran gewöhnt, dass sie Noten<br />
wollen – natürlich gute Noten. Aber bei den Holländern ist<br />
das eben anders. Sie gucken nicht auf Noten, sondern <strong>für</strong><br />
sie zählt bestanden oder nicht bestanden.<br />
TN: Ich habe den Eindruck, dass deutsche Studenten in<br />
den letzten Jahren verstärkt nach Holland zum Studium<br />
gehen.<br />
Selda Karacay: Die Ausbildung an der Hogeschool gibt es<br />
schon seit über zehn Jahren.<br />
TN: Aber vor 20 Jahren war es nicht so attraktiv, vor 10<br />
Jahren auch noch nicht, jedenfalls kannte ich zu der Zeit<br />
noch niemanden, der in Holland studiert hat.<br />
TN: Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass hier der<br />
Andrang auf die Hochschulen immer weiter zugenommen<br />
hat und der Numerus Clausus verschärft wurde. Da fragt<br />
man sich: wozu muss man theoretisch so viel draufhaben,<br />
damit man praktisch mit Menschen arbeiten kann? Das<br />
wird ja in den Studiengängen auch weiter entsprechend<br />
fortgesetzt, weil unglaublich viel Theorie vermittelt wird,<br />
von der man dann nicht weiß, wie man sie in der Praxis<br />
anwenden soll.<br />
Herbert Scherer: Dieter Oelschlägel, siehst du diese<br />
Etappen, von denen Stephan Wagner gesprochen hat,<br />
auch so?<br />
Dieter Oelschlägel: Ich sehe sie an manchen Stellen<br />
vielleicht noch schärfer. Dazu kommt noch die Konkurrenz<br />
zwischen den universitären Ausbildungen und den<br />
Fachhochschulausbildungen, was dazu geführt hat, dass<br />
die Fachhochschulen immer mehr universitäre Interessen<br />
vertreten haben. Ich habe es oft erlebt, dass die Fachhochschul-Kollegen<br />
viel wissenschaftlicher geredet haben<br />
als die universitären Kollegen. Die Kluft zwischen Theorie<br />
und Praxis ist aber nicht das Problem, sondern dass die
Theorie, die gelehrt wird, nicht zu der Praxis passt. Das<br />
sind abgehobene Theorien, ohne Bezug zur Praxis.<br />
Theorie braucht man. Zu einer richtigen Praxis gehört<br />
eine gute Theorie, aber das muss gemeinsam wirken. Bei<br />
uns wurden Theorie und Praxis ohne jeden Bezug zueinander<br />
unterrichtet.<br />
Stephan Wagner: Ich habe das in der eigenen Ausbildung<br />
auch so erlebt. Es hat viele kleine Bausteine gegeben,<br />
die die Ausbildung bei uns in Richtung Theorie verändert<br />
haben. Holland hat den Schwerpunkt der Ausbildung in<br />
Richtung Praxis verlagert.<br />
TN: Es wurde gesagt, dass bei uns etwa 10 % der Lehrkräfte<br />
Klienten gesehen haben. Wie ist in Holland die Einbindung<br />
der Lehrkräfte ins Praxisfeld?<br />
Sarah Steiner: Wir hatten keine Professoren, sondern<br />
Dozenten. Die meisten Dozenten waren noch praxisnah<br />
eingebunden, also viele – vielleicht 60 % - hatten einen<br />
Job in der <strong>sozial</strong>en <strong>Arbeit</strong> und haben zusätzlich unterrichtet.<br />
Es gab natürlich auch welche, die nur Dozenten<br />
waren, aber die hatten meistens auch in ihrer Karriere<br />
schon in der Praxis gearbeitet. Darauf wird sehr viel Wert<br />
gelegt.<br />
TN: Ich erlebe Praktikanten in verschiedenen Einrichtungen<br />
vor Ort, und erlebe Betreuer von Jugendlichen,<br />
denen Selbstrefl exion in der Regel völlig unbekannt ist.<br />
Bei Praktikanten, die aus den Studiengängen kommen,<br />
erlebe ich, dass sie unglaublich viel Wissen angesammelt<br />
haben, aber in der Praxis völlig hilfl os sind, auch in<br />
der <strong>Arbeit</strong> mit Gruppen. Nicht zu 100 %, es gibt welche,<br />
die Erfahrungen mit Gruppenarbeit haben, wo sie eingebunden<br />
waren und die schon von daher was mitbringen.<br />
Aber was sie von der Hochschule mitnehmen, das ist<br />
relativ wenig. Das Schlimme ist, dass die Ausbildung an<br />
der Hochschule so völlig losgelöst ist von der praktischen<br />
Sozialarbeit. Diese Art von Wissen im Kopf verschwindet<br />
einfach irgendwann wieder.<br />
Du sagst, dir fehlt manchmal theoretisches Wissen bei<br />
Sozialarbeitern. Ich denke, wenn man in der Praxis darauf<br />
gestoßen wird, dann liest man das nach, dann sucht man<br />
sich die Punkte, durch die man den theoretischen Hintergrund<br />
kriegen kann, weil man in der Praxis einfach einen<br />
anderen Bezug dazu bekommt.<br />
Herbert Scherer: Wir haben jetzt die Situation in Deutschland<br />
und Holland ein bisschen verglichen. Wie ist es in<br />
anderen Ländern?<br />
Stephan Wagner: Die Amerikaner bilden eher theoretisch<br />
aus. Sie haben Praxisphasen, da besteht aber eine<br />
andere Verknüpfung. Ich habe dort den Bereich ehrenamtlicher<br />
<strong>Arbeit</strong> erforscht. Wenn wir uns amerikanische<br />
Projekte ansahen, haben wir uns über die hohe Anzahl<br />
an gut ausgebildeten Ehrenamtlichen mit Hochschulausbildung<br />
gewundert. Das erklärt sich dadurch, dass<br />
in Amerika auch obligatorische Praktika von Studenten<br />
als ehrenamtliche <strong>Arbeit</strong> gelten. In Amerika gibt es eine<br />
andere Verortung von Ausbildungsinhalten im gesamten<br />
System des Berufsfeldes.<br />
Die Engländer und Holländer haben viel stärkere Praxisanteile<br />
in ihrer Ausbildung. Wenn man in Deutschland z.B.<br />
mit einem Migrationshintergrund das Schulsystem durchlaufen<br />
hat, dabei aber nur einen geringen Schulabschluss<br />
erreicht hat, dauert es sehr lange, bis man das Abitur<br />
erreicht und dann erst zum Studium zugelassen wird. In<br />
England und Holland dagegen sagt man: wir gucken uns<br />
die Leute an, schauen, ob sie über Lebenserfahrungen<br />
oder andere Qualifi kationen einen Stand erreicht haben,<br />
von dem aus sie fähig sind zu studieren, dann lassen wir<br />
sie zu.<br />
Herbert Scherer: Das habe ich auch auf der Ebene der<br />
Erzieherausbildung mitgekriegt, weil diese berufsbegleitende<br />
Erzieherausbildung eben auch so ein Einstieg<br />
war, über die Menschen mit praktischer Erfahrung die<br />
ansonsten höheren Einstiegshürden überwinden konnten.<br />
Eines Tages war damit Schluss und das Sozialpädagogische<br />
Institut, das diese berufsbegleitende Erzieherausbildung<br />
angeboten hat, konnte in der Regel ohne<br />
Abitur nicht mehr zulassen, weil das vom Senat so vorgeschrieben<br />
wurde.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 141
142<br />
Workshop Berufs-Bilder<br />
Stephan Wagner: Ich habe im Fachausschuss der LIGA<br />
<strong>für</strong> Fort- und Weiterbildung hier in Berlin gesessen und<br />
die Debatte von der Seite verfolgt. Das ist sehr widersprüchlich.<br />
Es gibt eine generelle Diskussion, auch unter<br />
den tätigen Sozialarbeitern und Sozialpädagogen, die in<br />
die Richtung geht, dass die Ausbildung besser werden<br />
muss.<br />
Nun passiert etwas Merkwürdiges. Es wird gesagt, dass<br />
die Ausbildung besser werden muss, dann meint man, die<br />
Berufsbezeichnung müsse auf Hochschulniveau gebracht<br />
werden, dann würde die Ausbildung besser. Es gibt also<br />
eine Verkoppelung in der Diskussion zwischen besserer<br />
Ausbildung und Hochschule. Dann wird das Ausbildungsniveau<br />
angehoben, aber man sieht nicht, dass man damit<br />
unten was kaputt macht und das Hochziehen des Niveaus<br />
die Ausbildung nicht unbedingt besser und vor allem nicht<br />
praxisbezogener macht. Wir glauben, dass es über ein<br />
Hochziehen der Niveaus nur in den Hierarchien besser<br />
wird.<br />
Es entstand eine Diskussion darüber, dass Erzieher auf<br />
Hochschulniveau ausgebildet werden müssten. In dem<br />
Zusammenhang hat man zum Beispiel nach Italien<br />
geguckt und hat damit argumentiert, dass in Italien mittlerweile<br />
die Erzieherausbildung grundsätzlich eine Hochschulausbildung<br />
ist. Das ist formal richtig, aber in der Praxis<br />
ist es nicht richtig. Ich kenne das in Tirol ganz gut, weil<br />
ich da viel mit der Landesregierung gemacht habe. Wenn<br />
man in Südtiroler Kindergärten geht, sind da ein oder zwei<br />
Erzieher, der Rest sind Assistenten, die von sogenannten<br />
Fachschulen genau auf dem Niveau, wie es auch bei uns<br />
war, ausgebildet wurden. Aber die haben eben den Titel<br />
nicht. Das heißt also, wir gucken nicht richtig, ziehen blind<br />
die Systeme hoch und machen dabei noch dicht. Das ist<br />
nicht nur der Senat, wir können den Schwarzen Peter<br />
nicht der Administration zuschieben und die Verantwortung<br />
von uns abwälzen. Da waren wir ganz massiv selbst<br />
mit beteiligt, indem wir gesagt haben, dass wir besser<br />
ausgebildete Erzieher brauchen und die bessere Qualität<br />
vom Hochschulniveau erwartet haben.<br />
TN: Die Ergebnisse der PISA-Studie sind ja durchgeschlagen<br />
bis runter in die Kindergärten, also in die Erzieheraus-<br />
bildung. Jetzt führt diese Ausbildung quasi in ein Studium,<br />
das sehr theoretisch ist. Jetzt geht die Ausbildung in eine<br />
Richtung, die mit der Tätigkeit vor Ort nichts mehr zu tun<br />
hat. Nur Basteln, das kann es nicht sein, aber nur Theorie<br />
im Kopf genau so wenig.<br />
TN: Das sind ja Probleme, die wir generell hier mit dem Ausbildungssystem<br />
haben. Mir fällt aber darüber hinaus auf,<br />
dass die Studierenden wenig mit Themen zu tun haben,<br />
die ich <strong>für</strong> Stadtteilarbeit relevant fi nde. Projektmanagement<br />
ist ganz oft nicht vertreten, aber auch Sozialraumorientierung,<br />
Gemeinwesenarbeit, Bürgerbeteiligung. Und<br />
dass sie auch selbstständiges <strong>Arbeit</strong>en nicht unbedingt<br />
lernen. Warum stehen innerhalb der Ausbildung von Sozialarbeitern<br />
diese Themen in der Ecke?<br />
Dieter Oelschlägel: Wir hatten bei uns Projektstudium<br />
und das war eine gute Sache. Das war vier Semester lang,<br />
da gingen die Studenten in die Praxis und konnten sich<br />
aus der Praxis heraus die Fragestellungen erarbeiten,<br />
dann gab es die Theorie dazu. Das heißt, wir haben nicht<br />
einfach als Theorie gelehrt, sondern sie haben gefragt<br />
und die verschiedenen theoretischen oder methodischen<br />
Fragestellungen wurden dann zu den Projekten entwickelt.<br />
Das ist dann abgeschafft worden, weil nur noch wenige<br />
Hochschullehrer diese Praxis machen wollten. Das hat<br />
keine Anerkennung gefunden. Wir haben immer mehr<br />
Theorie, Theorie, Theorie, die Praxis ist dann abgeschafft<br />
worden. Dann kam bei uns die Einführung von Bachelor<br />
dazu. Da ist das wirklich falsch gelaufen, denn da ist die<br />
Praxis ganz rausgefallen und es wurde kein Platz <strong>für</strong> diese<br />
Sachen gelassen, sondern es wurden nur noch theoretische<br />
Module aneinander gereiht.<br />
Meines Erachtens liegt das eben daran, dass die Hochschullehrer<br />
nicht aus der Praxis kommen, <strong>für</strong> die sie ausbilden<br />
sollen. Es kommt ja niemand aus der Stadtteilarbeit,<br />
die paar Kollegen, die jetzt wirklich noch Gemeinwesenarbeit<br />
machen, das sind aussterbende Generationen.<br />
Herbert Scherer: Sobald eine Lücke in der Ausbildung zur<br />
Sozialarbeit entsteht, wird sie durchaus auch von anderen<br />
Berufsfeldern, z.B. Stadtplanern, besetzt.
TN: Ich hatte ein Jahr Praktika hinter mir, hatte mich schon<br />
sehr früh <strong>für</strong> den Studiengang Stadtplanung interessiert,<br />
der sehr projektbezogen ist. Man arbeitet teilweise selbstständig<br />
an den Projekten. Stadtentwicklung, Landschaftsplanung.<br />
Da ist auch Theorie dabei, aber da kann man<br />
sich durchbeißen, wenn man auch die Praxis dazu hat.<br />
In Weißensee habe ich z.B. mit 256 Kindern und Jugendlichen<br />
Fragebögen erstellt zur Sozialraumorientierung.<br />
Und wir haben Stadtteilerkundungen gemacht.<br />
Ich habe eine Freundin, die hatte angefangen, Sozialpädagogik<br />
zu studieren und sie hat auch eine Krise gekriegt<br />
von der ganzen Theorie, die sie nicht anwenden kann.<br />
Jetzt ist sie in der Ausbildung zur Erzieherin gelandet,<br />
damit geht es ihr besser.<br />
TN: Als ich studierte, konnte ich mich zwischen verschiedenen<br />
Fakultäten entscheiden, dem architektonischen<br />
Bereich, dem wissenschaftlichen Bereich und dem<br />
Bereich der Sozialwissenschaften. Ziemlich früh habe ich<br />
mich entschieden, welches von diesen Themenspektren<br />
ich als Schwerpunkt wählen wollte. Ist das heute immer<br />
noch so?<br />
TN: Nein, schön wäre es natürlich, aber das ist ja auch ein<br />
Bachelor und ist eher ein schmales Programm.<br />
Stephan Wagner: Wissenschaftliche Felder entwickeln<br />
oft eine eigene innere Dynamik. Für das Bild von <strong>sozial</strong>er<br />
<strong>Arbeit</strong> sind ein paar Eckpunkte erkennbar, die sich<br />
vor allem dadurch auszeichnen, dass sie unfl exibel sind<br />
und sich nicht mehr verändern. Etwa dass Sozialarbeiter<br />
gestandene Leute sein müssen, mit einem enormen Wissen.<br />
Wenn sie in ihre so vielfältigen <strong>Arbeit</strong>sfelder rausgehen,<br />
sollen sie immer alles können. Wir haben uns geweigert,<br />
Spezialisierungen zu machen, wie sie in Amerika<br />
und in England schon längst gelaufen sind, wo es etwa <strong>für</strong><br />
Community Work eine Spezialausbildung gibt. Das wurde<br />
bei uns dem Bachelor zugeschlagen. Wir haben jetzt im<br />
Bachelor-Studiengang eine hochgradige Spezialisierung.<br />
Dieter Oelschlägel: Hochgradig spezialisiert und praxisfern.<br />
Stephan Wagner: Das ist eine Bewegung, die man erkennen<br />
kann, die aber nicht vernünftig gelaufen ist.<br />
Eine zweite Bewegung ist, woran machen sich wissenschaftliche<br />
Gegenstände fest? Ganz oben im Bewertungssystem<br />
stehen zur Zeit Stadtplaner und Kulturwissenschaftler.<br />
Kulturwissenschaften sind im Augenblick der Bereich, wo<br />
ganz viele unterschiedliche Inhalte gelernt werden, auch<br />
in Bezug auf Migration usw.. Hier entwickeln sich Fachgebiete<br />
weiter, die in der Sozialarbeit fast verschwunden sind<br />
oder nicht mehr wahrgenommen werden.<br />
Dann kommt hinzu, dass es Moden gibt. Es gibt immer<br />
bestimmte Sachen, die „in“ sind, die laufen gerade gut,<br />
und Gemeinwesenarbeit wird im Augenblick tendenziell<br />
als überholt oder als sehr veränderungsbedürftig angesehen.<br />
Die heute vorangetriebene Form von Community<br />
Work ist das Quartiersmanagement. Solche Moden<br />
machen der praktischen Sozialarbeit zu schaffen.<br />
Hinzu kommt, dass sich die Referenzwissenschaften, die<br />
Erkenntnis führend sind, verschieben. Die <strong>sozial</strong>e <strong>Arbeit</strong><br />
in den 80er Jahren hatte als Hintergrund Soziologie und<br />
Politologie, da kamen die Informationen her. Wenn Sie<br />
heute lesen, was Soziologen schreiben, das ist altmodisch.<br />
Wenn Sie spannende Sachen lesen wollen, dann müssen<br />
Sie zur Ökonomie gehen. Die wesentlichen Erkenntnisse,<br />
also zum Beispiel im Bereich der Diskussion, wie man<br />
Schule organisieren kann, wie muss Kinderversorgung<br />
organisiert werden, um Beteiligung von Frauen in der<br />
Gesellschaft zu ermöglichen, um die Geburtenraten zu<br />
steigern, usw., diese ganzen Diskussionen kommen aus<br />
der Ökonomie, die liefern die Daten. In der <strong>sozial</strong>en <strong>Arbeit</strong><br />
beziehen wir uns im Augenblick noch auf Referenzwissenschaften,<br />
die altmodische Ergebnisse liefern. Es sind Verschiebungen<br />
im Gang und es tauchen neue Leute im Feld<br />
auf. Da müssen wir gucken, wo das endet.<br />
TN: Eine Nachfrage zu der These, dass die Praktiker nicht<br />
mehr vorhanden sind oder nicht mehr wahrgenommen<br />
werden: Die <strong>Arbeit</strong>geber, also die Einstellungsträger,<br />
bemängeln die schlechte Ausbildung. Gleichzeitig sind<br />
die Studenten mit dieser Ausbildung unzufrieden. Es gibt<br />
eigentlich einen Druck auf eine Veränderung und ich will<br />
das mit der Frage verbinden, ob nicht die These berech-<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 143
144<br />
Workshop Berufs-Bilder<br />
tigt ist, dass nur eine Kaste von Hochschullehrern das<br />
schlechte Ausbildungssystem am Wachsen hält, um ihre<br />
Pfründe zu sichern? Und dass deshalb da keine Bewegung<br />
drin ist?<br />
Dieter Oelschlägel: Den Druck gibt es, aber die Lösungen<br />
laufen auch bei den Kritikern immer darauf hinaus: mehr<br />
Theorie. Die Entscheidung lautet nie, mehr in die Praxis<br />
zu gehen oder Theorie und Praxis besser zu verbinden.<br />
Das gilt auch <strong>für</strong> die Seite der Studenten, die eine bessere<br />
Ausbildung wollen.<br />
Herbert Scherer: Ich glaube, dieser Theorie-Druck hängt<br />
mit der Praxis-Angst zusammen. Ich erinnere mich an<br />
einen Professor an der Alice-Salomon-Fachhochschule, der<br />
seinen Studenten gesagt hat, dass es total blöd ist, wenn<br />
sie als Sozialarbeiter arbeiten, weil man in diesen oder<br />
jenen Bereichen viel mehr Geld bekommt als ein Sozialarbeiter.<br />
Das, was da deutlich wird, das erleben wir die ganze<br />
Zeit: dass nämlich der Überbau ständig wächst, während<br />
es immer weniger Leute in der Praxis gibt. Das fi nde ich<br />
absurd, weil das Andere ja viel mehr Spaß macht.<br />
Stephan Wagner: Vor zwei Wochen war ich in den USA und<br />
habe mir Projekte angeguckt. Da ist mir eine Sache noch<br />
mal sehr deutlich geworden, die mir auch während meiner<br />
<strong>Arbeit</strong>szeit in den USA aufgefallen ist: in Deutschland<br />
wurden in den 60er Jahren Schulen der <strong>sozial</strong>en <strong>Arbeit</strong><br />
aus dem kirchlichen Bereich zu staatlichen Schulen.<br />
Dabei ist das Feld der Ethik und auch die Frage, warum<br />
jemand Sozialarbeiter geworden ist, verloren gegangen.<br />
Dadurch war eine Berufung zum Beruf aufgehoben, nämlich<br />
dass ich Sozialarbeiter werde, weil ich gerade das<br />
machen will, weil das mein Ding ist. Das ist ein Moment<br />
der inneren Beteiligung, das über das rein wissenschaftliche<br />
Interesse hinaus geht, ein Interesse am Menschen<br />
und seinem Zustand und dem Zustand menschlicher<br />
Gesellschaft, mit dem Ziel positiver Veränderung hat.<br />
Das wird in den englischen und amerikanischen Schulen<br />
gelehrt und erlernt. Wir haben das aus der Ausbildung<br />
gestrichen, bis auf einzelne Ausnahmen, wo Kollegen das<br />
wieder eingebracht haben. Das heißt, wir haben den Kern<br />
geräumt.<br />
TN: Wie ist die Wertevermittlung in Holland?<br />
Sarah Steiner: Ich habe ja schon angedeutet, dass mir<br />
eine Vertiefung der Theorie fehlte. Praxisnähe und Wertevermittlung<br />
hatten wir aber genügend.<br />
TN: Nach dem Studium frisch in der Praxis? Ich weiß nicht,<br />
wie lange du jetzt in der Praxis bist.<br />
Sarah Steiner: Vielleicht vier Monate. Ich würde sagen,<br />
dass es gut geht, aber das liegt auch immer an dem eigenen<br />
Anspruch, Wissen und Theorie über das, was man<br />
macht, anzuhäufen. Das praktische <strong>Arbeit</strong>en geht jedenfalls<br />
gut. Bei einigen Sachen merke ich, dass ich noch<br />
einen Hintergrund bräuchte, dann lese ich eben Sachen<br />
nach oder spreche mit Leuten darüber.<br />
Herbert Scherer: Von amerikanischen Kollegen habe ich<br />
gehört, dass sie die deutschen SozialarbeiterInnen aus<br />
einem ganz besonderen Grund <strong>für</strong> relativ unprofessionell<br />
halten. Sie meinen wahrgenommen zu haben, dass die<br />
deutschen SozialarbeiterInnen immer „nett“ sein wollen,<br />
sie wollen gemocht werden. Das heißt, die sehen sich<br />
nicht so sehr als Akteur eines Wandlungsprozesses, in<br />
dem sie bestimmte Ziele erreichen wollen. Die Theorie,<br />
mit der sie ausgebildet sind, wird nicht im wirklichen
Leben ständig aktualisiert als Teil von dem, was sie tun<br />
und durch Theorie besser verstehen. Sondern die Theorie<br />
wird einfach irgendwann abgehakt. Ansonsten will ich in<br />
der Praxis, dass die Leute nett zu mir sind, weil ich nett<br />
zu ihnen bin. Es ist nicht das Gefühl, dass ich an etwas<br />
arbeite und etwas erreichen will.<br />
Stephan Wagner: Eine amerikanische Kollegin, die gut<br />
Deutsch spricht und wahrnehmen kann, was hier los ist,<br />
hat das mir gegenüber so ausgedrückt: wenn sie unsere<br />
Leute drüben in der Praxis sieht, hat sie immer das Gefühl,<br />
sie hat Studenten aus dem dritten oder vierten Semester<br />
vor sich. Die wollen nett sein zu den Leuten, die wollen<br />
dem Klienten ein Freund sein, aber das ist nicht ihre Aufgabe,<br />
das ist unprofessionell. Unser Ausbildungssystem<br />
wird von Kollegen aus dem Ausland als ein sehr weiches<br />
System wahrgenommen, das sehr klientenfreundlich ist,<br />
das aber an vielen Stellen unprofessionell abläuft.<br />
TN: Die Studenten, die zu uns kommen, sagen ganz oft,<br />
dass sie großes Interesse daran haben zu lernen, was<br />
in der Praxis passiert. Der wissenschaftliche Teil ist eine<br />
Pfl ichtschuldigkeit dem gegenüber, was von den Universitäten<br />
oder den Ausbildungsstellen gefordert ist. Das ist<br />
nicht unbedingt ihr ureigenstes Interesse, sondern einfach<br />
das Gefühl: wenn sie sich dem System nicht unterordnen,<br />
dann haben sie keine Chance.<br />
Dieter Oelschlägel: Ich fi nde es gut, dass Sie von der<br />
Ethik gesprochen haben, denn Theorie, Praxis und Ethik<br />
im weitesten Sinn müssten sich verbinden lassen, warum<br />
man das macht und wie macht man das. Wenn die Studenten<br />
sagen: ich will wissen, was in der Praxis geschieht,<br />
dann fragen sie eigentlich auch schon, wie die Praxis<br />
erklärt wird und warum sie das machen. Wenn man das<br />
zusammenkriegen würde ... - aber das sind getrennte<br />
Angelegenheiten, das ist der Fehler.<br />
Selda Karacay: Ich denke, dass in Deutschland die Sozialpädagogik<br />
oder die Sozialarbeit nicht ernst genommen<br />
wird. Meine Eltern kommen aus der Türkei. In der Türkei<br />
ist es ganz wichtig, was man <strong>für</strong> einen Beruf hat. Wenn<br />
ich dort gefragt werde und sage, dass ich Sozialpädagogin<br />
bin, wow, das ist <strong>für</strong> die was ganz Besonderes. Auch<br />
in Holland ist das etwas ganz Besonderes. Ich glaube,<br />
dass es in Deutschland noch nicht angekommen ist, dass<br />
<strong>sozial</strong>e <strong>Arbeit</strong> einen großen Wert hat. Zu Beginn meines<br />
Studiums sagte ich: ich gebe Deutschland zehn Jahre, bis<br />
das <strong>sozial</strong>e System abstürzt. Ich denke, es ist nicht mehr<br />
so lange hin, weil da echt was gemacht werden muss,<br />
weil Sozialpädagogen, Erzieher und überhaupt Pädagogen<br />
nicht ernst genommen werden. Immer wieder werden<br />
die Mittel gekürzt. Es ist nicht angekommen, wie wichtig<br />
Menschen im <strong>sozial</strong>en Bereich sind, dass die ein Instrument<br />
<strong>für</strong> das System sind.<br />
Sarah Steiner: Das schlägt sich ja letztendlich auch in der<br />
Bezahlung nieder. Warum wird ein Sozialpädagoge nicht<br />
wie ein Lehrer bezahlt? Solche Sachen stellen ja auch<br />
Werte in der Gesellschaft dar.<br />
TN: Das gilt auch <strong>für</strong> Erzieher und Grundschullehrer.<br />
Selda Karacay: In Holland wird man schon im Studium<br />
dazu ermutigt, dass man sich hinstellt und sagt, dass wir<br />
wichtig sind, ich bin wichtig, ihr braucht mich, nicht ich<br />
euch. Hier dagegen ist meine Beobachtung, dass man<br />
als Sozialpädagoge ein bisschen gedrückter ist. Ich leite<br />
derzeit zwei Projekte an einer Oberschule. Ich gehe zu<br />
den Lehrern und fordere, was ich als notwendig ansehe.<br />
Wie es in der Ausbildung in Holland vermittelt wird. Sie<br />
brauchen mich, nicht ich sie.<br />
Sarah Steiner: Damit man weiß und deutlich macht, was<br />
man wert ist und was man kann.<br />
TN: Ich glaube, dass man das zum Teil durchaus so<br />
machen kann. Aber ich weiß, dass z.B. in England Leute<br />
mit einem deutschen Abschluss viel, viel besser eingeschätzt<br />
werden als hier bei uns. Eine Freundin von mir<br />
besucht regelmäßig Seminare in England. Da unterrichten<br />
Leute, die noch die alte Ausbildung in Deutschland<br />
gemacht haben, sie lehren Sozialpädagogik. Das ist da<br />
total hoch anerkannt. Und sie sehe dort zum Teil auch<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 145
146<br />
Workshop Berufs-Bilder<br />
die Mängel, die wir haben, z.B. in den kurzen Bachelor-<br />
Studiengängen. Ich glaube, an manchen Stellen wurde<br />
das deutsche Ausbildungssystem durch Nachahmung<br />
von etwas reformiert, wovon die anderen schon wieder<br />
abkommen.<br />
TN: Ich wollte darauf zurückkommen, dass in der <strong>sozial</strong>en<br />
<strong>Arbeit</strong> und in der <strong>sozial</strong>pädagogischen <strong>Arbeit</strong> viel<br />
in Kooperation geleistet werden muss. Das funktioniert<br />
an manchen Stellen ganz gut, aber an manchen Stellen<br />
leider nicht. Etwa in Schulen werden Sozialarbeiter oder<br />
Sozialpädagogen leider nicht als gleichberechtigt wahrgenommen.<br />
Wo das der Fall ist, erschwert das unglaublich<br />
die <strong>Arbeit</strong>. Dieses Hierarchiedenken in unserer<br />
Gesellschaft, auch in der Lehrerausbildung. Wie sollen<br />
Lehrer mit Schülern in einer gleichberechtigten Form,<br />
auch wenn sie die Autorität im Unterricht sind, umgehen,<br />
also auf Augenhöhe, wenn sie bis zum Ende ihrer<br />
Ausbildung von oben gedeckelt werden? Das hat System<br />
und da tritt jeder den, der seiner Meinung nach<br />
eine Stufe tiefer ist.<br />
Die Bedeutung der Erzieher ist in der pädagogischen<br />
<strong>Arbeit</strong> unverhältnismäßig viel größer als dieser Berufsstand<br />
an Wertschätzung erfährt. Das ist einfach eine<br />
Haltung, die wir hier in der Gesellschaft haben, wie es sie<br />
z.B. in der Schweiz nicht gibt. Das hat auch mit unserer<br />
inadäquaten Ausbildung zu tun.<br />
Herbert Scherer: Stephan ist auch als Akteur in dem Feld<br />
tätig, deshalb die Frage: Was kann man realistischerweise<br />
tun? Hast du irgendwelche Ideen?<br />
Stephan Wagner: Das könnte der Sozial-Management-<br />
Master sein, den wir zusammen mit der Alice-Salomon-<br />
Hochschule anbieten.<br />
Da muss man die Alice-Salomon-Hochschule wirklich<br />
loben, dass sie damals den Mut hatte, sich auf eine Kooperation<br />
mit der Praxis und mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband<br />
einzulassen. Sie hat zugestimmt, dass in<br />
sehr hohem Maße Praktika in die Ausbildung genommen<br />
werden. Inzwischen sind die Kritiker verstummt, weil sich<br />
gezeigt hat, dass es funktioniert. Das ist heute mit 80<br />
Leuten, die pro Jahr anfangen, der größte Studiengang,<br />
der auf Leitungsaufgaben im <strong>sozial</strong>en Bereich vorbereitet.<br />
Wir haben es dabei im Prinzip so wie in Holland gemacht.<br />
Wir machen das berufsbegleitend, wir gucken, dass wir<br />
Leute haben, die schon in der Praxis sind, und deren<br />
Berufspraxis ist in hohem Maße Thema in der Ausbildung<br />
selber, wird immer auf die theoretischen Themen bezogen.<br />
Da ist etwas Positives gelaufen.<br />
Wir werden an vielen Punkten ein bisschen relaxter sein<br />
müssen. Ich denke, wir werden auf Dauer vierjährige<br />
Bachelor-Studiengänge machen müssen. Das war bisher<br />
sehr verkürzt. Inzwischen gibt es dazu die Bereitschaft.<br />
Wir sollten ein Stück weit Richtung Holland gehen, also<br />
in die Bachelor-Ausbildung wieder Praxisphasen integrieren.<br />
Man sollte sich auch in der Abschlussarbeit am holländischen<br />
Modell orientieren, also die Abschlussarbeit<br />
koppeln mit einem Praxisteil, der bewertet wird. Das heißt<br />
auch <strong>für</strong> die Kollegen an den Hochschulen, wobei ich da<br />
an einem ganz wunden Punkt bin, dass man der Praxis<br />
Einfl uss einräumt. Die Praxis muss auch auf die Hochschulen<br />
zugehen, hier gibt es bei vielen Kollegen in den<br />
Hochschulen inzwischen eine große Bereitschaft, mit Praxisvertretern<br />
wieder zu reden. Da dreht sich gerade der<br />
Wind.<br />
Wir sponsern zum Beispiel als Paritätische Akademie den<br />
Fachkreis <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>e <strong>Arbeit</strong>, also den Zusammenschluss<br />
der Hochschulen, damit es organisatorisch ein bisschen<br />
besser läuft und die Kommunikation besser wird. Ich sehe<br />
viele Möglichkeiten, eine positive Entwicklung zu bewirken,<br />
aber wir werden das System verändern müssen.<br />
Herbert Scherer: Wir werden das System verändern müssen<br />
– das ist ein Super-Schlusswort. Vielen Dank <strong>für</strong> die<br />
aktive Beteiligung.
Abschlussplenum<br />
Woher wir kommen und wohin wir gehen<br />
Herausforderungen, Problemlösungen, Chancen<br />
Vortrag: Konrad Hummel<br />
Vielen Dank <strong>für</strong> die Einladung! Ich versuche zu kommentieren,<br />
wie ich Entwicklungen verstehe, beobachte und<br />
in Solidarität zu diesem <strong>Verband</strong> wahrnehme. Ich fand<br />
das Programm in seinem Aufbau und in seinem Bild vom<br />
Zusammenwachsen ausgesprochen interessant und<br />
werde mich an die Themen der <strong>Arbeit</strong>sgruppen in Stichworten<br />
halten, weil ich die <strong>für</strong> sehr geeignet halte, paradigmatisch<br />
etwas über die Zukunft zu sagen.<br />
Berlin wächst zusammen - oder wer wächst eigentlich<br />
zusammen? Das weiß man nicht so genau, wenn man<br />
das Programm liest. Es ist eine Riesenchance, dass<br />
diese Stadt nicht nur zusammengewachsen ist, sondern<br />
dass sie attraktiv ist <strong>für</strong> junge Menschen in der ganzen<br />
Republik. Das ist einer der ganz großen Pluspunkte, dass<br />
Berlin so attraktiv ist, das bewirkt eine Verjüngung, der<br />
Zuwachs von Studenten an den Universitäten macht die<br />
Stadt bunter und vielfältiger. Berlin hat nach außen das<br />
Image von Sonderbarkeit und Skurrilität, und es scheint<br />
mit diesem Bild erfolgreich zu sein.<br />
Hier und heute empfehle ich dennoch, dieses Bild politisch<br />
ein bisschen kritischer zu wenden und die Frage zu<br />
stellen: Was ist es denn wirklich, was zusammenwach-<br />
sen soll? Man arbeitet an Toleranz zwischen Ost und<br />
West, am Verstehen zwischen Mann und Frau, es gibt<br />
zahlreiche Initiativen zu allen möglichen Schwierigkeiten<br />
im Leben. Aber das bloße Moderieren von Gegensätzen<br />
reicht <strong>für</strong> ein Zusammenkommen nicht aus. Das reicht<br />
nicht <strong>für</strong> eine moderne Gesellschaftsvision.<br />
Aus diesem Grund ist <strong>für</strong> mich die Frage, warum der<br />
Nachbarschaftsgedanke hier und in ganz Deutschland<br />
so wichtig ist. Nachbarschaft ist ja nicht nur als Heimat<br />
oder Gemeinschaft bis heute attraktiv. Sondern<br />
sie wurde damals bewusst als eine Antwort auf den<br />
Faschismus organisiert. Nachbarschaft war eine Antwort<br />
auf die Blockkontrolle. Also mit anderen Worten:<br />
Nachbarschaft ist im Geist dieses <strong>Verband</strong>es so etwas<br />
wie bewusste Wahrnehmung unterschiedlicher Menschen<br />
auf engem Raum.<br />
Ich fi nde es ganz wichtig, dass dieses Kernerbe des <strong>Verband</strong>es<br />
nicht zerredet wird. Aber wie gestalten wir eigentlich<br />
Nachbarschaft, die sich ganz bewusst nicht als eine<br />
beliebige Nachbarschaft, sondern als eine strategisch<br />
gewünschte Nachbarschaft versteht? In den letzten 20<br />
Jahren haben sich nicht nur Nachbarschaften verändert,<br />
sondern auch das Verständnis von Staat unterliegt einem<br />
dramatischen Wandel. Stichworte: Ende der DDR und<br />
Entwicklung von Europa. Ich fi nde, die <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> muss auf dieses veränderte Staatsverständnis in<br />
einem höchst aufmerksamen Prozess reagieren.<br />
Eine <strong>Arbeit</strong>sgruppe hat darüber diskutiert, dass wir laufend<br />
Aufgaben des Staates übernehmen, Staatsaufgaben<br />
also privatisiert werden. Betrachten wir die Entwicklung<br />
der letzten 12 Monate: Dieser sich reduzierende Sozialstaat<br />
bäumt sich plötzlich auf und übernimmt Garantien<br />
<strong>für</strong> Finanzschulden wie nie zuvor im Staatswesen.<br />
Also mit anderen Worten: Der vermeintlich schwache<br />
Staat ist plötzlich wieder zum Garanten geworden. So<br />
schwankt er hin und her und die Menschen sind verunsichert,<br />
doch insgeheim hoffen sie, der Staat und die Politik<br />
würden es schon richten.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 147
148<br />
Abschlussplenum<br />
Ich plädiere da<strong>für</strong>, an diesem veränderten Staatsverständnis<br />
zu arbeiten. Ich habe damals schon vor Jahren<br />
– wahrscheinlich unpopulär als Sozialdezernent – in Augsburg<br />
<strong>für</strong> den Kerngedanken von Hartz IV geworben, weil<br />
ich <strong>für</strong>chtete, und ich denke, so ist es auch bald eingetreten,<br />
dass nur die Kürzungsdiskussion übrig bleibt, wie viel<br />
und wie wenig Leistungen passieren. Mein Kerngedanke<br />
zur Rolle des Staates im <strong>sozial</strong>en Bereich und in der Bildung<br />
ist, dass man weg muss von einer pauschalen staatlichen<br />
Förderung hin zu einem ernst gemeinten Fordern<br />
und Fördern in allen Bereichen. Das Staatsverständnis<br />
muss anders werden. Und der <strong>Verband</strong> müsste mit seinen<br />
Einrichtungen immer wieder daran arbeiten: Wie können<br />
wir mit dem Staat, gegen den Staat, in Abgrenzung zum<br />
Staat unsere Art von Nachbarschaftsarbeit weiter entwickeln?<br />
Zweites Stichwort: Nachfrageorientierung. In der zweiten<br />
<strong>Arbeit</strong>sgruppe tauchte der Gedanke auf, ob man die Wünsche<br />
der Menschen erfüllt oder etwas tut, was eigentlich<br />
notwendig sei, also Schulungen und Angebote schafft.<br />
Auch dort erweist sich der <strong>Verband</strong> als ausgesprochen<br />
zeitgemäß, weil der gesellschaftliche Trend in den 20 Jahren<br />
sich eindeutig zum individuellen Bedarf hin entwickelt<br />
hat.<br />
Die Verbände und Einrichtungen haben sich eindeutig<br />
in die Richtung entwickelt, dass sie das, was gewünscht<br />
wird, im Sinne von Kundenorientierung, auch machen.<br />
Ob das richtig ist, stets das, was dort gewollt wird, umzusetzen,<br />
ist eine Frage, die man diskutieren muss. Wenn<br />
Mittelstandseltern Privatschulen wollen, dann können<br />
wir uns ja eigentlich dahinter klemmen. Ob das richtig ist<br />
<strong>für</strong> den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Da habe ich<br />
erhebliche Bedenken. Nachfrageorientierung muss nicht<br />
immer das Richtige sein, sondern wir müssen damit ringen.<br />
Drittes Stichwort: Vielfalt und Integration. In allen deutschen<br />
Großstädten gibt es faktisch Eltern von Grundschulkindern<br />
mit Migrationshintergrund. Berlin ist übrigens<br />
empirisch gar nicht an erster Stelle, in München und in<br />
Stuttgart sind die Zahlen weitaus höher. Aber wie gehen<br />
die Städte damit um? Sie reden von Integration. Was heißt<br />
eigentlich Integration, wenn wir 51 % der Kinder mit Migrationshintergrund<br />
haben? Wer soll sich eigentlich wohin<br />
integrieren? Integration taugt als Begriff nicht mehr.<br />
Dazu kommt die <strong>Arbeit</strong> mit Behinderten als integrierter<br />
Teil der Gesellschaft – gut, aber das löst das Dilemma<br />
nicht. Gemeint ist eigentlich das Verpfl ichten auf ein<br />
gemeinsames, vielgestaltiges Bild. Wie soll diese Vielfaltsgesellschaft<br />
aussehen? Deutsche Leitkultur her oder<br />
hin – fest steht, dass alle Menschen, die bei uns leben,<br />
die gleichen Grundrechte haben. Wie wägen wir aber die<br />
Religionsfreiheit gegen die Gleichheit von Mann und Frau<br />
ab? Zum Beispiel der Umgang mit Frauen und Mädchen<br />
aus Migrantenmilieus lässt noch sehr zu wünschen übrig.<br />
Wir müssen diese Frage der Vielfalt – gerade in <strong>sozial</strong><strong>kulturelle</strong>r<br />
<strong>Arbeit</strong> – offensiv angehen. Beim Sommerfest<br />
türkische Dönerbuden zu machen, das reicht nicht, aber<br />
das muss ich hier nicht sagen. Auch Wahlergebnisse<br />
haben oft mit Argumenten wenig zu tun, sondern mit den<br />
Lebensweisen. Wie gehen wir mit regional sehr unterschiedlichen<br />
Lebensweisen um? Wie können wir sie <strong>für</strong>einander<br />
öffnen? Denn da liegen die neuen Grenzen, die<br />
wir in der Gesellschaft haben.<br />
Nächster Punkt: Die Ambivalenz von Kultur, Bildung und<br />
Lernen. Ihr bemüht euch um die Annäherung von sozio-
<strong>kulturelle</strong>r <strong>Arbeit</strong> an <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong>. Wir haben<br />
tatsächlich ein riesiges Bildungsproblem, nicht nur auf<br />
Bundes- und Länderebene, sondern inzwischen, seit der<br />
Aachener Erklärung des Deutschen Städtetages vor zwei<br />
Jahren, auch auf kommunaler Ebene. Stichwort: Kommunale<br />
Bildungslandschaften. Das ist ein Thema, bei dem<br />
wir am Anfang stehen. Ich habe die erste Bildungswelle<br />
in den 70er Jahren mitbekommen, mehr Demokratie<br />
wagen, Bildungsreform, etc.. Nach meinen Erfahrungen<br />
ist das fast gescheitert oder zumindest nicht viel davon<br />
umgesetzt worden. Wir stehen heute in Deutschland<br />
vor dem Dilemma, dass wir in eine Bildungsdebatte mit<br />
einem ungeheuren fi nanziellen Aufwand hineintappen.<br />
Ein Beispiel: Die saarländische Regierung ist völlig pleite.<br />
Das Einzige, woran sie nicht spart, ist die Bildung. Das<br />
klingt gut. Aber wohin geht das eigentlich? Sind mehr<br />
Lehrer auch mehr Bildung? Ist Ganztagsunterricht zivilgesellschaftlich<br />
etwas Erfreuliches? Was ist eigentlich<br />
gerade los in den Schulen? Sie sagen, dass sie ihre Probleme<br />
mit Schul<strong>sozial</strong>arbeit lösen. Ist das die Antwort,<br />
dass ein System seine Probleme durch Sozialarbeiter löst,<br />
die sie in die Schule holen? Das einzige Thema, das von<br />
der Bevölkerung über 75 % Zustimmung hat und wo<strong>für</strong><br />
die Bevölkerung bereit ist, Opfer zu bringen, sind die Bildungsausgaben.<br />
Der <strong>Verband</strong> muss dort mitmischen und<br />
die Frage diskutieren: Was bedeutet Bildung und Lernen<br />
unter <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n Gesichtspunkten? Ich will kein<br />
Unterrichtsfach „Sozialverhalten“.<br />
Alleine die bürgerschaftliche Beteiligung an Bildung einmal<br />
durchzudenken, zum Beispiel auch die Rollenlosigkeit<br />
der Migranten in deutschen Schulen. Was machen<br />
sie als Antwort? Sie gründen laufend neue Schulen,<br />
türkische und russische Schulen. Aus meiner Sicht ist<br />
das eine katastrophale Entwicklung. Es ist ein wichtiger<br />
Gesichtspunkt, ob eine Republik <strong>für</strong> sich sagt, das Lernen<br />
im öffentlichen Raum, das Lernen des Miteinanders, das<br />
Lernen mit neuer Technologie muss einen zentralen Stellenwert<br />
haben. Wie soll ich denn Energie- und Feinstaubentwicklung<br />
zum Beispiel angemessen angehen, ohne<br />
dass ich lerne, wie ich mit dem Öffnen der Fenster, mit<br />
der Heizung und anderen Dingen umgehe? Das sind Lern-<br />
vorgänge. Wer die auf den Schulunterricht reduziert, hat<br />
verloren. Es wird deutlich, wie viel bei dem Thema Bildung<br />
und Lernen drinsteckt.<br />
Bildung fördert oder verhindert Gerechtigkeit. Denn die<br />
Chancen hoch qualifi zierter junger Menschen - heute global<br />
unterwegs – sind hoffnungslos weit entfernt von den<br />
Chancen derjenigen, die nur einen Realschulabschluss<br />
haben, gar nicht zu reden von Hauptschul- oder gar keinem<br />
Abschluss.<br />
Die Verortung der <strong>sozial</strong>en Frage in bestimmten Sozialräumen<br />
ist das nächste wichtige Thema. Seit zehn Jahren<br />
unterstützt der Bund die Förderung belasteter Quartiere.<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 149
150<br />
Abschlussplenum<br />
Übrigens auch ein bisschen verspätet wurde das Programm<br />
Soziale Stadt aufgelegt. Heute kämpfen Nachbarschaftshäuser<br />
mit den Quartiersmanagern in Folge<br />
der Umarmung und Abgrenzung. Die ganze Frage der<br />
Quartiersentwicklung ist nach deutscher Art schnell fast<br />
zum Berufsbild geworden. Die Wohnungsgesellschaften<br />
haben in Nordrhein-Westfalen da<strong>für</strong> einen Lehrstuhl eingerichtet.<br />
Ich persönlich halte es eigentlich <strong>für</strong> ein bisschen fatal,<br />
weil wir inzwischen erkennen, dass wir mit der reinen<br />
Miet- und Sanierungsentwicklung in bedrohten Wohnquartieren<br />
den Problemen nicht beikommen. Wir haben das,<br />
was Soziologen eine Verräumlichung von Verarmungsproblemen<br />
nennen. Armut, Migration, Schulstandard und<br />
die ganzen Benachteiligungen kommen zusammen, mit<br />
dem Ergebnis, dass Unternehmen nach der Wohnadresse<br />
entscheiden können, ob sie einen Bewerber nehmen oder<br />
nicht. Das ist eine Katastrophe. Es hat schon gereicht,<br />
wenn ein Bewerber arm oder Migrant war, aber jetzt hat<br />
er auch noch das Wohnquartier als Problem, aus dem<br />
kaum jemand rauskommt. Wenn in Neukölln anspruchsvolle<br />
junge Familien eine bessere Schule haben wollen,<br />
dann ziehen sie gleich über die Spree und verlassen die<br />
Gegend. Warum soll die Wohnungsbaugesellschaft dann<br />
noch sanieren? Sie merken, die Verräumlichung hat Folgen<br />
bis zu den Planungsstrategien und wir gehen zu wenig<br />
auf die neuen Fragen zu, sind immer noch gefangen in<br />
den klassischen baulichen Sanierungsgebieten.<br />
Dann das Stichwort: Grenzen der Dienstleistungsideologie.<br />
Das Angebot von <strong>sozial</strong>en Dienstleistungen ist nicht<br />
das Problem, sondern die Ideologie, die hinter diesem<br />
Begriff steckt. Nehmen Sie mal das Wort „Kunde“. Ist<br />
Ihnen klar, was das kommunalpolitisch heißt, wenn alle<br />
Städte ihre Bürger als Kunden behandeln? Wissen Sie,<br />
was Kunden tun, wenn sie mit dem vorhandenen Angebot<br />
an Dienstleistungen unzufrieden sind? Sie ziehen um! Das<br />
heißt, wir produzieren ein unpolitisches Bewusstsein bei<br />
Menschen, die keinen Einfl uss auf vorhandene Zustände<br />
nehmen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir in der<br />
Kommunalpolitik wollen. Kommunalpolitisch wollen wir<br />
aktive Nachbarschaften, wir wollen Teilhabe und Mitgliedschaft.<br />
Also mit anderen Worten: Wenn Ausweitung<br />
der Dienstleistungen, was ich in Berlin gut fi nde, dann<br />
muss das begleitet werden, damit der Prozess weg vom<br />
Kunden geht, hin zu Teilhabe- bzw. Mitmachstrukturen, zu<br />
Verbindlichkeitsstrukturen.<br />
Ich komme zu dem Punkt der Modernisierungsbrüche,<br />
die es in der Gesellschaft noch stärker geben wird. Es<br />
ist sicher, dass es nicht einfach so weitergeht wie bisher.<br />
Und wenn dann einmal wir alle, die wir hier versammelt<br />
sind, ins Altenheim gehen, werden wir uns dort nicht bayerische<br />
Rumsmusik anhören, sondern die Rolling Stones.<br />
Denn jeder nimmt sein Milieu und damit seine Werte<br />
mit. Das heißt, auch auf dem Sektor wird sich drastisch<br />
viel ändern, weil sich die zukünftig alten Menschen nicht<br />
gleich verhalten werden wie die heute Alten. Sie werden<br />
vielleicht Auswahlvarianten nutzen, Zeitvarianten – 2<br />
Monate auf Mallorca, 10 Monate in Deutschland, das ist<br />
schon Wirklichkeit. Würden das mehr Leute machen können,<br />
dann würden sie es auch tun. Wir kommen in neue<br />
Verhaltensweisen hinein, die nicht nur gut oder schlecht<br />
sind, sondern vor allem anders.<br />
Und das letzte Stichwort: Ausbildung und Beruf. Hier<br />
geht es um veränderte Kompetenz und auch um demografi<br />
schen Wandel. Durch den demografi schen Wandel<br />
werden wir völlig neue Berufsgruppen und Berufsstrukturen<br />
bekommen, wir werden auch auf andere Verhaltensweisen<br />
bei Menschen stoßen. Demografi scher Wandel<br />
bedeutet nicht nur, alte Menschen zu sehen. Sondern<br />
auch: wer heute mit 20 Kindergärtnerin ist, hat die gruselige<br />
Vorstellung, bis 67 Kindergärtnerin zu sein. Das<br />
ist eine schwierige Perspektive. Und soziokulturell ein<br />
bemühter Animateur zu sein, ist nach 15 Jahren auch<br />
schwierig, dann fehlt einem ein bisschen der Pep. Aber<br />
wir brauchen alle Generationen. Nur, es wird Berufsbilder<br />
auch verändern, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der<br />
Bachelor- und Master-Debatte in der Ausbildung, sondern<br />
warum nicht mutiger ein paar Schulungselemente aus<br />
dem Leben der Menschen im Stadtteil einbringen? Unter<br />
solchen Voraussetzungen ist jede Verschulung positiv.
Wenn wir das als begleitendes Denken verstehen, dann<br />
sieht die Welt anders aus, dann bin ich daran interessiert,<br />
dass diese Entwicklung nicht zu lange auf sich warten<br />
lässt. Wir stecken ja mitten im demografi schen Denken,<br />
diese Republik ist im Durchschnitt 49 Jahre alt, während<br />
alle, die zu uns kommen, im Durchschnitt 21 Jahre alt<br />
sind. Das heißt, hier entwickeln sich noch gewaltige Veränderungen<br />
in unserer Gesellschaft.<br />
Die Frage ist jetzt: Wohin? Ich möchte ein Bild benutzen<br />
<strong>für</strong> die <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong>. Ich habe immer an eurer<br />
<strong>Arbeit</strong> bewundert, was ich das David-Prinzip nenne. David<br />
und Goliath, dabei ist David der siegreiche Kleine. Das hat<br />
einen Charme. Auf die <strong>Arbeit</strong> bezogen heißt das: Sie sind<br />
ein bisschen in der Nähe des Staates, aber autonom. Sie<br />
sind ein bisschen an der Zivilgesellschaft dran, aber sind<br />
nicht ganz der Schrebergartenverein wie die Caritas. Sie<br />
sind nicht ganz im unternehmerischen Bereich, aber doch<br />
selber betriebswirtschaftlich verantwortlich. Sie bewegen<br />
sich soziologisch gesehen, mitten im trisektoralen Dreieck.<br />
Manche nennen das Bermuda-Dreieck.<br />
Sich in diesem Dreieck zu bewegen, das heißt, dass man<br />
immer die Balance halten muss zwischen Animation und<br />
Bürger. Gleichzeitig betriebswirtschaftliche Verantwortung<br />
übernehmen, eine rentable Betriebsgröße erreichen,<br />
aber doch nicht so groß werden, dass man als ein<br />
Konzern behandelt wird. Das alles ist eine permanente<br />
Kunst des Ablehnens und Annehmens, wenn Sie bei<br />
Dienstleistungen Verantwortung tragen.<br />
Wenn dieser Balanceakt erfolgreich ist, kann man stolz<br />
darauf sein. Wohin gehen wir? Kann David in einer modernisierten<br />
Welt überleben? David ist eine gute und wertvolle<br />
Gestalt. Aber David alleine reicht nicht als politische<br />
Strategie. Da ist die Frage: Wie stellt sich dieser <strong>Verband</strong><br />
in den nächsten 5 oder 10 Jahren auf? Der Verein sollte<br />
den Mut haben, über Berlin hinaus, dann doch wirklich<br />
bundesweit auf kommunaler Ebene mehr Präsenz anzustreben<br />
und sich nicht nur mit ein paar Freunden aus<br />
Wuppertal, Bremen und anderswo zu begnügen.<br />
Ich sehe auf kommunaler Ebene ein großes Problem:<br />
Deutsche Städte haben ja etwas sehr Wichtiges in die<br />
europäische Bewegung einzubringen, nämlich Selbstverwaltung.<br />
Die haben nicht alle Länder. Diese Selbstverwaltung<br />
haben aber unsere Kommunen zunehmend an Bund<br />
und Länder verkauft. Sie können zwar die Durchführung<br />
von Projekten steuern, sind aber nicht wirklich zuständig,<br />
weil sie abhängig sind von den Förderungen. Schauen<br />
Sie sich die Steuersituation an. Sie ist in den Kommunen<br />
immer dramatischer. Wen treffen die Kürzungen auf kommunaler<br />
Ebene? Unmittelbar Projekte und Bürger.<br />
Wir müssen auf kommunaler Ebene die Frage der Demokratie,<br />
der Bürgerbeteiligung, der Stadtentwicklung, der<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 151
152<br />
Abschlussplenum<br />
Inter-Generationsprojekte, der <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong>n Projekte<br />
praktisch angehen, weil dort alles zusammenfl ießt. Mein<br />
Wunsch ist, dass wir mit den Akteuren, die dort organisiert<br />
sind, stärker eine gemeinsame <strong>Arbeit</strong> schaffen.<br />
Ich bin Mitgründer des Bundesnetzwerkes Bürgerengagement.<br />
Wir haben dort einen <strong>Arbeit</strong>skreis Kommunales.<br />
Der dümpelt häufi g vor sich hin. Auch das macht keinen<br />
Sinn. Ich plädiere da<strong>für</strong>, dass wir auf Bundesebene mit<br />
dem Bundesnetzwerk Bürgerengagement, auch mit dem<br />
<strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong>, mit den Quartiersmanagern,<br />
mit den Agenturen gemeinsam beratschlagen,<br />
was uns auf kommunaler Ebene zusammenführen<br />
könnte, was da strategisch zusammengehört.<br />
Vielleicht wäre es überlegenswert, ob man sich nicht<br />
zusammentut mit Stiftungen und mehr Stipendien <strong>für</strong><br />
Nachbarschaftsarbeit vergibt. Vielleicht schaffen wir mit<br />
anderen Stiftungen zusammen eine kommunale Plattform,<br />
wo die <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> in den Städten zusammengeführt<br />
wird, damit es eine gemeinsame Richtung<br />
gibt. Diesen Dialog gibt es noch nicht. Im Moment läuft<br />
es so, dass die Kommunen sagen: Ihr könnt auf Landes-<br />
oder Bundesebene alles beschließen was ihr wollt, wenn<br />
ihr es bezahlt, dann machen wir es. Wenn ihr es nicht<br />
bezahlt, dann machen wir es nicht. Das ist eine völlige<br />
Selbstkastration. Der Städtetag prüft nur noch, ob eine<br />
neue Reform vom Bund oder Land oder der EU durchfi -<br />
nanziert ist. Aber so kann Demokratie nicht funktionieren.<br />
In der Demokratie werden die Fragen unten gestellt<br />
und dann suche ich die Lösungen. Deshalb gibt es das<br />
Bemühen, die kommunale Ebene aufzuwerten.<br />
Wir brauchen das Vertrauen der kommunalen Ebene.<br />
Dort spielen die Nachbarschaftshäuser eine unglaublich<br />
wichtige Rolle. Dort ist die große Chance, glaube ich, mit<br />
all dieser Kunst, die David aufbringt, mit der Klugheit, der<br />
Frechheit und dem Mut, all diesen Tugenden, die David<br />
hat, die notwendigen Balancen herzustellen, geduldig<br />
anzuschauen, auszudiskutieren und auszuhalten. Diese<br />
spezielle Kunst, als kleiner <strong>Verband</strong> zwischen den Fronten<br />
zu überleben, sich zu positionieren, wenn auch mit<br />
Schwerpunkt in Berlin, die gilt es einzubringen in einen<br />
kommunalen Dialog über das, was Kommunen zusammenhält<br />
in den nächsten 20 Jahren. Das wird zuerst eine<br />
Offensive des Lernens sein, es wird eine Frage der Vielfalt<br />
sein, eine Frage der Demografi e. Das sind die zentralen<br />
Fragen, die die Kommunen überall haben. Die Frage ist<br />
nicht, wer es fi nanziert, sondern wer sich zusammentut<br />
auf dem Gebiet, wer hat eine ähnliche Auffassung von<br />
einer Bürgerschaft, die nicht mehr harmonisch-idealistisch<br />
zusammen zu bekommen ist, so wie die Milieus<br />
auseinanderdividiert worden sind.<br />
Es gilt auf jeden Fall, mit diesen sehr unterschiedlichen<br />
Lebensweisen dynamisch zu arbeiten. Da<strong>für</strong> sind die<br />
Nachbarschaftshäuser eine sehr gute Voraussetzung.<br />
Das erfordert von den Beteiligten ein großes Stück Selbstbewusstsein.<br />
Ich plädiere da<strong>für</strong>, dass der <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> mehr kommunale Vernetzung im nachbarschaftlichen<br />
Sinne durch systematische Dialoge mit allen Beteiligten<br />
anstrebt, eine offensive Politik, damit man über<br />
Berlin hinaus in deutsche Städte kommt.
Wendezeiten Fotografi en von Harald Hauswald<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 153
154<br />
Teilnehmerliste<br />
Vorname Name Institution / www-Adresse<br />
Ingrid Alberding Nachbarschaftsheim Mittelhof - www.mittelhof.org<br />
Caroline Barrera Grünheide<br />
Irene Beyer Nachbarschaftshaus Pfefferberg - www.pfefferwerk.de<br />
Eva Bittner Theater der Erfahrungen - www.nbhs.de<br />
Theda Blohm Kreativhaus - www.kreativhaus-tpz.de<br />
Sabrina Blum Stadtteilhaus Gaisental, Biberach - www.stadtteilhaus-biberach.de<br />
Katharina Brachmann Nachbarschaftshaus Pfefferberg - www.pfefferwerk.de<br />
Hans Buchholz <strong>Arbeit</strong>skreis Berliner Senioren - www.senioren-berlin.de<br />
Ruth Ditschkowski Fabrik Osloer Str. - www.nachbarschaftsetage.de<br />
Heidemarie Dreyer-Weik Paritätische Akademie - www.akademie.org<br />
Benjamin Eberle AWO Begegnungszentrum Adalbertstr. - www.begegnungszentrum.org<br />
Miriam Ehbets Rabenhaus Köpenick - www.rabenhaus.de<br />
Johannes Franz Erpenbeck Weyhe OT Dreye<br />
Willy Eßmann Outreach - www.outreach-berlin.de<br />
Elke Fenster Moabiter Ratschlag - www.moabiter-ratschlag.de<br />
Gabriele Fichtner Ball e.V. - www.ball-ev-berlin.de<br />
Andris Fischer <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> - www.stadtteilzentren.de<br />
Gunter Fleischmann Jugendwohnen im Kiez - www.jugendwohnen-berlin.de<br />
Ralf Gilb Outreach Neukölln - www.outreach-berlin.de<br />
Walli Gleim Gemeinwesenverein Heerstr. Nord - www.gwv-heerstr.de<br />
Reinhilde Godulla Network - www.spinnenwerk.de<br />
Angelika Greis Nachbarschaftshaus Urbanstr. - www.nachbarschaftshaus.de<br />
Wolfgang Günther M.A. NETZ eG, Berlin<br />
Angela Happel Nachbarschaftsheim Schöneberg - www.nbhs.de<br />
Jens Hartwig Quäker Nachbarschaftsheim, Köln - www.quaeker-nbh.de<br />
Harald Hauswald Ostkreuz Fotoagentur - www.harald-hauswald.de<br />
Bernhard Heeb Nachbarschaftsheim Neukölln - www.nbh-neukoelln.de<br />
Karin Höhne Nachbarschaftsheim Schöneberg - www.nbhs.de<br />
Angelika Höhne Nachbarschaftstreff des dfb - www.frauen-dfb.de<br />
Gisela Hübner <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> - www.stadtteilzentren.de<br />
Gabriele Hulitschke Quartiersrat Magdeburger Platz - www.tiergarten-sued.de/quartiersrat.4371.0.html<br />
Konrad Hummel Bundesverband <strong>für</strong> Wohnen und Stadtentwicklung - www.vhw.de<br />
Heiko Jähnig Freizeithaus in Weißensee - www.frei-zeit-haus.de<br />
Ralf Jonas Bürgerhaus Oslebshausen, Bremen - www.bghosl.de<br />
Karci Kadriye Senatsverwaltung <strong>für</strong> Stadtentwicklung - www.stadtentwicklung-berlin.de<br />
Joanna Kalkowski Kiezoase Schöneberg - www.kiezoase.de<br />
Selda Karacay Pfefferwerk Stadtkultur - www.pfefferwerk.de<br />
Siegfried Kaschke Neues Wohnen im Kiez - www.nwik.de<br />
Petra Kindermann Fabrik Osloer Str. - www.nachbarschaftsetage.de<br />
Steffen Kindscher Outreach Oberschöneweide - www.outreach-berlin.de<br />
Annette Knobloch-Minlend Berlin<br />
Ursula Köcher Nachbarschaftstreff „Club Spittelkolonnaden“ - www.frauen-dfb.de<br />
Marianne Konermann Nachbarschaftsheim Schöneberg - www.nbhs.de<br />
Dirk Lashlee Outreach Pankow - www.outreach-berlin.de<br />
Timm Lehmann Mehrgenerationenhaus Zehlendorf-Süd - www.nachbarschaftsheim.de<br />
Wolfgang Leppin Berlin
Christoph Lewek Freizeithaus in Weißensee - www.frei-zeit-haus.de<br />
Thomas Mampel Stadtteilzentrum Steglitz - www.stadtteilzentrum-steglitz.de<br />
Heike Marx Nachbarschaftsheim Schöneberg - www.nbhs.de<br />
Annette Maurer-Kartal Stadtteilverein Schöneberg - www.stadtteilvereinschoeneberg.de<br />
Ingrid Müller NBZ „Bürger <strong>für</strong> Bürger“ - http://www.volkssolidaritaet-berlin.de/begegnung/bg_bz_mitt_02.html<br />
Prof.Dr. Dieter Oelschlägel Forum Lohberg, Dinslaken - www.forum-lohberg.de/<br />
Elke Ostwaldt Outreach Treptow-Köpenick - www.outreach-berlin.de<br />
Hella Pergande Outreach Schöneberg-Nord - www.outreach-berlin.de<br />
Stephan Preschel Outreach Oberschöneweide - www.outreach-berlin.de<br />
Christina Putze Kreativhaus - www.kreativhaus-tpz.de<br />
Barbara Rehbehn Bürgerhaus am Schlaatz, Potsdam - www.buergerhaus-schlaatz.de<br />
Tanja Ries Berlin - www.tanjaries.de<br />
Markus Runge Nachbarschaftshaus Urbanstr. - www.nachbarschaftshaus.de<br />
Bahar Sanli Nachbarschaftshaus Urbanstr. - www.nachbarschaftshaus.de<br />
Monika Schaal Nachbarschaftshaus Pfefferberg - www.pfefferwerk.de<br />
Tina Schenck Nachbarschaftshaus Centrum - www.nachbarschaftshaus-centrum.de<br />
Herbert Scherer <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> - www.stadtteilzentren.de<br />
Elena Scherer <strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> - www.stadtteilzentren.de<br />
Gerd Schmitt Kiezoase Schöneberg - www.kiezoase.de<br />
Viola Scholz-Thies Gemeinwesenverein Heerstr. Nord - www.gwv-heerstr.de<br />
Elke Schönrock Gemeinwesenverein Haselhorst - www.gemeinwesenverein-haselhorst.de<br />
Enver Sen Stadtteilverein Schöneberg - www.stadtteilvereinschoeneberg.de<br />
Petra Sperling Gemeinwesenverein Heerstr. Nord - www.gwv-heerstr.de<br />
Margret Staal Bundesvereinigung sozio-<strong>kulturelle</strong>r Zentren - www.sociokultur.de<br />
Peter Stawenow Sozialwerk Berlin - www.<strong>sozial</strong>werk-berlin.de<br />
Sarah Steiner Outreach Pankow - www.outreach-berlin.de<br />
Haroun Sweis Network „Orientexpress“ - http://jugendserver.spinnenwerk.de/~orientexpress/<br />
Eva-Maria Täubert Theater der Erfahrungen - www.nbhs.de<br />
Bernhard Thies NBZ „Bürger <strong>für</strong> Bürger“ - http://www.volkssolidaritaet-berlin.de/begegnung/bg_bz_mitt_02.html<br />
Käthe Tresenreuter Sozialwerk Berlin - www.<strong>sozial</strong>werk-berlin.de<br />
Evelyn Ulrich Nachbarschaftshaus am Berl - www.vav-hhausen.de<br />
Birgit Vietzke Stadtteilkoordination Nürnberg - http://www.stark-gostenhof.de/Stadtteilkoordination.html<br />
Prof. Dr. Stephan Wagner Paritätische Akademie - www.akademie.org<br />
Joachim Walther Grünheide - www.taulos.de<br />
Birgit Weber Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen - www.bagfa.de<br />
Conny Weiland Nachbarschaftshaus Pfefferberg - www.pfefferwerk.de<br />
Volker Welz Freizeithaus in Weißensee - www.frei-zeit-haus.de<br />
Sabine Weskott SOS-Familienzentrum Berlin - www.sos-fz-berlin.de<br />
Nele Westerholt Stadtteilmanagement Düttmann-Siedlung - www.duettmann-siedlung.de<br />
Renate Wilkening Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum ufafabrik - www.nusz.de<br />
Matthias Winter Nachbarschaftshaus Urbanstr. - www.nachbarschaftshaus.de<br />
Torsten Wischnewski Pfefferwerk Stadtkultur - www.pfefferwerk.de<br />
Birgit Wulff TAEKS e.V. - www.taeks.de<br />
Hüseyin Yoldas Gangway - www.gangway.de<br />
Djamila Younis Kreativhaus - www.kreativhaus-tpz.de<br />
Georg Zinner Nachbarschaftsheim Schöneberg - www.nbhs.de<br />
Sigrid Zwicker Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum ufafabrik - www.nusz.de<br />
Was zusammen gehört ... Jahrestagung 2009 155
156<br />
Impressum<br />
Impressum<br />
Der <strong>Rundbrief</strong> wird herausgegeben vom<br />
<strong>Verband</strong> <strong>für</strong> <strong>sozial</strong>-<strong>kulturelle</strong> <strong>Arbeit</strong> e.V.<br />
Tucholskystraße 11, 10117 Berlin<br />
Telefon: 030 280 961 03<br />
Fax: 030 862 11 55<br />
Email: bund@sozkult.de<br />
Internet: www.vska.de<br />
Redaktion: Herbert Scherer<br />
Gestaltung: Hulitschke Mediengestaltung<br />
Druck: Agit-Druck Berlin<br />
Der <strong>Rundbrief</strong> erscheint halbjährlich<br />
Einzelheft: 5 Euro inkl. Versand