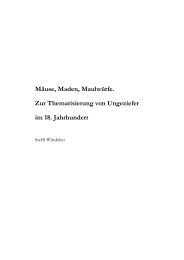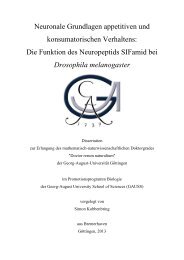Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.2.4.4 Samenprädation<br />
Als Samenprädatoren der Vogelkirsche werden im wesentlichen Nagetiere sowie<br />
Vögel genannt. Nach Beobachtungen von PIRL (2000) ist für den Schadfraß an<br />
Kirschensamen innerhalb der Baumkrone der Kernbeißer zu nennen, obwohl kletterfähige<br />
Mäuse wie die Rötel- und Gelbhalsmaus teilweise noch viel größeren<br />
Schaden anrichten können. Beobachtungen von TURĈEK (1968) ergaben aber auch,<br />
daß der Kernbeißer die Kirschkerne nicht nur in situ an Bäumen, sondern auch bis<br />
zum Spätherbst am Boden befrißt. Nach KOLLMANN (1994) sind die Kerne von P.<br />
avium mit Abstand dem stärksten Schadfraß unterworfen, wobei er zusätzlich noch<br />
die Waldmaus als Schädiger mit einbezieht. Er fand unter anderem, daß 87% der<br />
Kirschensamen durch Prädatoren vernichtet wurden. Auch in diesem Zusammenhang<br />
sei noch einmal auf Abb. 2.2 verwiesen, denn auch die Samenprädation wird<br />
in vielen Arbeiten als dichteabhängiger Prozeß verstanden und kann ähnliche Muster<br />
wie die durch Tiere erzeugte Samenausbreitung aufweisen.<br />
2.2.4.5 Einfluß der vegetativen Vermehrung<br />
Nach RÖHRIG & BARTSCH (1992) verjüngt sich die Vogelkirsche trotz häufiger und<br />
in manchen Jahren sehr ergiebiger Fruktifikation nur wenig auf generativem Wege.<br />
Das Gros des Vogelkirschen-Nachwuchses im Walde soll aus Wurzelbrut stammen,<br />
welches als Ursache dafür gewertet wird, daß Vogelkirschen in Mischbeständen<br />
oft in Trupps oder Gruppen auftreten. Als ein Grund wird die bessere<br />
Regenerationsfähigkeit der vegetativen Verjüngung nach biotischer Schädigung<br />
genannt. Das liegt möglicherweise in physiologischen Vorteilen für vegetativ entstandene<br />
Verjüngung, wie z.B. Wurzelverbindungen zu Altbäumen, die die Jungpflanzen<br />
vermutlich mit lebenswichtigen Ressourcen versorgen. Aus vegetativer<br />
Vermehrung hervorgegangene Pflanzen können so längere Zeiträume auch unter<br />
ungünstigen Bedingungen überdauern und somit lokal bessere Überlebensmöglichkeiten<br />
besitzen als generative Nachkommen.<br />
Erste Hinweise ergeben Untersuchungen von FRASCARIA et al. (1993), die mittels<br />
Isoenzymgenmarkern identische Multilocus-Genotypen auf einer Fläche von über<br />
0.5 ha fanden. Allerdings wird betont, daß noch weitere Marker mit höheren Polymorphiegraden<br />
Anwendung finden sollten, da manche Klongruppen nur an einem<br />
Genlocus Heterozygotie aufwiesen und damit auch die Möglichkeit gegeben ist,<br />
daß eine Rekombination wiederum identische Genotypen erzeugt.<br />
Welche Umweltbedingungen (incl. verschiedener forstlicher Bewirtschaftungsarten)<br />
die Anteile sexueller zu asexueller Vermehrung bestimmen und wie diese Anteile zu<br />
quantifizieren sind, bleibt allerdings meist offen. Auch die statistische Auswertung<br />
populationsgenetischer Daten bedarf diesbezüglich einer umfassenden Analyse.<br />
2.3 Die Ebene der Untersuchungsskala<br />
Zur zielgerichteten Analyse der Verbreitung von Pflanzen und ihrer genetischen Information<br />
im Raum sind neben einer geeigneten Methode zur Erkennung von<br />
Strukturen sowie der Analyse möglicher Prozesse, welche die beobachteten Muster<br />
20