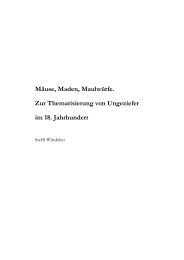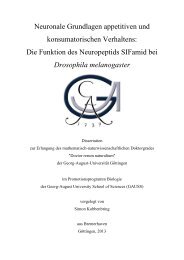Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
genschaften angenommen, lassen geringe Erwartungshäufigkeiten eines zwei- oder<br />
mehrfach beobachteten MLG folglich vegetative Vermehrung vermuten.<br />
Offensichtlich beruht diese Methode auf Annahmen, die nur für im Gleichgewicht<br />
befindliche, panmiktische Populationen gelten. Genau genommen können Genassoziationen<br />
aber nicht nur aufgrund asexueller Vermehrung, sondern auch im Zuge<br />
aller bedeutsamen evolutionären und adaptiven Prozesse erwartet werden. Diese<br />
Überlegung wird gestützt durch Ergebnisse einer kürzlich veröffentlichten Arbeit,<br />
die konzeptionelle und methodische Aspekte der Klonanalyse behandelt (GREGO-<br />
RIUS 2005).<br />
So betreffen Anpassungen in der Regel eine Vielzahl von Merkmalen, welche in unterschiedlichen<br />
physiologischen oder adaptiven Beziehungen zueinander stehen.<br />
Neben diesem, im allgemeinen mit den Begriffen Koevolution und Koadaptation<br />
angesprochenen Sachverhalt, können auch Paarungssysteme bzw. Sexualsysteme<br />
genische Assoziationen auf- oder abbauen. Letzteres ist auch schon bei Problemen<br />
der individuellen Identifikation in Tierpopulationen (WAITS et al. 2001) als auch in<br />
der Forensik bekannt (DONNELLY 1995). In Pflanzenvorkommen konnte unter anderem<br />
gezeigt werden, daß partielle Selbstbefruchtung den Aufbau von stochastischen<br />
Assoziationen zwischen homozygoten bzw. heterozygoten Genloci fördert<br />
(BENNET & BINET 1956, ZIEHE 2003). Im speziellen Fall der Vogelkirsche mit<br />
ihrem gametophytischen Selbstinkompatibilitätssystem und ihrer rezedenten Lebensweise<br />
sind Erkenntnisse, die aus Modelluntersuchungen in panmiktischen oder<br />
Selbstbefruchtung erlaubenden Reproduktionssystemen stammen, bezüglich einer<br />
Einschätzung der für die Art typischen Genassoziationen vermutlich wenig hilfreich.<br />
Auch fehlen eindeutige Informationen über den reproduktiven Zusammenhalt<br />
und damit die effektiven Populationsgrößen dieser Art.<br />
Es ist daher von grundlegender Bedeutung zu erfahren, welche Ausmaße Genassoziationen<br />
in natürlichen Populationen erreichen und inwieweit herkömmliche Verklonungsanalysen<br />
dadurch verfälscht werden können. Solche Maße existieren bislang<br />
im wesentlichen nur für zwei genetische Merkmale und nur in Verbindung mit<br />
Haplotypen (Gameten). Aus diesem Grunde wird hier ein kürzlich entwickeltes und<br />
allgemein anwendbares Maß für relative Genassoziation auf der Ebene von Genotypen<br />
und für eine beliebige Anzahl von Genloci verwendet (siehe GREGORIUS<br />
2004a). Da die Schätzung solcher Assoziationen für eine größere Anzahl genetischer<br />
Merkmale Stichprobengrößen von kaum realisierbarem Umfang erforderlich<br />
machen würden, sind hier alternative Methoden der Schätzung von Genassoziationen<br />
entwickelt worden.<br />
4.2 Konzeptionelle und statistische Vorgehensweise<br />
Bei Verwendung variabler Genmarker, wie z.B. SSRs (Mikrosatelliten), läßt die Beobachtung<br />
zweier oder mehrerer Kopien eines Multilocus-Genotyps (MLG) in<br />
einer Stichprobe zunächst meist asexuelle Vermehrung vermuten. Ein geeignetes<br />
statistisches Testverfahren zur Überprüfung der Hypothese, daß die beobachteten<br />
genetischen Strukturen auch tatsächlich auf klonale Reproduktion zurückzuführen<br />
40