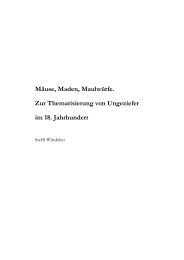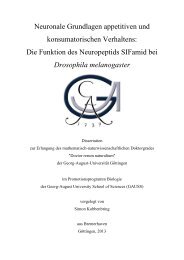Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Öffnen - eDiss - Georg-August-Universität Göttingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
lichkeiten der Besiedlung gegeben. Deshalb sind oft femelartig bewirtschaftete Flächen<br />
von Bedeutung, da hier eine mittlere raum-zeitliche Variation ökologischer<br />
Bedingungen (Lückendynamik) und damit eine gute Steuerbarkeit der Verjüngung<br />
von Mischbeständen (Licht-, Halbschatt- und Schattbaumarten) gegeben ist<br />
(SCHOPPA 2000). Diese Bestände sind vermutlich meist jünger, da die Vogelkirsche<br />
dem Konkurrenzdruck anderer Baumarten aufgrund ihres raschen Jugendwachstums,<br />
ihres frühen Kulminationszeitpunktes als auch ihrer geringen Schattentoleranz<br />
meist nur in frühen Sukzessionsstadien gewachsen ist und damit einer anderen<br />
Kolonisations-Extinktionsdynamik unterliegt (siehe Bestand Roringen).<br />
3.1.1 Der Kirschenbestand von Roringen als Beispiel für einen hochwaldbewirtschafteten<br />
Bestand<br />
Fagus sylvatica (Rotbuche) ist die dominante Baumart in diesem Bestand mit einem<br />
Flächenanteil von ca. 60%. Zweitwichtigste Baumart ist Fraxinus excelsior (Esche)<br />
mit knapp 30% Flächenanteil. Acer pseudoplatanoides (Bergahorn) und P. avium (Wildkirsche)<br />
sind stamm- bis gruppweise beigemischt und vereinzelt finden sich auch<br />
Acer campestre (Feldahorn) und Sorbus torminalis (Elsbeere) (siehe auch Tabelle 3.1<br />
und Abbildung 3.1).<br />
Insgesamt waren in diesem Waldbestand 56 adulte Kirschbäume vertreten. Zum<br />
Zwecke der DNA-Analyse wurde der Bestand vollständig beerntet und kartiert<br />
(Abbildung 3.2).<br />
Der Bestand erstreckt sich über die Abteilungen 14 (5.1 ha) und 16a (3.5 ha) des<br />
Realgemeindeforstes von Roringen. Der Standort wird im aktuellen Forsteinrichtungswerk<br />
als mesophiler Kalkbuchenwald eingestuft (mäßig frischer bis kaum<br />
frischer Standort der Ebenen mit gut versorgten steinigen Kalkverwitterungslehmböden).<br />
Im Betriebswerk von 1957 werden die Standortseigenschaften wie folgt<br />
kurz zusammengefaßt: „Ebene, Mullrendzina bis braune Rendzina, tonig, Kalkflora“.<br />
Genauere und verwertbare Aufzeichnungen der Forsteinrichtung bestehen seit dem<br />
Ende des II. Weltkrieges, die hier im folgenden nun näher beschrieben werden sollen.<br />
Im Betriebswerk von 1946 heißt es:<br />
„...Endnutzung durch langsamen Auszug der breitkronigsten Mittelwaldoberständer.<br />
Begünstigung und weitere Auflichtung über Naturverjüngungshorsten,<br />
evtl. femelartig. Aushieb vor allem des dämmenden Zwischenstandes,<br />
besonders Hainbuche, soweit er nicht als zukünftiger Bestand geeignet ist.<br />
Fortsetzung der Verjüngung von oben. Ausroden der verdämmenden Lonicera<br />
xylosteum...“<br />
Der Wortlaut läßt also vermuten, daß dieser, wie so mancher siedlungsnaher Bestand,<br />
aus ehemaliger Mittelwaldbewirtschaftung stammt und hier Maßnahmen für<br />
eine Überführung in Hochwald getroffen wurden.<br />
Dabei ist hier eine horstweise Naturverjüngung über femelartige Eingriffe als Überführungsmethode<br />
gewählt worden. Allerdings ist zu bemerken, daß schon damals<br />
die typischen Baumarten der Mittelwälder, wie z.B. die Eiche und die Hainbuche, in<br />
24