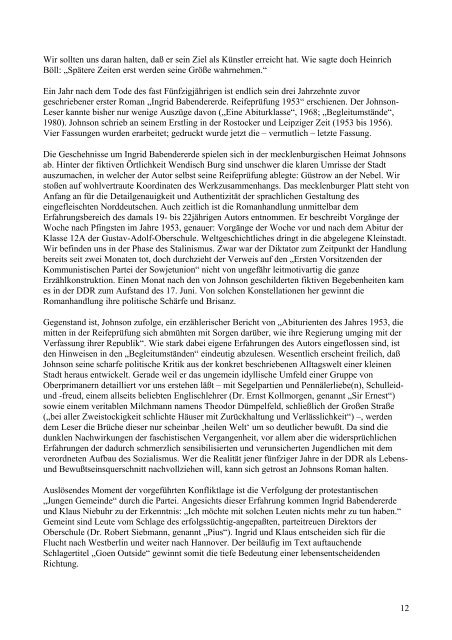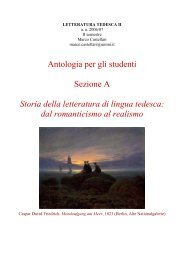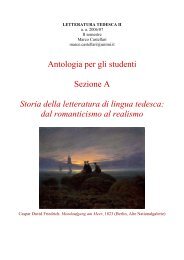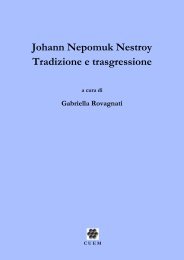Uwe Johnson - KLG
Uwe Johnson - KLG
Uwe Johnson - KLG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wir sollten uns daran halten, daß er sein Ziel als Künstler erreicht hat. Wie sagte doch Heinrich<br />
Böll: „Spätere Zeiten erst werden seine Größe wahrnehmen.“<br />
Ein Jahr nach dem Tode des fast Fünfzigjährigen ist endlich sein drei Jahrzehnte zuvor<br />
geschriebener erster Roman „Ingrid Babendererde. Reifeprüfung 1953“ erschienen. Der <strong>Johnson</strong>-<br />
Leser kannte bisher nur wenige Auszüge davon („Eine Abiturklasse“, 1968; „Begleitumstände“,<br />
1980). <strong>Johnson</strong> schrieb an seinem Erstling in der Rostocker und Leipziger Zeit (1953 bis 1956).<br />
Vier Fassungen wurden erarbeitet; gedruckt wurde jetzt die – vermutlich – letzte Fassung.<br />
Die Geschehnisse um Ingrid Babendererde spielen sich in der mecklenburgischen Heimat <strong>Johnson</strong>s<br />
ab. Hinter der fiktiven Örtlichkeit Wendisch Burg sind unschwer die klaren Umrisse der Stadt<br />
auszumachen, in welcher der Autor selbst seine Reifeprüfung ablegte: Güstrow an der Nebel. Wir<br />
stoßen auf wohlvertraute Koordinaten des Werkzusammenhangs. Das mecklenburger Platt steht von<br />
Anfang an für die Detailgenauigkeit und Authentizität der sprachlichen Gestaltung des<br />
eingefleischten Norddeutschen. Auch zeitlich ist die Romanhandlung unmittelbar dem<br />
Erfahrungsbereich des damals 19- bis 22jährigen Autors entnommen. Er beschreibt Vorgänge der<br />
Woche nach Pfingsten im Jahre 1953, genauer: Vorgänge der Woche vor und nach dem Abitur der<br />
Klasse 12A der Gustav-Adolf-Oberschule. Weltgeschichtliches dringt in die abgelegene Kleinstadt.<br />
Wir befinden uns in der Phase des Stalinismus. Zwar war der Diktator zum Zeitpunkt der Handlung<br />
bereits seit zwei Monaten tot, doch durchzieht der Verweis auf den „Ersten Vorsitzenden der<br />
Kommunistischen Partei der Sowjetunion“ nicht von ungefähr leitmotivartig die ganze<br />
Erzählkonstruktion. Einen Monat nach den von <strong>Johnson</strong> geschilderten fiktiven Begebenheiten kam<br />
es in der DDR zum Aufstand des 17. Juni. Von solchen Konstellationen her gewinnt die<br />
Romanhandlung ihre politische Schärfe und Brisanz.<br />
Gegenstand ist, <strong>Johnson</strong> zufolge, ein erzählerischer Bericht von „Abiturienten des Jahres 1953, die<br />
mitten in der Reifeprüfung sich abmühten mit Sorgen darüber, wie ihre Regierung umging mit der<br />
Verfassung ihrer Republik“. Wie stark dabei eigene Erfahrungen des Autors eingeflossen sind, ist<br />
den Hinweisen in den „Begleitumständen“ eindeutig abzulesen. Wesentlich erscheint freilich, daß<br />
<strong>Johnson</strong> seine scharfe politische Kritik aus der konkret beschriebenen Alltagswelt einer kleinen<br />
Stadt heraus entwickelt. Gerade weil er das ungemein idyllische Umfeld einer Gruppe von<br />
Oberprimanern detailliert vor uns erstehen läßt – mit Segelpartien und Pennälerliebe(n), Schulleidund<br />
-freud, einem allseits beliebten Englischlehrer (Dr. Ernst Kollmorgen, genannt „Sir Ernest“)<br />
sowie einem veritablen Milchmann namens Theodor Dümpelfeld, schließlich der Großen Straße<br />
(„bei aller Zweistockigkeit schlichte Häuser mit Zurückhaltung und Verlässlichkeit“) –, werden<br />
dem Leser die Brüche dieser nur scheinbar ‚heilen Welt‘ um so deutlicher bewußt. Da sind die<br />
dunklen Nachwirkungen der faschistischen Vergangenheit, vor allem aber die widersprüchlichen<br />
Erfahrungen der dadurch schmerzlich sensibilisierten und verunsicherten Jugendlichen mit dem<br />
verordneten Aufbau des Sozialismus. Wer die Realität jener fünfziger Jahre in der DDR als Lebensund<br />
Bewußtseinsquerschnitt nachvollziehen will, kann sich getrost an <strong>Johnson</strong>s Roman halten.<br />
Auslösendes Moment der vorgeführten Konfliktlage ist die Verfolgung der protestantischen<br />
„Jungen Gemeinde“ durch die Partei. Angesichts dieser Erfahrung kommen Ingrid Babendererde<br />
und Klaus Niebuhr zu der Erkenntnis: „Ich möchte mit solchen Leuten nichts mehr zu tun haben.“<br />
Gemeint sind Leute vom Schlage des erfolgssüchtig-angepaßten, parteitreuen Direktors der<br />
Oberschule (Dr. Robert Siebmann, genannt „Pius“). Ingrid und Klaus entscheiden sich für die<br />
Flucht nach Westberlin und weiter nach Hannover. Der beiläufig im Text auftauchende<br />
Schlagertitel „Goen Outside“ gewinnt somit die tiefe Bedeutung einer lebensentscheidenden<br />
Richtung.<br />
12