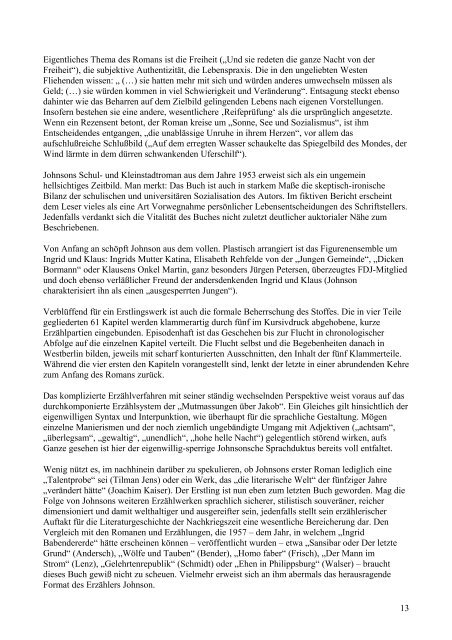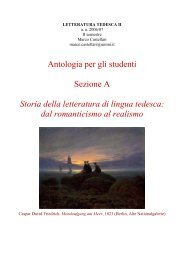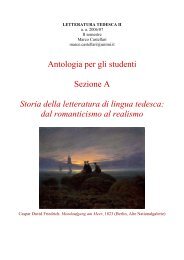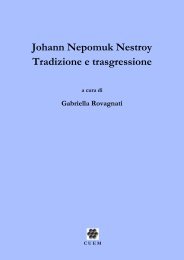Uwe Johnson - KLG
Uwe Johnson - KLG
Uwe Johnson - KLG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Eigentliches Thema des Romans ist die Freiheit („Und sie redeten die ganze Nacht von der<br />
Freiheit“), die subjektive Authentizität, die Lebenspraxis. Die in den ungeliebten Westen<br />
Fliehenden wissen: „ (…) sie hatten mehr mit sich und würden anderes umwechseln müssen als<br />
Geld; (…) sie würden kommen in viel Schwierigkeit und Veränderung“. Entsagung steckt ebenso<br />
dahinter wie das Beharren auf dem Zielbild gelingenden Lebens nach eigenen Vorstellungen.<br />
Insofern bestehen sie eine andere, wesentlichere ‚Reifeprüfung‘ als die ursprünglich angesetzte.<br />
Wenn ein Rezensent betont, der Roman kreise um „Sonne, See und Sozialismus“, ist ihm<br />
Entscheidendes entgangen, „die unablässige Unruhe in ihrem Herzen“, vor allem das<br />
aufschlußreiche Schlußbild („Auf dem erregten Wasser schaukelte das Spiegelbild des Mondes, der<br />
Wind lärmte in dem dürren schwankenden Uferschilf“).<br />
<strong>Johnson</strong>s Schul- und Kleinstadtroman aus dem Jahre 1953 erweist sich als ein ungemein<br />
hellsichtiges Zeitbild. Man merkt: Das Buch ist auch in starkem Maße die skeptisch-ironische<br />
Bilanz der schulischen und universitären Sozialisation des Autors. Im fiktiven Bericht erscheint<br />
dem Leser vieles als eine Art Vorwegnahme persönlicher Lebensentscheidungen des Schriftstellers.<br />
Jedenfalls verdankt sich die Vitalität des Buches nicht zuletzt deutlicher auktorialer Nähe zum<br />
Beschriebenen.<br />
Von Anfang an schöpft <strong>Johnson</strong> aus dem vollen. Plastisch arrangiert ist das Figurenensemble um<br />
Ingrid und Klaus: Ingrids Mutter Katina, Elisabeth Rehfelde von der „Jungen Gemeinde“, „Dicken<br />
Bormann“ oder Klausens Onkel Martin, ganz besonders Jürgen Petersen, überzeugtes FDJ-Mitglied<br />
und doch ebenso verläßlicher Freund der andersdenkenden Ingrid und Klaus (<strong>Johnson</strong><br />
charakterisiert ihn als einen „ausgesperrten Jungen“).<br />
Verblüffend für ein Erstlingswerk ist auch die formale Beherrschung des Stoffes. Die in vier Teile<br />
gegliederten 61 Kapitel werden klammerartig durch fünf im Kursivdruck abgehobene, kurze<br />
Erzählpartien eingebunden. Episodenhaft ist das Geschehen bis zur Flucht in chronologischer<br />
Abfolge auf die einzelnen Kapitel verteilt. Die Flucht selbst und die Begebenheiten danach in<br />
Westberlin bilden, jeweils mit scharf konturierten Ausschnitten, den Inhalt der fünf Klammerteile.<br />
Während die vier ersten den Kapiteln vorangestellt sind, lenkt der letzte in einer abrundenden Kehre<br />
zum Anfang des Romans zurück.<br />
Das komplizierte Erzählverfahren mit seiner ständig wechselnden Perspektive weist voraus auf das<br />
durchkomponierte Erzählsystem der „Mutmassungen über Jakob“. Ein Gleiches gilt hinsichtlich der<br />
eigenwilligen Syntax und Interpunktion, wie überhaupt für die sprachliche Gestaltung. Mögen<br />
einzelne Manierismen und der noch ziemlich ungebändigte Umgang mit Adjektiven („achtsam“,<br />
„überlegsam“, „gewaltig“, „unendlich“, „hohe helle Nacht“) gelegentlich störend wirken, aufs<br />
Ganze gesehen ist hier der eigenwillig-sperrige <strong>Johnson</strong>sche Sprachduktus bereits voll entfaltet.<br />
Wenig nützt es, im nachhinein darüber zu spekulieren, ob <strong>Johnson</strong>s erster Roman lediglich eine<br />
„Talentprobe“ sei (Tilman Jens) oder ein Werk, das „die literarische Welt“ der fünfziger Jahre<br />
„verändert hätte“ (Joachim Kaiser). Der Erstling ist nun eben zum letzten Buch geworden. Mag die<br />
Folge von <strong>Johnson</strong>s weiteren Erzählwerken sprachlich sicherer, stilistisch souveräner, reicher<br />
dimensioniert und damit welthaltiger und ausgereifter sein, jedenfalls stellt sein erzählerischer<br />
Auftakt für die Literaturgeschichte der Nachkriegszeit eine wesentliche Bereicherung dar. Den<br />
Vergleich mit den Romanen und Erzählungen, die 1957 – dem Jahr, in welchem „Ingrid<br />
Babendererde“ hätte erscheinen können – veröffentlicht wurden – etwa „Sansibar oder Der letzte<br />
Grund“ (Andersch), „Wölfe und Tauben“ (Bender), „Homo faber“ (Frisch), „Der Mann im<br />
Strom“ (Lenz), „Gelehrtenrepublik“ (Schmidt) oder „Ehen in Philippsburg“ (Walser) – braucht<br />
dieses Buch gewiß nicht zu scheuen. Vielmehr erweist sich an ihm abermals das herausragende<br />
Format des Erzählers <strong>Johnson</strong>.<br />
13