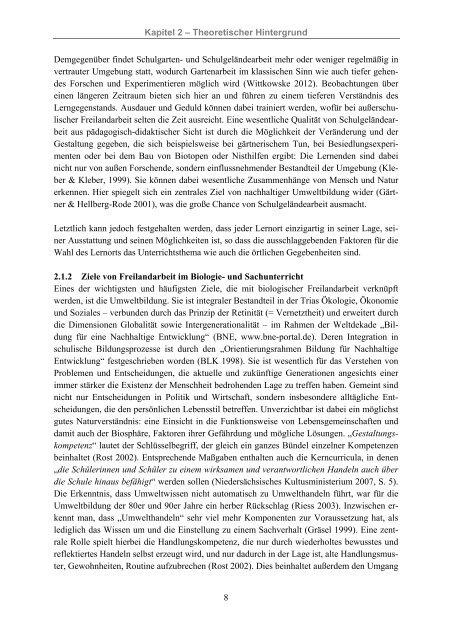Download (980Kb) - oops/ - Oldenburger Online-Publikations-Server
Download (980Kb) - oops/ - Oldenburger Online-Publikations-Server
Download (980Kb) - oops/ - Oldenburger Online-Publikations-Server
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 2 – Theoretischer Hintergrund<br />
Demgegenüber findet Schulgarten- und Schulgeländearbeit mehr oder weniger regelmäßig in<br />
vertrauter Umgebung statt, wodurch Gartenarbeit im klassischen Sinn wie auch tiefer gehendes<br />
Forschen und Experimentieren möglich wird (Wittkowske 2012). Beobachtungen über<br />
einen längeren Zeitraum bieten sich hier an und führen zu einem tieferen Verständnis des<br />
Lerngegenstands. Ausdauer und Geduld können dabei trainiert werden, wofür bei außerschulischer<br />
Freilandarbeit selten die Zeit ausreicht. Eine wesentliche Qualität von Schulgeländearbeit<br />
aus pädagogisch-didaktischer Sicht ist durch die Möglichkeit der Veränderung und der<br />
Gestaltung gegeben, die sich beispielsweise bei gärtnerischem Tun, bei Besiedlungsexperimenten<br />
oder bei dem Bau von Biotopen oder Nisthilfen ergibt: Die Lernenden sind dabei<br />
nicht nur von außen Forschende, sondern einflussnehmender Bestandteil der Umgebung (Kleber<br />
& Kleber, 1999). Sie können dabei wesentliche Zusammenhänge von Mensch und Natur<br />
erkennen. Hier spiegelt sich ein zentrales Ziel von nachhaltiger Umweltbildung wider (Gärtner<br />
& Hellberg-Rode 2001), was die große Chance von Schulgeländearbeit ausmacht.<br />
Letztlich kann jedoch festgehalten werden, dass jeder Lernort einzigartig in seiner Lage, seiner<br />
Ausstattung und seinen Möglichkeiten ist, so dass die ausschlaggebenden Faktoren für die<br />
Wahl des Lernorts das Unterrichtsthema wie auch die örtlichen Gegebenheiten sind.<br />
2.1.2 Ziele von Freilandarbeit im Biologie- und Sachunterricht<br />
Eines der wichtigsten und häufigsten Ziele, die mit biologischer Freilandarbeit verknüpft<br />
werden, ist die Umweltbildung. Sie ist integraler Bestandteil in der Trias Ökologie, Ökonomie<br />
und Soziales – verbunden durch das Prinzip der Retinität (= Vernetztheit) und erweitert durch<br />
die Dimensionen Globalität sowie Intergenerationalität – im Rahmen der Weltdekade „Bildung<br />
für eine Nachhaltige Entwicklung“ (BNE, www.bne-portal.de). Deren Integration in<br />
schulische Bildungsprozesse ist durch den „Orientierungsrahmen Bildung für Nachhaltige<br />
Entwicklung“ festgeschrieben worden (BLK 1998). Sie ist wesentlich für das Verstehen von<br />
Problemen und Entscheidungen, die aktuelle und zukünftige Generationen angesichts einer<br />
immer stärker die Existenz der Menschheit bedrohenden Lage zu treffen haben. Gemeint sind<br />
nicht nur Entscheidungen in Politik und Wirtschaft, sondern insbesondere alltägliche Entscheidungen,<br />
die den persönlichen Lebensstil betreffen. Unverzichtbar ist dabei ein möglichst<br />
gutes Naturverständnis: eine Einsicht in die Funktionsweise von Lebensgemeinschaften und<br />
damit auch der Biosphäre, Faktoren ihrer Gefährdung und mögliche Lösungen. „Gestaltungskompetenz“<br />
lautet der Schlüsselbegriff, der gleich ein ganzes Bündel einzelner Kompetenzen<br />
beinhaltet (Rost 2002). Entsprechende Maßgaben enthalten auch die Kerncurricula, in denen<br />
„die Schülerinnen und Schüler zu einem wirksamen und verantwortlichen Handeln auch über<br />
die Schule hinaus befähigt“ werden sollen (Niedersächsisches Kultusministerium 2007, S. 5).<br />
Die Erkenntnis, dass Umweltwissen nicht automatisch zu Umwelthandeln führt, war für die<br />
Umweltbildung der 80er und 90er Jahre ein herber Rückschlag (Riess 2003). Inzwischen erkennt<br />
man, dass „Umwelthandeln“ sehr viel mehr Komponenten zur Voraussetzung hat, als<br />
lediglich das Wissen um und die Einstellung zu einem Sachverhalt (Gräsel 1999). Eine zentrale<br />
Rolle spielt hierbei die Handlungskompetenz, die nur durch wiederholtes bewusstes und<br />
reflektiertes Handeln selbst erzeugt wird, und nur dadurch in der Lage ist, alte Handlungsmuster,<br />
Gewohnheiten, Routine aufzubrechen (Rost 2002). Dies beinhaltet außerdem den Umgang<br />
8