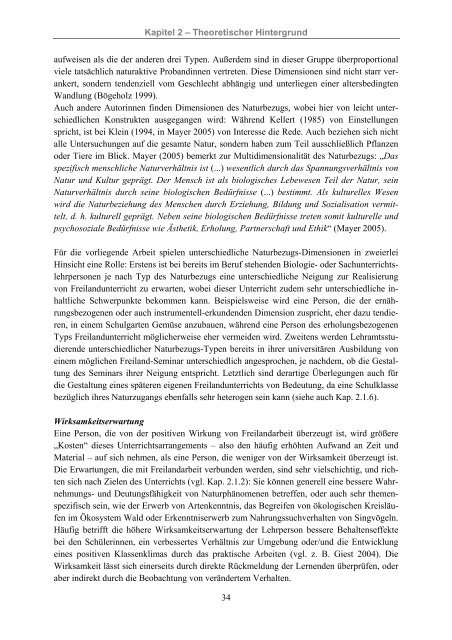Download (980Kb) - oops/ - Oldenburger Online-Publikations-Server
Download (980Kb) - oops/ - Oldenburger Online-Publikations-Server
Download (980Kb) - oops/ - Oldenburger Online-Publikations-Server
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 2 – Theoretischer Hintergrund<br />
aufweisen als die der anderen drei Typen. Außerdem sind in dieser Gruppe überproportional<br />
viele tatsächlich naturaktive Probandinnen vertreten. Diese Dimensionen sind nicht starr verankert,<br />
sondern tendenziell vom Geschlecht abhängig und unterliegen einer altersbedingten<br />
Wandlung (Bögeholz 1999).<br />
Auch andere Autorinnen finden Dimensionen des Naturbezugs, wobei hier von leicht unterschiedlichen<br />
Konstrukten ausgegangen wird: Während Kellert (1985) von Einstellungen<br />
spricht, ist bei Klein (1994, in Mayer 2005) von Interesse die Rede. Auch beziehen sich nicht<br />
alle Untersuchungen auf die gesamte Natur, sondern haben zum Teil ausschließlich Pflanzen<br />
oder Tiere im Blick. Mayer (2005) bemerkt zur Multidimensionalität des Naturbezugs: „Das<br />
spezifisch menschliche Naturverhältnis ist (...) wesentlich durch das Spannungsverhältnis von<br />
Natur und Kultur geprägt. Der Mensch ist als biologisches Lebewesen Teil der Natur, sein<br />
Naturverhältnis durch seine biologischen Bedürfnisse (...) bestimmt. Als kulturelles Wesen<br />
wird die Naturbeziehung des Menschen durch Erziehung, Bildung und Sozialisation vermittelt,<br />
d. h. kulturell geprägt. Neben seine biologischen Bedürfnisse treten somit kulturelle und<br />
psychosoziale Bedürfnisse wie Ästhetik, Erholung, Partnerschaft und Ethik“ (Mayer 2005).<br />
Für die vorliegende Arbeit spielen unterschiedliche Naturbezugs-Dimensionen in zweierlei<br />
Hinsicht eine Rolle: Erstens ist bei bereits im Beruf stehenden Biologie- oder Sachunterrichtslehrpersonen<br />
je nach Typ des Naturbezugs eine unterschiedliche Neigung zur Realisierung<br />
von Freilandunterricht zu erwarten, wobei dieser Unterricht zudem sehr unterschiedliche inhaltliche<br />
Schwerpunkte bekommen kann. Beispielsweise wird eine Person, die der ernährungsbezogenen<br />
oder auch instrumentell-erkundenden Dimension zuspricht, eher dazu tendieren,<br />
in einem Schulgarten Gemüse anzubauen, während eine Person des erholungsbezogenen<br />
Typs Freilandunterricht möglicherweise eher vermeiden wird. Zweitens werden Lehramtsstudierende<br />
unterschiedlicher Naturbezugs-Typen bereits in ihrer universitären Ausbildung von<br />
einem möglichen Freiland-Seminar unterschiedlich angesprochen, je nachdem, ob die Gestaltung<br />
des Seminars ihrer Neigung entspricht. Letztlich sind derartige Überlegungen auch für<br />
die Gestaltung eines späteren eigenen Freilandunterrichts von Bedeutung, da eine Schulklasse<br />
bezüglich ihres Naturzugangs ebenfalls sehr heterogen sein kann (siehe auch Kap. 2.1.6).<br />
Wirksamkeitserwartung<br />
Eine Person, die von der positiven Wirkung von Freilandarbeit überzeugt ist, wird größere<br />
„Kosten“ dieses Unterrichtsarrangements – also den häufig erhöhten Aufwand an Zeit und<br />
Material – auf sich nehmen, als eine Person, die weniger von der Wirksamkeit überzeugt ist.<br />
Die Erwartungen, die mit Freilandarbeit verbunden werden, sind sehr vielschichtig, und richten<br />
sich nach Zielen des Unterrichts (vgl. Kap. 2.1.2): Sie können generell eine bessere Wahrnehmungs-<br />
und Deutungsfähigkeit von Naturphänomenen betreffen, oder auch sehr themenspezifisch<br />
sein, wie der Erwerb von Artenkenntnis, das Begreifen von ökologischen Kreisläufen<br />
im Ökosystem Wald oder Erkenntniserwerb zum Nahrungssuchverhalten von Singvögeln.<br />
Häufig betrifft die höhere Wirksamkeitserwartung der Lehrperson bessere Behaltenseffekte<br />
bei den Schülerinnen, ein verbessertes Verhältnis zur Umgebung oder/und die Entwicklung<br />
eines positiven Klassenklimas durch das praktische Arbeiten (vgl. z. B. Giest 2004). Die<br />
Wirksamkeit lässt sich einerseits durch direkte Rückmeldung der Lernenden überprüfen, oder<br />
aber indirekt durch die Beobachtung von verändertem Verhalten.<br />
34