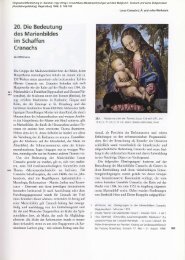Inaugural Dissertation - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Inaugural Dissertation - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Inaugural Dissertation - Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Biologische Grundlagen<br />
gebräuchlichsten. YFP kann mit der 514nm Linie des Argon-Ionen-Lasers angeregt werden und besitzt<br />
sein Emissionsmaximum bei ca. 530nm. Bei den in dieser Arbeit vorgestellten Messungen an E. coli-<br />
Bakterien wurden die jeweiligen Proteine mit YFP markiert.<br />
Es konnte inzwischen gezeigt werden, dass sich auch spektral nah beieinander liegende fluoreszente Proteine<br />
voneinander unterscheiden lassen. Dies geschieht über das Verhältnis von Transmission und Reflexion<br />
an einem dichroitischen Strahlteiler [Gun11]. Die Anregungs- und Emissionsspektren verschiedener<br />
fluoreszenter Proteine sind in Abbildung 3.1.2 zu sehen.<br />
Abbildung 3.1.1.: (a) Sekundärstruktur des grün fluoreszierenden Quallenproteins (GFP) aus Aequorea<br />
victoria, ein 11-strängiger β-Tonne mit coaxialer α-Helix. (b) Zentrales Chromophor des GFP (grün).<br />
(c) Chromophor der Ser 65 Thr Mutante von GFP. Für die Fluoreszenz essentiell sind zwei coplanare Ringe,<br />
die das Elektronenresonanzsystem bilden. Der erste Ring (Pfeil) wird von Glycin 67 und Threonin 65<br />
gebildet, deren Zyklisierungsreaktion vom Protein selbst katalysiert wird. Tyrosin 66 bildet den zweiten<br />
Ring [VV05].<br />
Abbildung 3.1.2.: (A) Anregungs- und (B) Emissionsspektren der fluoreszenten Proteine: blau (BFP),<br />
cyan (CFP), grün (GFP), gelb (YFP) und rot (mRFP1) [LSP03].<br />
26