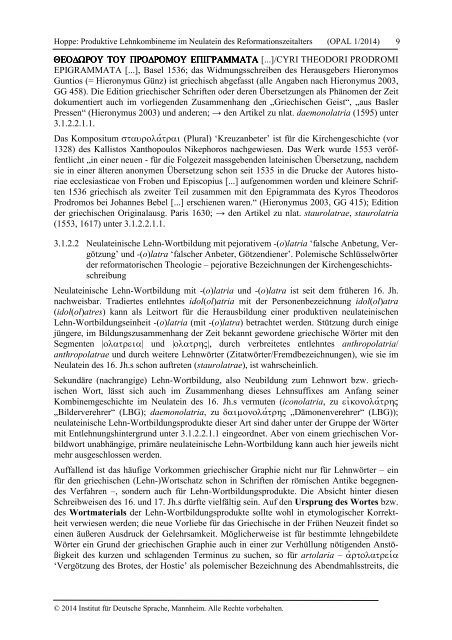Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hoppe: Produktive Lehnkombineme im Neulatein <strong>des</strong> Reformationszeitalters (OPAL 1/2014)<br />
9<br />
JEODVROU TOU PRODROMOU EPIGRAMMATA [...]/CYRI THEODORI PRODROMI<br />
EPIGRAMMATA [...], Basel 1536; das Widmungsschreiben <strong>des</strong> Herausgebers Hieronymos<br />
Guntios (= Hieronymus Günz) ist griechisch abgefasst (alle Angaben nach Hieronymus 2003,<br />
GG 458). Die Edition griechischer Schriften oder deren Übersetzungen als Phänomen der Zeit<br />
dokumentiert auch im vorliegenden Zusammenhang den „Griechischen Geist“, „aus Basler<br />
Pressen“ (Hieronymus 2003) und anderen; → den Artikel zu nlat. daemonolatria (1595) unter<br />
3.1.2.2.1.1.<br />
Das Kompositum staurolaßtrai (Plural) ‘Kreuzanbeter’ ist <strong>für</strong> die Kirchengeschichte (vor<br />
1328) <strong>des</strong> Kallistos Xanthopoulos Nikephoros nachgewiesen. Das Werk wurde 1553 veröffentlicht<br />
„in einer neuen - <strong>für</strong> die Folgezeit massgebenden lateinischen Übersetzung, nachdem<br />
sie in einer älteren anonymen Übersetzung schon seit 1535 in die Drucke der Autores historiae<br />
ecclesiasticae von Froben und Episcopius [...] aufgenommen worden und kleinere Schriften<br />
1536 griechisch als zweiter Teil zusammen mit den Epigrammata <strong>des</strong> Kyros Theodoros<br />
Prodromos bei Johannes Bebel [...] erschienen waren.“ (Hieronymus 2003, GG 415); Edition<br />
der griechischen Originalausg. Paris 1630; → den Artikel zu nlat. staurolatrae, staurolatria<br />
(1553, 1617) unter 3.1.2.2.1.1.<br />
3.1.2.2 Neulateinische Lehn-Wortbildung mit pejorativem -(o)latria ‘falsche Anbetung, Vergötzung’<br />
und -(o)latra ‘falscher Anbeter, Götzendiener’. Polemische Schlüsselwörter<br />
der reformatorischen Theologie – pejorative Bezeichnungen der Kirchengeschichtsschreibung<br />
Neulateinische Lehn-Wortbildung mit -(o)latria und -(o)latra ist seit dem früheren 16. Jh.<br />
nachweisbar. Tradiertes entlehntes idol(ol)atria mit der Personenbezeichnung idol(ol)atra<br />
(idol(ol)atres) kann als Leitwort <strong>für</strong> die Herausbildung einer produktiven neulateinischen<br />
Lehn-Wortbildungseinheit -(o)latria (mit -(o)latra) betrachtet werden. Stützung durch einige<br />
jüngere, im Bildungszusammenhang der Zeit bekannt gewordene griechische Wörter mit den<br />
Segmenten |olatreia| und |olatrhw|, durch verbreitetes entlehntes anthropolatria/<br />
anthropolatrae und durch weitere Lehnwörter (Zitatwörter/Fremdbezeichnungen), wie sie im<br />
Neulatein <strong>des</strong> 16. Jh.s schon auftreten (staurolatrae), ist wahrscheinlich.<br />
Sekundäre (nachrangige) Lehn-Wortbildung, also Neubildung zum Lehnwort bzw. griechischen<br />
Wort, lässt sich auch im Zusammenhang dieses Lehnsuffixes am Anfang seiner<br />
Kombinemgeschichte im Neulatein <strong>des</strong> 16. Jh.s vermuten (iconolatria, zu eiökonolaßtrhw<br />
„Bilderverehrer“ (LBG); daemonolatria, zu daimonolaßtrhw „Dämonenverehrer“ (LBG));<br />
neulateinische Lehn-Wortbildungsprodukte dieser Art sind daher unter der Gruppe der Wörter<br />
mit Entlehnungshintergrund unter 3.1.2.2.1.1 eingeordnet. Aber von einem griechischen Vorbildwort<br />
unabhängige, primäre neulateinische Lehn-Wortbildung kann auch hier jeweils nicht<br />
mehr ausgeschlossen werden.<br />
Auffallend ist das häufige Vorkommen griechischer Graphie nicht nur <strong>für</strong> Lehnwörter – ein<br />
<strong>für</strong> den griechischen (Lehn-)Wortschatz schon in Schriften der römischen Antike begegnen<strong>des</strong><br />
Verfahren –, sondern auch <strong>für</strong> Lehn-Wortbildungsprodukte. Die Absicht hinter diesen<br />
Schreibweisen <strong>des</strong> 16. und 17. Jh.s dürfte vielfältig sein. Auf den Ursprung <strong>des</strong> Wortes bzw.<br />
<strong>des</strong> Wortmaterials der Lehn-Wortbildungsprodukte sollte wohl in etymologischer Korrektheit<br />
verwiesen werden; die neue Vorliebe <strong>für</strong> das Griechische in der Frühen Neuzeit findet so<br />
einen äußeren Ausdruck der Gelehrsamkeit. Möglicherweise ist <strong>für</strong> bestimmte lehngebildete<br />
Wörter ein Grund der griechischen Graphie auch in einer zur Verhüllung nötigenden Anstößigkeit<br />
<strong>des</strong> kurzen und schlagenden Terminus zu suchen, so <strong>für</strong> artolaria – aörtolatreißa<br />
‘Vergötzung <strong>des</strong> Brotes, der Hostie’ als polemischer Bezeichnung <strong>des</strong> Abendmahlsstreits, die<br />
© 2014 <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten.