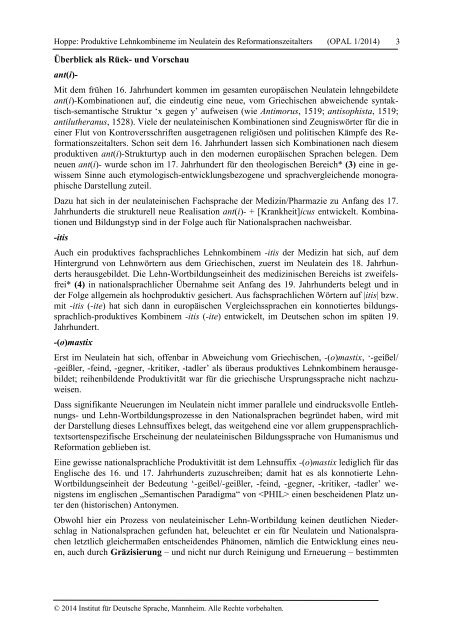Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hoppe: Produktive Lehnkombineme im Neulatein <strong>des</strong> Reformationszeitalters (OPAL 1/2014)<br />
3<br />
Überblick als Rück- und Vorschau<br />
ant(i)-<br />
Mit dem frühen 16. Jahrhundert kommen im gesamten europäischen Neulatein lehngebildete<br />
ant(i)-Kombinationen auf, die eindeutig eine neue, vom Griechischen abweichende syntaktisch-semantische<br />
Struktur ‘x gegen y’ aufweisen (wie Antimorus, 1519; antisophista, 1519;<br />
antilutheranus, 1528). Viele der neulateinischen Kombinationen sind Zeugniswörter <strong>für</strong> die in<br />
einer Flut von Kontroversschriften ausgetragenen religiösen und politischen Kämpfe <strong>des</strong> Reformationszeitalters.<br />
Schon seit dem 16. Jahrhundert lassen sich Kombinationen nach diesem<br />
produktiven ant(i)-Strukturtyp auch in den modernen europäischen Sprachen belegen. Dem<br />
neuen ant(i)- wurde schon im 17. Jahrhundert <strong>für</strong> den theologischen Bereich* (3) eine in gewissem<br />
Sinne auch etymologisch-entwicklungsbezogene und sprachvergleichende monographische<br />
Darstellung zuteil.<br />
Dazu hat sich in der neulateinischen Fachsprache der Medizin/Pharmazie zu Anfang <strong>des</strong> 17.<br />
Jahrhunderts die strukturell neue Realisation ant(i)- + [Krankheit]icus entwickelt. Kombinationen<br />
und Bildungstyp sind in der Folge auch <strong>für</strong> Nationalsprachen nachweisbar.<br />
-itis<br />
Auch ein produktives fachsprachliches Lehnkombinem -itis der Medizin hat sich, auf dem<br />
Hintergrund von Lehnwörtern aus dem Griechischen, zuerst im Neulatein <strong>des</strong> 18. Jahrhunderts<br />
herausgebildet. Die Lehn-Wortbildungseinheit <strong>des</strong> medizinischen Bereichs ist zweifelsfrei*<br />
(4) in nationalsprachlicher Übernahme seit Anfang <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts belegt und in<br />
der Folge allgemein als hochproduktiv gesichert. Aus fachsprachlichen Wörtern auf |itis| bzw.<br />
mit -itis (-ite) hat sich dann in europäischen Vergleichssprachen ein konnotiertes bildungssprachlich-produktives<br />
Kombinem -itis (-ite) entwickelt, im Deutschen schon im späten 19.<br />
Jahrhundert.<br />
-(o)mastix<br />
Erst im Neulatein hat sich, offenbar in Abweichung vom Griechischen, -(o)mastix‚ ‘-geißel/<br />
-geißler, -feind, -gegner, -kritiker, -tadler’ als überaus produktives Lehnkombinem herausgebildet;<br />
reihenbildende Produktivität war <strong>für</strong> die griechische Ursprungssprache nicht nachzuweisen.<br />
Dass signifikante Neuerungen im Neulatein nicht immer parallele und eindrucksvolle Entlehnungs-<br />
und Lehn-Wortbildungsprozesse in den Nationalsprachen begründet haben, wird mit<br />
der Darstellung dieses Lehnsuffixes belegt, das weitgehend eine vor allem gruppensprachlichtextsortenspezifische<br />
Erscheinung der neulateinischen Bildungssprache von Humanismus und<br />
Reformation geblieben ist.<br />
Eine gewisse nationalsprachliche Produktivität ist dem Lehnsuffix -(o)mastix lediglich <strong>für</strong> das<br />
Englische <strong>des</strong> 16. und 17. Jahrhunderts zuzuschreiben; damit hat es als konnotierte Lehn-<br />
Wortbildungseinheit der Bedeutung ‘-geißel/-geißler, -feind, -gegner, -kritiker, -tadler’ wenigstens<br />
im englischen „Semantischen Paradigma“ von einen bescheidenen Platz unter<br />
den (historischen) Antonymen.<br />
Obwohl hier ein Prozess von neulateinischer Lehn-Wortbildung keinen deutlichen Niederschlag<br />
in Nationalsprachen gefunden hat, beleuchtet er ein <strong>für</strong> Neulatein und Nationalsprachen<br />
letztlich gleichermaßen entscheiden<strong>des</strong> Phänomen, nämlich die Entwicklung eines neuen,<br />
auch durch Gräzisierung – und nicht nur durch Reinigung und Erneuerung – bestimmten<br />
© 2014 <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten.