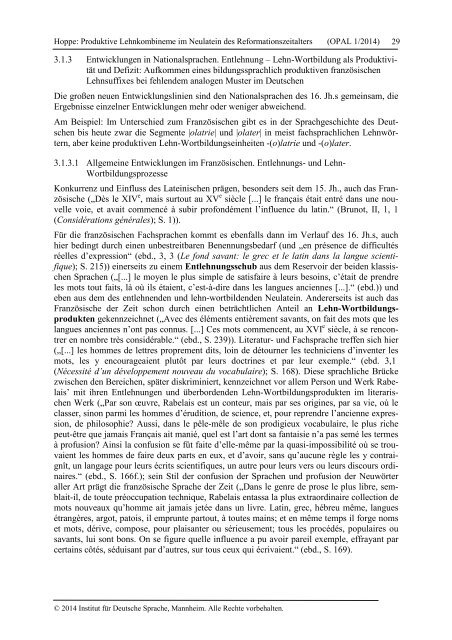Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hoppe: Produktive Lehnkombineme im Neulatein <strong>des</strong> Reformationszeitalters (OPAL 1/2014)<br />
29<br />
3.1.3 Entwicklungen in Nationalsprachen. Entlehnung – Lehn-Wortbildung als Produktivität<br />
und Defizit: Aufkommen eines bildungssprachlich produktiven französischen<br />
Lehnsuffixes bei fehlendem analogen Muster im Deutschen<br />
Die großen neuen Entwicklungslinien sind den Nationalsprachen <strong>des</strong> 16. Jh.s gemeinsam, die<br />
Ergebnisse einzelner Entwicklungen mehr oder weniger abweichend.<br />
Am Beispiel: Im Unterschied zum Französischen gibt es in der Sprachgeschichte <strong>des</strong> Deutschen<br />
bis heute zwar die Segmente |olatrie| und |olater| in meist fachsprachlichen Lehnwörtern,<br />
aber keine produktiven Lehn-Wortbildungseinheiten -(o)latrie und -(o)later.<br />
3.1.3.1 Allgemeine Entwicklungen im Französischen. Entlehnungs- und Lehn-<br />
Wortbildungsprozesse<br />
Konkurrenz und Einfluss <strong>des</strong> Lateinischen prägen, besonders seit dem 15. Jh., auch das Französische<br />
(„Dès le XIV e , mais surtout au XV e siècle [...] le français était entré dans une nouvelle<br />
voie, et avait commencé à subir profondément l’influence du latin.“ (Brunot, II, 1, 1<br />
(Considérations générales); S. 1)).<br />
Für die französischen Fachsprachen kommt es ebenfalls dann im Verlauf <strong>des</strong> 16. Jh.s, auch<br />
hier bedingt durch einen unbestreitbaren Benennungsbedarf (und „en présence de difficultés<br />
réelles d’expression“ (ebd., 3, 3 (Le fond savant: le grec et le latin dans la langue scientifique);<br />
S. 215)) einerseits zu einem Entlehnungsschub aus dem Reservoir der beiden klassischen<br />
Sprachen („[...] le moyen le plus simple de satisfaire à leurs besoins, c’était de prendre<br />
les mots tout faits, là où ils étaient, c’est-à-dire dans les langues anciennes [...].“ (ebd.)) und<br />
eben aus dem <strong>des</strong> entlehnenden und lehn-wortbildenden Neulatein. Andererseits ist auch das<br />
Französische der Zeit schon durch einen beträchtlichen Anteil an Lehn-Wortbildungsprodukten<br />
gekennzeichnet („Avec <strong>des</strong> éléments entièrement savants, on fait <strong>des</strong> mots que les<br />
langues anciennes n’ont pas connus. [...] Ces mots commencent, au XVI e siècle, à se rencontrer<br />
en nombre très considérable.“ (ebd., S. 239)). Literatur- und Fachsprache treffen sich hier<br />
(„[...] les hommes de lettres proprement dits, loin de détourner les techniciens d’inventer les<br />
mots, les y encourageaient plutôt par leurs doctrines et par leur exemple.“ (ebd. 3,1<br />
(Nécessité d’un développement nouveau du vocabulaire); S. 168). <strong>Diese</strong> sprachliche Brücke<br />
zwischen den Bereichen, später diskriminiert, kennzeichnet vor allem Person und Werk Rabelais’<br />
mit ihren Entlehnungen und überbordenden Lehn-Wortbildungsprodukten im literarischen<br />
Werk („Par son œuvre, Rabelais est un conteur, mais par ses origines, par sa vie, où le<br />
classer, sinon parmi les hommes d’érudition, de science, et, pour reprendre l’ancienne expression,<br />
de philosophie? Aussi, dans le pêle-mêle de son prodigieux vocabulaire, le plus riche<br />
peut-être que jamais Français ait manié, quel est l’art dont sa fantaisie n’a pas semé les termes<br />
à profusion? Ainsi la confusion se fût faite d’elle-même par la quasi-impossibilité où se trouvaient<br />
les hommes de faire deux parts en eux, et d’avoir, sans qu’aucune règle les y contraignît,<br />
un langage pour leurs écrits scientifiques, un autre pour leurs vers ou leurs discours ordinaires.“<br />
(ebd., S. 166f.); sein Stil der confusion der Sprachen und profusion der Neuwörter<br />
aller Art prägt die französische Sprache der Zeit („Dans le genre de prose le plus libre, semblait-il,<br />
de toute préoccupation technique, Rabelais entassa la plus extraordinaire collection de<br />
mots nouveaux qu’homme ait jamais jetée dans un livre. Latin, grec, hébreu même, langues<br />
étrangères, argot, patois, il emprunte partout, à toutes mains; et en même temps il forge noms<br />
et mots, dérive, compose, pour plaisanter ou sérieusement; tous les procédés, populaires ou<br />
savants, lui sont bons. On se figure quelle influence a pu avoir pareil exemple, effrayant par<br />
certains côtés, séduisant par d’autres, sur tous ceux qui écrivaient.“ (ebd., S. 169).<br />
© 2014 <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten.