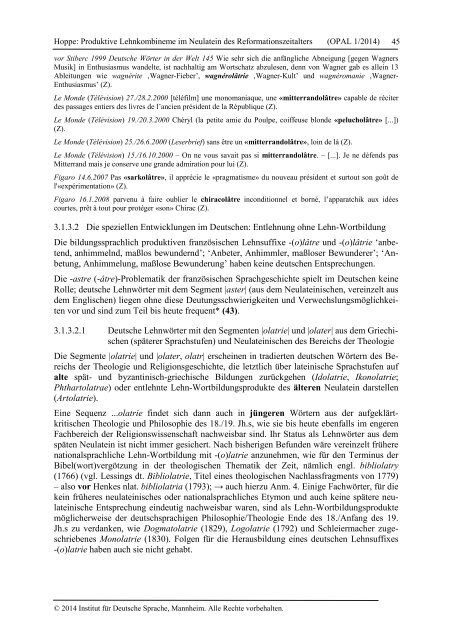Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Hoppe: Produktive Lehnkombineme im Neulatein <strong>des</strong> Reformationszeitalters (OPAL 1/2014)<br />
45<br />
vor Stiberc 1999 Deutsche Wörter in der Welt 145 Wie sehr sich die anfängliche Abneigung [gegen Wagners<br />
Musik] in Enthusiasmus wandelte, ist nachhaltig am Wortschatz abzulesen, denn von Wagner gab es allein 13<br />
Ableitungen wie wagnérite ‚Wagner-Fieber’, wagnérolâtrie ‚Wagner-Kult’ und wagnéromanie ‚Wagner-<br />
Enthusiasmus’ (Z).<br />
Le Monde (Télévision) 27./28.2.2000 [téléfilm] une monomaniaque, une «mitterrandolâtre» capable de réciter<br />
<strong>des</strong> passages entiers <strong>des</strong> livres de l’ancien président de la République (Z).<br />
Le Monde (Télévision) 19./20.3.2000 Chéryl (la petite amie du Poulpe, coiffeuse blonde «pelucholâtre» [...])<br />
(Z).<br />
Le Monde (Télévision) 25./26.6.2000 (Leserbrief) sans être un «mitterrandolâtre», loin de là (Z).<br />
Le Monde (Télévision) 15./16.10.2000 – On ne vous savait pas si mitterrandolâtre. – [...]. Je ne défends pas<br />
Mitterrand mais je conserve une grande admiration pour lui (Z).<br />
Figaro 14.6.2007 Pas «sarkolâtre», il apprécie le «pragmatisme» du nouveau président et surtout son goût de<br />
l'«expérimentation» (Z).<br />
Figaro 16.1.2008 parvenu à faire oublier le chiracolâtre inconditionnel et borné, l’apparatchik aux idées<br />
courtes, prêt à tout pour protéger «son» Chirac (Z).<br />
3.1.3.2 Die speziellen Entwicklungen im Deutschen: Entlehnung ohne Lehn-Wortbildung<br />
Die bildungssprachlich produktiven französischen Lehnsuffixe -(o)lâtre und -(o)lâtrie ‘anbetend,<br />
anhimmelnd, maßlos bewundernd’; ‘Anbeter, Anhimmler, maßloser Bewunderer’; ‘Anbetung,<br />
Anhimmelung, maßlose Bewunderung’ haben keine deutschen Entsprechungen.<br />
Die -astre (-âtre)-Problematik der französischen Sprachgeschichte spielt im Deutschen keine<br />
Rolle; deutsche Lehnwörter mit dem Segment |aster| (aus dem Neulateinischen, vereinzelt aus<br />
dem Englischen) liegen ohne diese Deutungsschwierigkeiten und Verwechslungsmöglichkeiten<br />
vor und sind zum Teil bis heute frequent* (43).<br />
3.1.3.2.1 Deutsche Lehnwörter mit den Segmenten |olatrie| und |olater| aus dem Griechischen<br />
(späterer Sprachstufen) und Neulateinischen <strong>des</strong> Bereichs der Theologie<br />
Die Segmente |olatrie| und |olater, olatr| erscheinen in tradierten deutschen Wörtern <strong>des</strong> Bereichs<br />
der Theologie und Religionsgeschichte, die letztlich über lateinische Sprachstufen auf<br />
alte spät- und byzantinisch-griechische Bildungen zurückgehen (Idolatrie, Ikonolatrie;<br />
Phthartolatrae) oder entlehnte Lehn-Wortbildungsprodukte <strong>des</strong> älteren Neulatein darstellen<br />
(Artolatrie).<br />
Eine Sequenz ...olatrie findet sich dann auch in jüngeren Wörtern aus der aufgeklärtkritischen<br />
Theologie und Philosophie <strong>des</strong> 18./19. Jh.s, wie sie bis heute ebenfalls im engeren<br />
Fachbereich der Religionswissenschaft nachweisbar sind. Ihr Status als Lehnwörter aus dem<br />
späten Neulatein ist nicht immer gesichert. Nach bisherigen Befunden wäre vereinzelt frühere<br />
nationalsprachliche Lehn-Wortbildung mit -(o)latrie anzunehmen, wie <strong>für</strong> den Terminus der<br />
Bibel(wort)vergötzung in der theologischen Thematik der Zeit, nämlich engl. bibliolatry<br />
(1766) (vgl. Lessings dt. Bibliolatrie, Titel eines theologischen Nachlassfragments von 1779)<br />
– also vor Henkes nlat. bibliolatria (1793); → auch hierzu Anm. 4. Einige Fachwörter, <strong>für</strong> die<br />
kein früheres neulateinisches oder nationalsprachliches Etymon und auch keine spätere neulateinische<br />
Entsprechung eindeutig nachweisbar waren, sind als Lehn-Wortbildungsprodukte<br />
möglicherweise der deutschsprachigen Philosophie/Theologie Ende <strong>des</strong> 18./Anfang <strong>des</strong> 19.<br />
Jh.s zu verdanken, wie Dogmatolatrie (1829), Logolatrie (1792) und Schleiermacher zugeschriebenes<br />
Monolatrie (1830). Folgen <strong>für</strong> die Herausbildung eines deutschen Lehnsuffixes<br />
-(o)latrie haben auch sie nicht gehabt.<br />
© 2014 <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten.