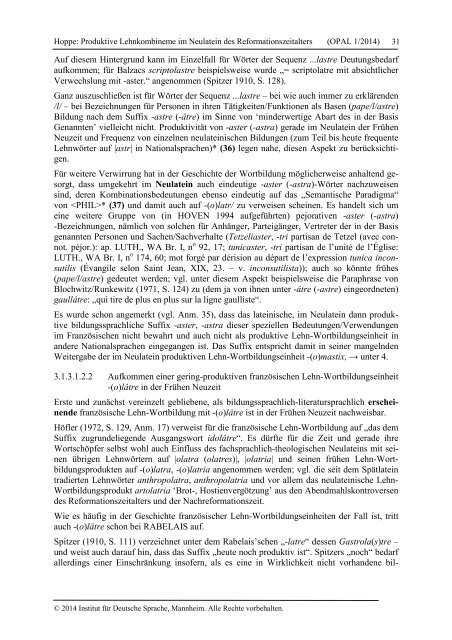Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Diese Nummer anzeigen - Veröffentlichungen des IDS - Institut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hoppe: Produktive Lehnkombineme im Neulatein <strong>des</strong> Reformationszeitalters (OPAL 1/2014)<br />
31<br />
Auf diesem Hintergrund kann im Einzelfall <strong>für</strong> Wörter der Sequenz ...lastre Deutungsbedarf<br />
aufkommen; <strong>für</strong> Balzacs scriptolastre beispielsweise wurde „= scriptolatre mit absichtlicher<br />
Verwechslung mit -aster.“ angenommen (Spitzer 1910, S. 128).<br />
Ganz auszuschließen ist <strong>für</strong> Wörter der Sequenz ...lastre – bei wie auch immer zu erklärenden<br />
/l/ – bei Bezeichnungen <strong>für</strong> Personen in ihren Tätigkeiten/Funktionen als Basen (pape/l/astre)<br />
Bildung nach dem Suffix -astre (-âtre) im Sinne von ‘minderwertige Abart <strong>des</strong> in der Basis<br />
Genannten’ vielleicht nicht. Produktivität von -aster (-astra) gerade im Neulatein der Frühen<br />
Neuzeit und Frequenz von einzelnen neulateinischen Bildungen (zum Teil bis heute frequente<br />
Lehnwörter auf |astr| in Nationalsprachen)* (36) legen nahe, diesen Aspekt zu berücksichtigen.<br />
Für weitere Verwirrung hat in der Geschichte der Wortbildung möglicherweise anhaltend gesorgt,<br />
dass umgekehrt im Neulatein auch eindeutige -aster (-astra)-Wörter nachzuweisen<br />
sind, deren Kombinationsbedeutungen ebenso eindeutig auf das „Semantische Paradigma“<br />
von * (37) und damit auch auf -(o)latr/ zu verweisen scheinen. Es handelt sich um<br />
eine weitere Gruppe von (in HOVEN 1994 aufgeführten) pejorativen -aster (-astra)<br />
-Bezeichnungen, nämlich von solchen <strong>für</strong> Anhänger, Parteigänger, Vertreter der in der Basis<br />
genannten Personen und Sachen/Sachverhalte (Tetzeliaster, -tri partisan de Tetzel (avec connot.<br />
péjor.): ap. LUTH., WA Br. I, n o 92, 17; tunicaster, -tri partisan de l’unité de l’Église:<br />
LUTH., WA Br. I, n o 174, 60; mot forgé par dérision au départ de l’expression tunica inconsutilis<br />
(Évangile selon Saint Jean, XIX, 23. – v. inconsutilista)); auch so könnte frühes<br />
(pape/l/astre) gedeutet werden; vgl. unter diesem Aspekt beispielsweise die Paraphrase von<br />
Blochwitz/Runkewitz (1971, S. 124) zu (dem ja von ihnen unter -âtre (-astre) eingeordneten)<br />
gaullâtre: „qui tire de plus en plus sur la ligne gaulliste“.<br />
Es wurde schon angemerkt (vgl. Anm. 35), dass das lateinische, im Neulatein dann produktive<br />
bildungssprachliche Suffix -aster, -astra dieser speziellen Bedeutungen/Verwendungen<br />
im Französischen nicht bewahrt und auch nicht als produktive Lehn-Wortbildungseinheit in<br />
andere Nationalsprachen eingegangen ist. Das Suffix entspricht damit in seiner mangelnden<br />
Weitergabe der im Neulatein produktiven Lehn-Wortbildungseinheit -(o)mastix, → unter 4.<br />
3.1.3.1.2.2 Aufkommen einer gering-produktiven französischen Lehn-Wortbildungseinheit<br />
-(o)lâtre in der Frühen Neuzeit<br />
Erste und zunächst vereinzelt gebliebene, als bildungssprachlich-literatursprachlich erscheinende<br />
französische Lehn-Wortbildung mit -(o)lâtre ist in der Frühen Neuzeit nachweisbar.<br />
Höfler (1972, S. 129, Anm. 17) verweist <strong>für</strong> die französische Lehn-Wortbildung auf „das dem<br />
Suffix zugrundeliegende Ausgangswort idolâtre“. Es dürfte <strong>für</strong> die Zeit und gerade ihre<br />
Wortschöpfer selbst wohl auch Einfluss <strong>des</strong> fachsprachlich-theologischen Neulateins mit seinen<br />
übrigen Lehnwörtern auf |olatra (olatres)|, |olatria| und seinen frühen Lehn-Wortbildungsprodukten<br />
auf -(o)latra, -(o)latria angenommen werden; vgl. die seit dem Spätlatein<br />
tradierten Lehnwörter anthropolatra, anthropolatria und vor allem das neulateinische Lehn-<br />
Wortbildungsprodukt artolatria ‘Brot-, Hostienvergötzung’ aus den Abendmahlskontroversen<br />
<strong>des</strong> Reformationszeitalters und der Nachreformationszeit.<br />
Wie es häufig in der Geschichte französischer Lehn-Wortbildungseinheiten der Fall ist, tritt<br />
auch -(o)lâtre schon bei RABELAIS auf.<br />
Spitzer (1910, S. 111) verzeichnet unter dem Rabelais’schen „-latre“ <strong>des</strong>sen Gastrola(s)tre –<br />
und weist auch darauf hin, dass das Suffix „heute noch produktiv ist“. Spitzers „noch“ bedarf<br />
allerdings einer Einschränkung insofern, als es eine in Wirklichkeit nicht vorhandene bil-<br />
© 2014 <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Deutsche Sprache, Mannheim. Alle Rechte vorbehalten.