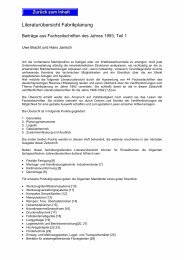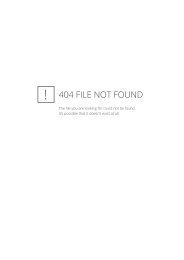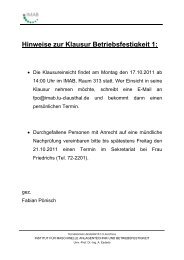Literaturübersicht "Fabrikplanung 1982"
Literaturübersicht "Fabrikplanung 1982"
Literaturübersicht "Fabrikplanung 1982"
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Damit können im Rahmen der Wertverbesserung Rationalisierungsaufgaben wie<br />
Materialflußoptimierung, Verkettung von Fertigungseinrichtungen und Bestandsreduzierungen, aber<br />
auch Neuentwicklungen (jetzt: Wertgestaltung) analysiert und kostenmäßig optimiert werden. Auf die<br />
Erfassung und Analyse von Materialflußkosten geht Dreger [94] ein. Diese gewöhnlich in den<br />
Gemeinkosten versteckten Kostenanteile bieten erhebliche Rationalisierungsreserven. Voraussetzung<br />
für deren Nutzung ist allerdings eine systematische Durchdringung der Kostenstruktur. Der Verfasser<br />
liefert Ansätze hierzu. In diesem Zusammenhang ist auch der Beitrag von Männel / Weber [95] zu<br />
erwähnen, in dem über erste Ergebnisse bei der Konzeption einer entscheidungsorientierten<br />
Logistikkostenrechnung berichtet wird. Diese Kostenrechnungssystematik soll den Betrieb vor allem<br />
bei der Steuerung logistischer Abläufe unterstützen.<br />
Abschließend soll auf den Beitrag von Müller / Bünsow [96] aufmerksam gemacht werden, der<br />
Möglichkeiten der Bewertung verschiedener Transportarten im außerbetrieblichen Materialflußbereich<br />
aufzeigt. Zur Berücksichtigung der nichtquantifizierbaren Einflüsse setzen die Verfasser die<br />
Nutzungsanalyse ein. Eine Kostenvergleichsrechnung kann in die Nutzwertanalyse einfließen oder<br />
aber als zusätzliches Entscheidungskriterium gesondert erstellt und ausgewiesen werden.<br />
5.3. Bausteine anforderungsgerechter Materialflußsysteme [97-150]<br />
Jeder Materialfluß ist letztlich nur so gut wie die Komponenten des Systems, mittels derer die<br />
Materialflußplanung und -optimierung realisiert wird. Im folgenden wird deshalb auf Veröffentlichungen<br />
aufmerksam gemacht, die über Tendenzen, neue Entwicklungen, aber auch über Bewährtes berichten.<br />
Einen hervorragenden Überblick über den derzeitigen Stand der Materialflußtechnik gab die<br />
letztjährige Hannover-Messe im Rahmen des neu geschaffenen "Weltzentrum für Materialfluß und<br />
Transport (CEMAT)". Gezeigt wurden Teil- und Gesamtlösungen für förder- und lagertechnische<br />
Betriebsaufgaben. Schwerpunkte zeigen die Messeberichte von [97-99]. In allen Beiträgen kommt<br />
deutlich zum Ausdruck, daß die Hersteller materialflußtechnischer Komponenten eindeutig auf<br />
Automatisierung und systemtechnisch orientierte Problemlösungen setzen. Weitere beispielhafte<br />
Systemkomponenten finden sich in [100]. Eine Übersicht über grundsätzlich mögliche<br />
Horizontalfördersysteme gibt Fraissl [101], der insbesondere auf Auswahlkriterien und Rahmendaten<br />
eingeht.<br />
Im Zuge der Automatisierungstendenzen gilt ein besonderes Augenmerk der Steuerung komplexer<br />
Materialflußsysteme. Die Qualität der Steuerelemente beeinflußt nachhaltig Funktionssicherheit und<br />
Zuverlässigkeit. Dies gilt sowohl für Hardware- wie auch für Software-Lösungen. Zum Stand der<br />
Technik informiert auch hier ein Messebericht l102]. Begünstigt durch die rasche Entwicklung auf dem<br />
Gebiet der Festkörper- und Computertechnologie sind in der jüngsten Zeit erstaunliche Fortschritte<br />
erzielt worden. Dieser Trend wird sich bei der augenblicklich zu beobachtenden Tendenz zu sinkenden<br />
Preisen für Elektronik- und Computer-Hardware, zu einer vergrößerten Herstellerauswahl und einer<br />
interessanten Entwicklung beim derzeitigen Angebot an kompatiblen Peripheriegeräten zweifellos<br />
fortsetzen. Wie Spooner [103] ausführt, liegt die Zukunft der Förderanlagensteuerung im Einsatz von<br />
programmierbaren Steuerungen, Mikroprozessoren und Minicomputern. Die weitgehend vollzogene<br />
Ablösung der großvolumigen Relais-Schaltschütze durch miniaturisierte Steuerelemente mit freier<br />
Schaltlogik ist hierfür ein guter Beleg. Über Bauelemente für die direkte und indirekte Zielsteuerung bei<br />
Stetigförderanlagen berichten Mehling / Freissl [104]. Es werden sowohl konventionelle Steuerarten<br />
wie Nocken- und Codierstiftsteuerungen als auch intelligente Steuerelemente wie Mikroprozessoren<br />
angesprochen. Am Beispiel einer Steuerung für die Fahrgeschwindigkeit eines Fiurförderzeuges<br />
verdeutlicht Stuhr [105], daß ein Steuersystem nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern daß der<br />
die Steuerung betätigende Mensch mit den für ihn optimalen Bewegungen und Kräften ebenso zu<br />
berücksichtigen ist wie das Antriebssystem und die Aufgabe des Fahrzeuges.<br />
Auch auf der Software-Seite ist vor allem durch den verstärkten Einsatz von Rechneranlagen ein<br />
deutlicher Automatisierungsfortschritt zu verzeichnen. Komfortable Rechenprogramme übernehmen<br />
wesentliche Steuerfunktionen der Transport- und Förderprozesse und erlauben eine deutliche<br />
Effektivierung des Materialflusses bei gleichzeitig maßgeblicher Kostensenkung [106]. Dabei muß sich<br />
der Anwender allerdings rechtzeitig über den Umstand unterrichten, daß die Aufbaustruktur komplexer<br />
Steuerungssysteme erhebliche Anforderungen an den Betrieb stellt. Hier geht die Tendenz eindeutig<br />
zu dezentral organisierten, aus weitgehend unabhängigen, logisch in sich geschlossenen Modul-<br />
Konzeptionen [107]. Ein interessantes Beispiel aus dem Hüttenwerksbereich zeigt Schmallenbach<br />
[108]. Durch den Einsatz eines neuentwickelten, mikrocomputergestützten Dispositionstableaus wurde<br />
eine optimale Transportsteuerung erreicht und damit die Vorbedingung für einen wesentlich