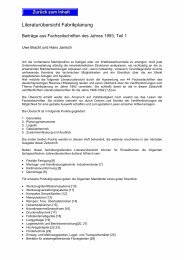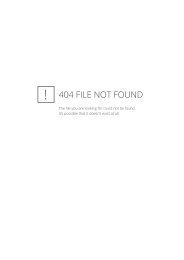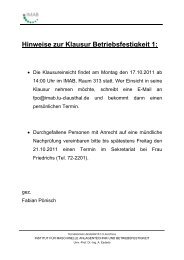Literaturübersicht "Fabrikplanung 1982"
Literaturübersicht "Fabrikplanung 1982"
Literaturübersicht "Fabrikplanung 1982"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
einer Änderung im Flächennutzungsplan plötzlich anstatt im ausgewiesenen Industriegebiet<br />
unmittelbar am Rande eines Wohngebietes befindet.<br />
Galt bislang das städtebauliche Leitbild der Funktionstrennung als nahezu unantastbar, beginnt jetzt, u.<br />
a. aufgrund der geschilderten Problematik, ein Umdenkprozeß. Seit kurzem wird im Ruhrgebiet die<br />
Planungspolitik durch die Begriffe "Standortsicherung" und "Sanierung am Standort'' geprägt. Damit<br />
soll der Grundsatz der räumlichen Trennung durch das Leitbild des "geregelten Flebeneinander,<br />
abgelöst werden. Hier setzt der Beitrag von Reiß-Schmidt [47] ein. Nach eingehender und kritischer<br />
Betrachtung der relevanten Faktoren kommt der Verfasser zu der Schlußfolgerung, daß die veränderte<br />
Zielsetzung der kommunalen Planungspolitik dem geschrumpften Handlungsspielraum der<br />
Verantwortlichen noch am ehesten gerecht wird. Gleichzeitig wird jedoch eine hohe Disziplin aller<br />
Beteiligten gefordert, da durch das räumliche Aneinanderrücken von Industrie und Wohnzonen<br />
zweifellos ein höchst sensibler Bereich geschaffen wird.<br />
Geeignete Maßnahmen und Vorgehensweisen zur Überwindung dieser Problematik zeigen Sommer /<br />
Ulich / Polek [48] auf. Berichtet wird über die Eingliederung eines drucktechnischen Industriebetriebes<br />
in eine Schlafstadt. Die Planer waren sich bereits frühzeitig im klaren darüber, daß die unmittelbare<br />
Nähe zu Wohnbauten eine umfassende Aufklärung, möglichst eine Einbeziehung der betroffenen<br />
Anwohner in den Planungsprozeß, erforderte. Im Rahmen einer umfassenden<br />
Standortplanungsstrategie gelang die "Eingemeindung" des Betriebes am Standort, indem den<br />
Anwohnern u. a. ein begrenztes Mitgestaltungsrecht am Bauwerksäußeren eingeräumt wurde.<br />
Auf die große Bedeutung der Bauwerksgestaltung als Ansatzpunkt einer Akzeptanz seitens des<br />
Menschen gegenüber seiner industriellen Umwelt geht auch Heene [49] ein, der feststellt, daß Bauten<br />
mit "kathedralen" Dimensionen absolut ungeeignet sind, soll sich vor allem der Arbeiter in seiner Fabrik<br />
wohlfühlen. Beleuchtet werden einige spezifische Ausführungsarten von Industrie- und<br />
Gewerbebauten, wobei von Interesse ist, daß bereits eine geschickte Farbgebung wesentlich dazu<br />
beitragen kann, daß sich großvolumige Bauwerke vorteilhafter in das städtebauliche Bild einfügen.<br />
Mit fertigungstechnologischen, energetischen und materiellen Einflüssen auf den modernen<br />
Industriebau setzt sich Rüpprich [50] auseinander. Bezüglich der technischen Entwicklungsprozesse,<br />
die vor allem die Fertigung und Arbeitsplatzgestaltung beeinflussen, sieht der Verfasser keine<br />
negativen Auswirkungen. Vielmehr wird sich nach seiner Ansicht eine bessere Verträglichkeit von<br />
Industrie und Stadt ergeben. Ähnliches gilt für die weiteren genannten Einflüsse. Hieraus wird eine<br />
Vielzahl von vor allem die bautechnischen Standortaspekte betreffenden Schlußfolgerungen<br />
abgeleitet. Außerdem wird auf die Notwendigkeit einer umfassenden Bearbeitung der technischen und<br />
gestalterischen Verflechtung von der gegenständlichen Umwelt bis hin zum Arbeitsplatz aufmerksam<br />
gemacht. Die Berücksichtigung der Umwelt im Rahmen des eigentlichen Bauprozesses wird von<br />
Schoß / Heinecke [51] angesprochen.<br />
Ein wichtiger Gesichtspunkt jeder Standortplanung ist die Qualität des Standortes für die potentiellen<br />
Arbeitnehmer. Dabei spielen zahlreiche Einzelfaktoren in die individuelle Beurteilung hinein. Gezielte<br />
Befragungen der Bevölkerung können hier interessante Aufschlüsse für die künftige<br />
Stadtentwicklungsplanung geben. Über eine derartige Untersuchung in der DDR berichtet Schulz [52].<br />
Von Interesse auch für die Bundesrepublik ist das Einzelergebnis, das mit zunehmender Stadtgröße<br />
gesellschaftliche und kulturelle Einrichtungen weniger von der Wohnung aus, sondern verstärkt auf<br />
dem Weg vom Arbeitsplatz zur Wohnung, also nach Arbeitsende, aufgesucht werden.<br />
Ein ständig aktuelles Problem ist die Standortoptimierung von Distributionszentren. Da<br />
Produktionsstätten im allgemeinen nicht wirtschaftlich aufgelöst und an anderer Stelle neu aufgebaut<br />
werden können, konzentrieren sich diese Überlegungen auf den Bereich der Warenverteilung. Am<br />
Beispiel eines einstufigen Distributionszentrums beschreibt Wizgall [53] eine einfache und vielseitig<br />
anwendbare Lösung des Standortproblems. Als Optimierungs-kriterium verwendet er die jährliche<br />
Transportleistung, gemessen in Tonnenkilometern pro Jahr. Als Hilfsmittel wurde ein Mikrorechner<br />
eingesetzt, mit dem eine vollständige Enumeration erfolgte. Es werden Möglichkeiten zur Verfeinerung<br />
des Optimierungsverfahrens gezeigt. Ein weiteres Kriterium zur Standortbestimmung von<br />
Warenverteilzentren sind die Distributionskosten. Hiermit beschäftigt sich der Beitrag von Konen [54].<br />
Insbesondere für komplexere Distributionsstrukturen schlägt er den Einsatz von Simulationsmodellen<br />
vor. Damit lassen sich einerseits verschiedene Strukturen auf ihre Wirtschaftlichkeit prüfen.<br />
Andererseits können bei bereits existierenden Distributionsstrukturen die meist vorhandenen<br />
Rationalisierungsreserven aufgespürt werden.