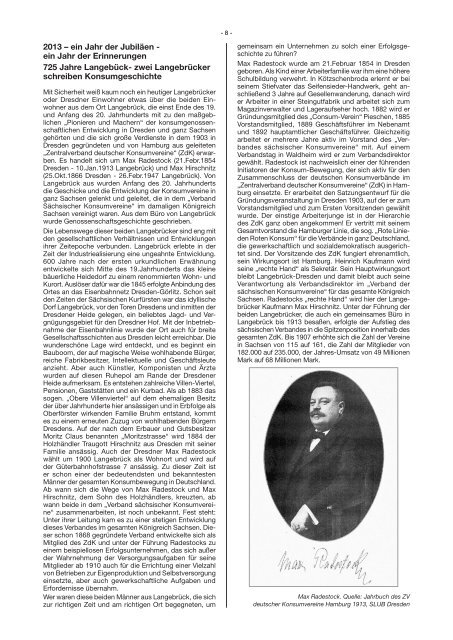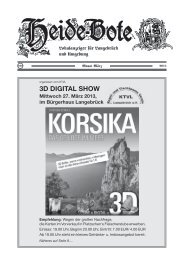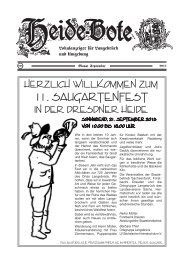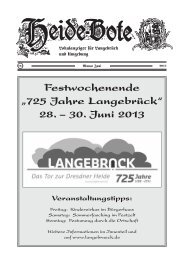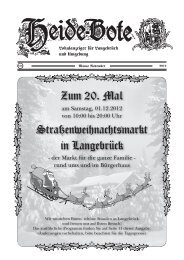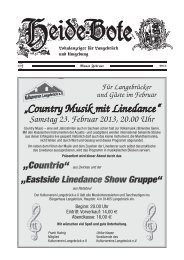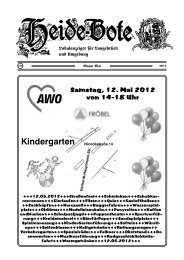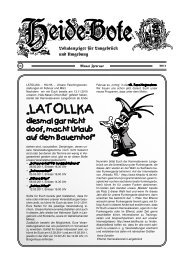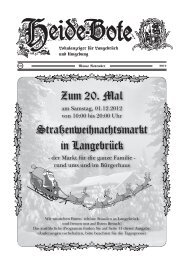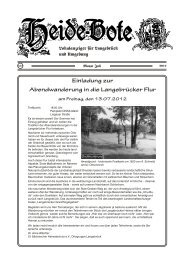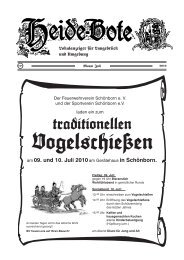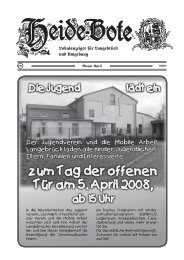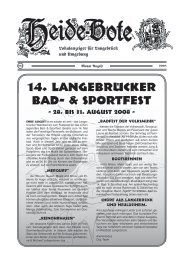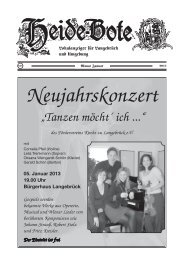download - Langebrück
download - Langebrück
download - Langebrück
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
- 8 -<br />
2013 – ein Jahr der Jubiläen -<br />
ein Jahr der Erinnerungen<br />
725 Jahre Langebück- zwei Langebrücker<br />
schreiben Konsumgeschichte<br />
Mit Sicherheit weiß kaum noch ein heutiger Langebrücker<br />
oder Dresdner Einwohner etwas über die beiden Einwohner<br />
aus dem Ort Langebrück, die einst Ende des 19.<br />
und Anfang des 20. Jahrhunderts mit zu den maßgeblichen<br />
„Pionieren und Machern“ der konsumgenossenschaftlichen<br />
Entwicklung in Dresden und ganz Sachsen<br />
gehörten und die sich große Verdienste in dem 1903 in<br />
Dresden gegründeten und von Hamburg aus geleiteten<br />
„Zentralverband deutscher Konsumvereine“ (ZdK) erwarben.<br />
Es handelt sich um Max Radestock (21.Febr.1854<br />
Dresden - 10.Jan.1913 Langebrück) und Max Hirschnitz<br />
(25.Okt.1866 Dresden - 26.Febr.1947 Langebrück). Von<br />
Langebrück aus wurden Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
die Geschicke und die Entwicklung der Konsumvereine in<br />
ganz Sachsen gelenkt und geleitet, die in dem „Verband<br />
Sächsischer Konsumvereine“ im damaligen Königreich<br />
Sachsen vereinigt waren. Aus dem Büro von Langebrück<br />
wurde Genossenschaftsgeschichte geschrieben.<br />
Die Lebenswege dieser beiden Langebrücker sind eng mit<br />
den gesellschaftlichen Verhältnissen und Entwicklungen<br />
ihrer Zeitepoche verbunden. Langebrück erlebte in der<br />
Zeit der Industriealisierung eine ungeahnte Entwicklung.<br />
600 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung<br />
entwickelte sich Mitte des 19.Jahrhunderts das kleine<br />
bäuerliche Heidedorf zu einem renommierten Wohn- und<br />
Kurort. Auslöser dafür war die 1845 erfolgte Anbindung des<br />
Ortes an das Eisenbahnnetz Dresden-Görlitz. Schon seit<br />
den Zeiten der Sächsischen Kurfürsten war das idyllische<br />
Dorf Langebrück, vor den Toren Dresdens und inmitten der<br />
Dresdener Heide gelegen, ein beliebtes Jagd- und Vergnügungsgebiet<br />
für den Dresdner Hof. Mit der Inbetriebnahme<br />
der Eisenbahnlinie wurde der Ort auch für breite<br />
Gesellschaftsschichten aus Dresden leicht erreichbar. Die<br />
wunderschöne Lage wird entdeckt, und es beginnt ein<br />
Bauboom, der auf magische Weise wohlhabende Bürger,<br />
reiche Fabrikbesitzer, Intellektuelle und Geschäftsleute<br />
anzieht. Aber auch Künstler, Komponisten und Ärzte<br />
wurden auf diesen Ruhepol am Rande der Dresdener<br />
Heide aufmerksam. Es entstehen zahlreiche Villen-Viertel,<br />
Pensionen, Gaststätten und ein Kurbad. Als ab 1883 das<br />
sogen. „Obere Villenviertel“ auf dem ehemaligen Besitz<br />
der über Jahrhunderte hier ansässigen und in Erbfolge als<br />
Oberförster wirkenden Familie Bruhm entstand, kommt<br />
es zu einem erneuten Zuzug von wohlhabenden Bürgern<br />
Dresdens. Auf der nach dem Erbauer und Gutsbesitzer<br />
Moritz Claus benannten „Moritzstrasse“ wird 1884 der<br />
Holzhändler Traugott Hirschnitz aus Dresden mit seiner<br />
Familie ansässig. Auch der Dresdner Max Radestock<br />
wählt um 1900 Langebrück als Wohnort und wird auf<br />
der Güterbahnhofstrasse 7 ansässig. Zu dieser Zeit ist<br />
er schon einer der bedeutendsten und bekanntesten<br />
Männer der gesamten Konsumbewegung in Deutschland.<br />
Ab wann sich die Wege von Max Radestock und Max<br />
Hirschnitz, dem Sohn des Holzhändlers, kreuzten, ab<br />
wann beide in dem „Verband sächsischer Konsumvereine“<br />
zusammenarbeiten, ist noch unbekannt. Fest steht:<br />
Unter ihrer Leitung kam es zu einer stetigen Entwicklung<br />
dieses Verbandes im gesamten Königreich Sachsen. Dieser<br />
schon 1868 gegründete Verband entwickelte sich als<br />
Mitglied des ZdK und unter der Führung Radestocks zu<br />
einem beispiellosen Erfolgsunternehmen, das sich außer<br />
der Wahrnehmung der Versorgungsaufgaben für seine<br />
Mitglieder ab 1910 auch für die Errichtung einer Vielzahl<br />
von Betrieben zur Eigenproduktion und Selbstversorgung<br />
einsetzte, aber auch gewerkschaftliche Aufgaben und<br />
Erfordernisse übernahm.<br />
Wer waren diese beiden Männer aus Langebrück, die sich<br />
zur richtigen Zeit und am richtigen Ort begegneten, um<br />
gemeinsam ein Unternehmen zu solch einer Erfolgsgeschichte<br />
zu führen?<br />
Max Radestock wurde am 21.Februar 1854 in Dresden<br />
geboren. Als Kind einer Arbeiterfamilie war ihm eine höhere<br />
Schulbildung verwehrt. In Kötzschenbroda erlernt er bei<br />
seinem Stiefvater das Seifensieder-Handwerk, geht anschließend<br />
3 Jahre auf Gesellenwanderung, danach wird<br />
er Arbeiter in einer Steingutfabrik und arbeitet sich zum<br />
Magazinverwalter und Lageraufseher hoch. 1882 wird er<br />
Gründungsmitglied des „Consum-Verein“ Pieschen, 1885<br />
Vorstandsmitglied, 1889 Geschäftsführer im Nebenamt<br />
und 1892 hauptamtlicher Geschäftsführer. Gleichzeitig<br />
arbeitet er mehrere Jahre aktiv im Vorstand des „Verbandes<br />
sächsischer Konsumvereine“ mit. Auf einem<br />
Verbandstag in Waldheim wird er zum Verbandsdirektor<br />
gewählt. Radestock ist nachweislich einer der führenden<br />
Initiatoren der Konsum-Bewegung, der sich aktiv für den<br />
Zusammenschluss der deutschen Konsumverbände im<br />
„Zentralverband deutscher Konsumvereine“ (ZdK) in Hamburg<br />
einsetzte. Er erarbeitet den Satzungsentwurf für die<br />
Gründungsveranstaltung in Dresden 1903, auf der er zum<br />
Vorstandsmitglied und zum Ersten Vorsitzenden gewählt<br />
wurde. Der einstige Arbeiterjunge ist in der Hierarchie<br />
des ZdK ganz oben angekommen! Er vertritt mit seinem<br />
Gesamtvorstand die Hamburger Linie, die sog. „Rote Linieden<br />
Roten Konsum“ für die Verbände in ganz Deutschland,<br />
die gewerkschaftlich und sozialdemokratisch ausgerichtet<br />
sind. Der Vorsitzende des ZdK fungiert ehrenamtlich,<br />
sein Wirkungsort ist Hamburg. Heinrich Kaufmann wird<br />
seine „rechte Hand“ als Sekretär. Sein Hauptwirkungsort<br />
bleibt Langebrück-Dresden und damit bleibt auch seine<br />
Verantwortung als Verbandsdirektor im „Verband der<br />
sächsischen Konsumvereine“ für das gesamte Königreich<br />
Sachsen. Radestocks „rechte Hand“ wird hier der Langebrücker<br />
Kaufmann Max Hirschnitz. Unter der Führung der<br />
beiden Langebrücker, die auch ein gemeinsames Büro in<br />
Langebrück bis 1913 besaßen, erfolgte der Aufstieg des<br />
sächsischen Verbandes in die Spitzenposition innerhalb des<br />
gesamten ZdK. Bis 1907 erhöhte sich die Zahl der Vereine<br />
in Sachsen von 115 auf 161, die Zahl der Mitglieder von<br />
182.000 auf 235.000, der Jahres-Umsatz von 49 Millionen<br />
Mark auf 68 Millionen Mark.<br />
Max Radestock. Quelle: Jahrbuch des ZV<br />
deutscher Konsumvereine Hamburg 1913, SLUB Dresden