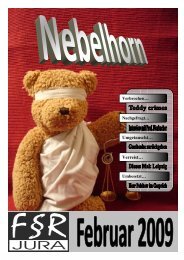Grundzüge der Rechtsphilosophie und der Juristischen Methoden ...
Grundzüge der Rechtsphilosophie und der Juristischen Methoden ...
Grundzüge der Rechtsphilosophie und der Juristischen Methoden ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2<br />
mit „Rechtswissenschaft“). Zwar waren die Richter weiterhin Laien, die Zivilprozesse wurden<br />
aber durch einen eigenen Beamten, den Prätor, vorbereitet. Unter seiner Führung <strong>und</strong><br />
aufgr<strong>und</strong> seiner amtlichen Autorität hatten die streitenden Parteien sich auf eine „formula“<br />
zu einigen, die den rechtlichen Rahmen für die anschließende Verhandlung vorgab – daher<br />
<strong>der</strong> Name „Formularprozeß“.<br />
Nach heutigen Maßstäben entschied <strong>der</strong> Prätor über die Zulässigkeit <strong>der</strong> Klage, das zuständige<br />
Gericht <strong>und</strong> die statthafte Klageart <strong>und</strong> damit über die prozessualen Essentialia, für die<br />
er professioneller juristischer Kompetenz bedurfte, während die beweiswürdigende Aufarbeitung<br />
<strong>der</strong> Tatsachen den Laienrichtern überlassen wurde. Die Gr<strong>und</strong>sätze, nach denen <strong>der</strong><br />
Prätor Klagen in seinem jeweiligen Amtsjahr zulassen wollte, wurden in einem Edikt verkündet,<br />
das von seinen Nachfolgern übernommen wurde. Die prätorischen Edikte enthielten<br />
so eine Sammlung des tatsächlich geltenden, praktisch angewandten Rechts. Beraten wurden<br />
die Prätoren von den „iuris consulti“, den Rechtsgelehrten, die insbeson<strong>der</strong>e als<br />
„Respondierjuristen“ wissenschaftlich begründete Antworten (responsa) auf Anfragen erteilten.<br />
„Es war für die Entwicklung des römischen Rechts nun von großer Bedeutung, daß sich<br />
stets genügend Nobiles als Rechtsberater fanden; doch war <strong>der</strong> gelehrte Nachwuchs vor allem<br />
dadurch gesichert, daß die Tätigkeit des Rechtsgelehrten als standesgemäß galt“ (Jochen<br />
Bleicken, Die Verfassung <strong>der</strong> Römischen Republik, 8. Aufl., S. 145). Die von je<strong>der</strong> Juristengeneration<br />
zu wie<strong>der</strong>holende Rezeption (Aneignung) des römischen Rechts, die mit <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>entdeckung<br />
<strong>der</strong> Kodifikation Justinians im 11./12. Jahrhun<strong>der</strong>t begann, <strong>und</strong> mit ihr die<br />
Pflege <strong>der</strong> über Jahrhun<strong>der</strong>te einheitlichen europäischen Gelehrtensprache könnte noch immer<br />
als standesgemäß gelten, wenn man in Schulen <strong>und</strong> Universitäten nicht alles nach unten<br />
nivelliert <strong>und</strong> das Latinum als Voraussetzung des Jurastudiums nicht abgeschafft hätte.<br />
Zur Menschenwürde<br />
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Nicht erst die feierliche Formulierung bringt die<br />
Beson<strong>der</strong>heit dieses Satzes zum Ausdruck, son<strong>der</strong>n schon seine Stellung als Eingangssatz<br />
des Gr<strong>und</strong>gesetzes. Die Eigenschaft, <strong>der</strong> erste Satz <strong>der</strong> Verfassung zu sein, hebt ihn aus <strong>der</strong><br />
Masse <strong>der</strong> Normsätze unserer Rechtsordnung heraus. Seine Singularität spricht für die Exklusivität<br />
seines Sinnes o<strong>der</strong> kurz: für seinen Eigen-Sinn. Nach Theodor Heuss, dem späteren<br />
ersten B<strong>und</strong>espräsidenten, formuliert Art. 1 I 1 GG eine „nicht interpretierte These“. Eine<br />
„These“ ist eine Setzung, die eine Behauptung aufstellt, sie aber selbst nicht begründet. Mit<br />
Pico della Mirandola (1463-1494) kann man noch heute sagen, <strong>der</strong> Mensch sei „plastes et<br />
fictor“ – schöpferischer Gestalter – seiner selbst, pointiert: er verfüge über „Entwurfsvermögen“<br />
(zum ideengeschichtlichen Hintergr<strong>und</strong>: Band 1 <strong>der</strong> Reihe POLITIKA, hrsg. von Rolf<br />
Gröschner <strong>und</strong> Oliver Lembcke: Des Menschen Würde – entdeckt <strong>und</strong> erf<strong>und</strong>en im Humanismus<br />
<strong>der</strong> italienischen Renaissance, 2008, insbes. S. 159 ff. <strong>und</strong> S. 215 ff.). Da dieses „Vermögen“<br />
thetisch o<strong>der</strong> quasi-axiomatisch vorausgesetzt (unterstellt) wird, <strong>und</strong> eine reine (definitorisch<br />
zugesprochene) Potentialität zum Ausdruck bringt, ist es in <strong>der</strong> Tat „unantastbar“.<br />
Als „Konstitutionsprinzip“ (BVerfG) f<strong>und</strong>iert es die Menschenrechte (Art. 1 II GG), die<br />
als Gr<strong>und</strong>rechte alle staatliche Gewalt binden (Art. 1 III GG). In liberal-rechtsstaatlicher Tradition<br />
sind Gr<strong>und</strong>rechte zwar unstreitig Abwehrrechte gegen den Staat, ebenso unstreitig<br />
sind sie in demokratisch-republikanischer Funktion aber auch politische Mitwirkungs- <strong>und</strong><br />
Gestaltungsrechte. Ernsthaft freiheitsphilosophisch konzipiert, haben die Freiheitsgr<strong>und</strong>rechte<br />
daher sowohl limitierende als auch legitimierende Funktion. Sie bilden den Gr<strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> die Grenze <strong>der</strong> freiheitlichen Ordnung des Gr<strong>und</strong>gesetzes. Deren tragende Prinzipien<br />
o<strong>der</strong> Konstitutionsprinzipien sind Menschenwürde <strong>und</strong> Republik: das Republikprinzip konstituiert<br />
die Freiheit aller, das Menschenwürdeprinzip die Freiheit aller Einzelnen (Rolf<br />
Gröschner/Oliver Lembcke, Ethik <strong>und</strong> Recht, in: Nikolaus Knoepffler u.a., Einführung in die<br />
Angewandte Ethik, 2006, S. 60).