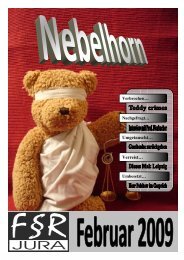Grundzüge der Rechtsphilosophie und der Juristischen Methoden ...
Grundzüge der Rechtsphilosophie und der Juristischen Methoden ...
Grundzüge der Rechtsphilosophie und der Juristischen Methoden ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
allgemeine Problem <strong>der</strong> Norm in <strong>der</strong> Zeit. [. . .]. Die Bildung <strong>der</strong> Fallnorm beruht also auf<br />
einer Unterbrechung (Sistierung) des hermeneutischen Zirkels an einer bestimmten Stelle<br />
des Erkenntnisgangs zwischen Norm <strong>und</strong> Sachverhalt. Besteht die Aufgabe darin, aus einer<br />
Gesetzesnorm die Fallnorm herauszupräparieren, dann ist <strong>der</strong> ‚Zirkel‘ desto kürzer, je präziser<br />
das Gesetz ist. Je weiter die gesetzliche Norm gefaßt ist, desto mehr ‚Windungen‘ weist<br />
die – sich zum Punkt (dem ‚Umkehrpunkt‘) verengende – ‚hermeneutische Spirale‘ auf. Die<br />
Fallnorm ist das, was vom hermeneutischen Zirkel bleibt, wenn man ihn abbricht“.<br />
Friedrich Müller, Juristische Methodik, 7. Aufl. 1997, S. 79: „Noch immer ist allerdings die<br />
Meinung, Norm <strong>und</strong> Normtext seien dasselbe, weit verbreitet. Sie muß auch noch in <strong>der</strong> verfassungsrechtlichen<br />
Methodik als herrschend bezeichnet werden. Unter ‚<strong>Methoden</strong>‘ des Verfassungsrechts<br />
werden bis heute nicht die tatsächlichen Arbeitsweisen verfassungsrechtlicher<br />
Normkonkretisierung im umfassenden Sinn verstanden, son<strong>der</strong>n vor allem überlieferte<br />
Kunstregeln <strong>der</strong> Normtextinterpretation. Methodik gilt als Methodik <strong>der</strong> Auslegung von<br />
Sprachtexten. Doch ist eine Rechtsnorm mehr als <strong>der</strong> Wortlaut. Dieser drückt, da noch nicht<br />
interpretiert, noch nicht einmal den sogenannten Rechtsbefehl, das Normprogramm, aus.<br />
Gleichrangig <strong>und</strong> mitkonstitutiv zur Norm gehört jedoch auch <strong>der</strong> Normbereich, d.h. jener<br />
Ausschnitt sozialer Wirklichkeit in seiner Gr<strong>und</strong>struktur, den sich das vom Rechtsarbeiter<br />
aus <strong>der</strong> Interpretation sämtlicher Sprachdaten entwickelte Normprogramm als Regelungsbereich<br />
‚ausgesucht‘ (nicht- o<strong>der</strong> nur z.T. rechtserzeugter Normbereich) o<strong>der</strong> den es möglicherweise<br />
erst geschaffen hat (rechtserzeugter Normbereich). ‚Normbereich‘ meint in diesem<br />
Zusammenhang nicht den gesamten Regelungssektor <strong>der</strong> Rechtsnorm, son<strong>der</strong>n nur einen<br />
Ausschnitt aus diesem. ‚Normbereich‘ heißt die Gr<strong>und</strong>struktur des Sachbereichs <strong>der</strong> Rechtsnorm,<br />
also die Summe <strong>und</strong> <strong>der</strong> Zusammenhang <strong>der</strong> vom Juristen anhand des Normprogramms<br />
als mit diesem vereinbar <strong>und</strong> für die Fallösung wesentlich, damit zugleich als<br />
(mit-)normativ begründbaren Tatsachen des Sachbereichs. Da die Norm mehr ist als ein<br />
sprachlicher Satz, <strong>der</strong> auf dem Papier steht, kann ihre ‚Anwendung‘ sich nicht allein in Interpretation,<br />
in Auslegung eines Textes erschöpfen. Vielmehr handelt es sich um fallbezogene<br />
Konkretisierung dessen, was Normprogramm, Normbereich <strong>und</strong> die Eigenheiten des<br />
Sachverhalts an Daten liefern [. . .]. Von wenigen an <strong>der</strong> Grenze liegenden Normtypen wie<br />
numerisch bestimmten Vorschriften abgesehen, ist das formallogische Verfahren des syllogistischen<br />
Schlusses für juristische Konkretisierung nie zureichend“.<br />
Jan Schapp, Hauptprobleme <strong>der</strong> juristischen <strong>Methoden</strong>lehre, 1983, S. 64 f.: „Der Tatbestand<br />
des Gesetzes entwickelt nach unserer Auffassung die Gründe, die den Gesetzgeber zu<br />
einer bestimmten Entscheidung im Hinblick auf einen bestimmten Fall bewogen haben. Dabei<br />
lassen sich diese Gründe nicht vom Fall selbst abstrahieren. Wir hatten das Verhältnis so<br />
aufgefaßt, daß <strong>der</strong> ungelöste Fall über die Gründe seiner Entscheidung sich zur Entscheidung<br />
hin entwickelt [. . .]. Der ‚Fallvergleich‘ liegt nun darin, daß <strong>der</strong> Richter die im Gesetz<br />
für einen bestimmten Fall vorgetragenen Entscheidungsgründe im Hinblick auf den ihm<br />
vorliegenden Fall erwägt [. . .]. Am nächsten kommt man dem Vorgang wohl, wenn man<br />
davon ausgeht, daß <strong>der</strong> Richter mit dem Gesetzgeber in ein Gespräch darüber eintritt, ob die<br />
Entscheidungsgründe des Gesetzgebers für einen bestimmten Fall die richterliche Entscheidung<br />
für den dem Richter vorliegenden Fall zu begründen vermögen. Man möge uns zugestehen,<br />
daß wir von einem ‚Gespräch‘ sprechen, auch wenn <strong>der</strong> Gesetzgeber nur ein stiller<br />
Partner dieses Gesprächs ist 4 “.<br />
4<br />
Was unter Gespräch zu verstehen ist, soll hier nicht vertieft werden. Wir dürfen dazu auf die Untersuchungen<br />
W. Schapps in „Philosophie <strong>der</strong> Geschichten“, Vierter Teil: Das Wort <strong>und</strong> die Geschichte,<br />
S. 267 ff. verweisen. Neuerdings hat Gröschner die Thematik in einer umfassenden Monographie mit<br />
dem Titel „Dialogik <strong>und</strong> Jurisprudenz“ behandelt. Vgl. auch Gadamer, Wahrheit <strong>und</strong> Methode, S. 365,<br />
<strong>der</strong> die Wechselbeziehung zwischen Interpret <strong>und</strong> Text mit <strong>der</strong> Wechselseitigkeit im Gespräch vergleicht<br />
[. . .].<br />
2