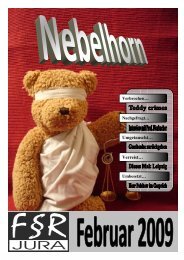Grundzüge der Rechtsphilosophie und der Juristischen Methoden ...
Grundzüge der Rechtsphilosophie und der Juristischen Methoden ...
Grundzüge der Rechtsphilosophie und der Juristischen Methoden ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zu Engisch<br />
Karl Engisch (1899 - 1990), nach dem 2. Weltkrieg Nachfolger Gustav Radbruchs (<strong>der</strong> 1933<br />
von den Nazis entlassen worden war) auf dem Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozeßrecht<br />
<strong>und</strong> <strong>Rechtsphilosophie</strong> in Heidelberg, ab 1953 Professor in München bis zur Emeritierung<br />
1967. Seine „Einführung in das juristische Denken“ (1956) liegt inzwischen in <strong>der</strong> 10. Auflage<br />
(2004) vor. Geradezu sprichwörtlich geworden ist eine Metapher, die er in seinen „Logischen<br />
Studien zur Gesetzesanwendung“ (1943) geprägt hat: das Bild vom „Hin- <strong>und</strong> Herwan<strong>der</strong>n<br />
des Blickes“ zwischen Gesetz <strong>und</strong> Lebenssachverhalt (3. Aufl. 1963, S. 15).<br />
Zu Gadamer<br />
Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002) hat mit „Wahrheit <strong>und</strong> Methode“ (1960) ein weltweit<br />
beachtetes Standardwerk <strong>der</strong> allgemeinen Hermeneutik publiziert, dessen Titel als Leitsatz<br />
seiner Lehre formulierbar ist: Wahrheit ist keine Frage <strong>der</strong> Methode, <strong>und</strong> zwar in all jenen<br />
„geisteswissenschaftlichen“ Disziplinen nicht, die man mit Gadamer „hermeneutische“ nennen<br />
kann. Zu ihnen gehören nicht nur traditionelle hermeneutische Disziplinen wie Theologie,<br />
Jurisprudenz <strong>und</strong> Philosophie, son<strong>der</strong>n auch Geschichte, insbeson<strong>der</strong>e Kunst- <strong>und</strong> Philosophiegeschichte,<br />
Ästhetik im speziellen <strong>und</strong> Philosophie im allgemeinen. Wahrheit ist<br />
dort eine Frage des Verstehens <strong>und</strong> <strong>der</strong> Verständigung. Verstehen bedeutet dabei, jede Aussage<br />
als Antwort auf eine bestimmte Frage zu verstehen („hermeneutischer Vorrang <strong>der</strong> Frage“).<br />
Die juristische Hermeneutik ist hier für Gadamer von „exemplarischer Bedeutung“<br />
gewesen. Josef Essers „Vorverständnis <strong>und</strong> <strong>Methoden</strong>wahl in <strong>der</strong> Rechtsfindung“ (1970)<br />
konnte gerade deshalb gut an Gadamer anknüpfen.<br />
Im Rückblick auf die Philosophie <strong>der</strong> Griechen, insbeson<strong>der</strong>e auf das sokratische Wissen um<br />
das Nichtwissen liefert Gadamer zugleich ein schönes Beispiel für die Verbindung von<br />
<strong>Rechtsphilosophie</strong> <strong>und</strong> Juristischer <strong>Methoden</strong>lehre: „Es gehört zu den größten Einsichten,<br />
die uns die platonische Sokratesdarstellung vermittelt, daß das Fragen – ganz im Gegensatz<br />
zu <strong>der</strong> allgemeinen Meinung – schwerer ist als das Antworten. Wenn die Partner des sokratischen<br />
Gesprächs, um Antworten auf die lästigen Fragen des Sokrates verlegen, den Spieß<br />
umdrehen wollen <strong>und</strong> ihrerseits die vermeintlich vorteilhafte Rolle des Fragers beanspruchen,<br />
dann scheitern sie damit erst recht. Hinter diesem Komödienmotiv <strong>der</strong> platonischen<br />
Dialoge steckt die kritische Unterscheidung zwischen eigentlicher <strong>und</strong> uneigentlicher Rede.<br />
Wer im Reden nur das Rechthaben sucht <strong>und</strong> nicht die Einsicht in eine Sache, wird freilich<br />
das Fragen für leichter halten als das Antworten. Dabei droht ja nicht die Gefahr, einer Frage<br />
die Antwort schuldig zu bleiben. In Wahrheit zeigt sich aber am neuerlichen Versagen des<br />
Partners, daß <strong>der</strong> überhaupt nicht fragen kann, <strong>der</strong> alles besser zu wissen meint. Um fragen<br />
zu können, muß man wissen wollen, d.h. aber: wissen, daß man nicht weiß. In <strong>der</strong> komödienhaften<br />
Vertauschung von Fragen <strong>und</strong> Antworten, Wissen <strong>und</strong> Nichtwissen, die Plato<br />
uns schil<strong>der</strong>t, kommt mithin die Vorgängigkeit <strong>der</strong> Frage für alles sacherschließende Erkennen<br />
<strong>und</strong> Reden zur Anerkennung. Ein Reden, das eine Sache aufschließen soll, bedarf des<br />
Aufbrechens <strong>der</strong> Sache durch die Frage. Aus diesem Gr<strong>und</strong>e ist die Vollzugsweise <strong>der</strong> Dialektik<br />
das Fragen <strong>und</strong> Antworten, o<strong>der</strong> besser, <strong>der</strong> Durchgang alles Wissens durch die Frage.<br />
Fragen heißt ins Offene stellen. Die Offenheit des Gefragten besteht in dem<br />
Nichtfestgelegtsein <strong>der</strong> Antwort. Das Gefragte muß für den feststellenden <strong>und</strong> entscheidenden<br />
Spruch noch in <strong>der</strong> Schwebe sein. Das macht den Sinn des Fragens aus, das Gefragte so<br />
in seiner Fraglichkeit offenzulegen. Es muß in die Schwebe gebracht werden, so daß dem Pro<br />
das Contra das Gleichgewicht hält. Jede Frage vollendet erst ihren Sinn im Durchgang durch<br />
solche Schwebe, in <strong>der</strong> sie eine offene Frage wird. Jede echte Frage verlangt diese Offenheit.<br />
Fehlt ihr dieselbe, so ist sie im Gr<strong>und</strong>e eine Scheinfrage, die keinen echten Fragesinn hat“.<br />
(Gesammelte Werke 1, 1999, S. 368 f.).<br />
2