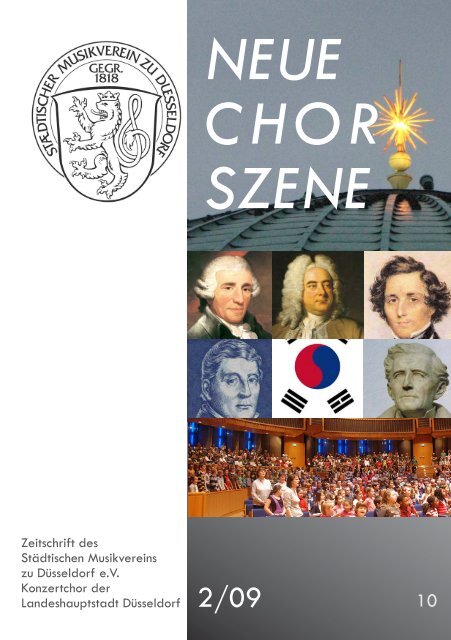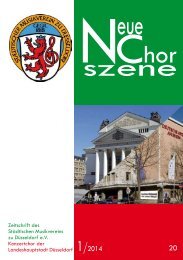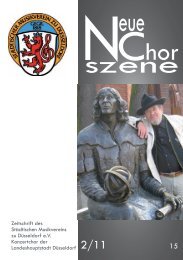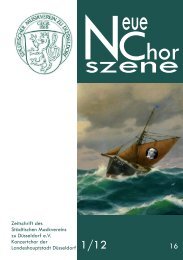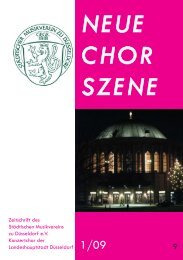Kennen Sie Korea - beim Städtischen Musikverein zu Düsseldorf eV
Kennen Sie Korea - beim Städtischen Musikverein zu Düsseldorf eV
Kennen Sie Korea - beim Städtischen Musikverein zu Düsseldorf eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
NEUE<br />
CHOR<br />
SZENE<br />
Zeitschrift des<br />
<strong>Städtischen</strong> <strong>Musikverein</strong>s<br />
<strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong> e.V.<br />
Konzertchor der<br />
Landeshauptstadt <strong>Düsseldorf</strong> 2/09 10
NEUE<br />
CHORSZENE<br />
Inhaltsverzeichnis 2/09<br />
Editorial Georg Lauer 3<br />
Musikalisch durch die Grundschule<br />
Das Projekt SingPause Jens D. Billerbeck 4<br />
<strong>Kennen</strong> <strong>Sie</strong> <strong>Korea</strong>? Udo Kasprowicz 7<br />
Impressum / Städtischer <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong> e.V.<br />
Herausgeber: Geschäftsstelle Ehrenhof 1 - 40479 <strong>Düsseldorf</strong><br />
E-Mail: info@musikverein-duesseldorf.de /<br />
Internet: www.musikverein-duesseldorf.de<br />
V.i.S.d.P.: Georg Lauer - g.lauer@musikverein-duesseldorf.de<br />
Redaktion: Jens D. Billerbeck, Erich Gelf, Georg Lauer,<br />
Udo Kasprowicz, Dr. Thomas Ostermann, Konstanze Richter<br />
Titelbild: Städtischer <strong>Musikverein</strong> - Detail Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />
Textbilder: Städtischer <strong>Musikverein</strong>, Internet<br />
Nr. 10<br />
6. Jahrgang<br />
August 2009<br />
Hak-Young Lee 11<br />
Louis Spohr und die Vokalmusik<br />
Ein Beitrag <strong>zu</strong>m Spohrjahr Dr. Wolfram Boder 14<br />
Der Komponist Sigismund Neukomm<br />
Neues vom Schüler Joseph Haydns von Erich Gelf 23<br />
Termine, Termine - Vorschau auf die neue Konzertsaison als 25 - 28<br />
heraustrennbarer Kompaktfalter mit weiteren wichtigen Informationen<br />
Selten gehörte Chorwerke<br />
Carl Loewes Oratorien Dr. Michael Wilfert 37<br />
Buchrezension: Joseph Gelinek‘s<br />
„Beethovens 10. Sinfonie“ Dr. Thomas Ostermann 48<br />
Wuppertaler Singpause<br />
Unser Beitrag <strong>zu</strong>m Haydn-Jahr von Udo Kasprowicz 50<br />
ISSN-Nr.: 1861-261X / Erscheineinungsweise: halbjährlich<br />
Druck: Druckerei Preuß GmbH - Ratingen<br />
Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck<br />
- auch aus<strong>zu</strong>gsweise - oder sonstige Vervielfältigung nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion.<br />
2 NC 2 / 09
Editorial<br />
Liebe Leserinnen und Leser!<br />
Das Jahr 2009 hat einiges an runden Fest-<br />
und Gedenktagen <strong>zu</strong> bieten: Neben den bekannten<br />
Daten wie dem 250. Todestag von G.<br />
F. Händel, dem 200. Todestag von J. Haydn<br />
oder dem 200. Geburtstag von F. Mendelssohn<br />
Bartholdy gibt es 2009 noch (mindestens) zwei<br />
weitere Laureaten, an die wir erinnern. Der eine<br />
ist Louis Spohr, der vor 150, der andere Carl<br />
Loewe, der vor 140 Jahren starb.<br />
In seiner Geburtsstadt Löbejün - das Zweieinhalbtausenseelenstädtchen<br />
liegt 15 km nördlich<br />
von Halle an der Saale - ehrte die Carl-Loewe-<br />
Gesellschaft am 20. April 2009 den großen Balladenvertoner,<br />
der vor allem Goethes „Erlkönig“<br />
<strong>zu</strong> Weltruhm verhalf. Unser Gastautor Dr. Michael<br />
Wilfert beleuchtet mit seinem Beitrag die<br />
weniger bekannte Schaffensseite Carl Loewes<br />
und stellt in unserer Rubrik „Selten gehörte<br />
Chorwerke“ den Oratorienkomponisten vor.<br />
Den Beitrag <strong>zu</strong>m Spohrjahr unseres zweiten<br />
Gastaustors Dr. Wolfram Boder empfehle ich<br />
ebenfalls Ihrer besonderen Aufmerksamkeit:<br />
Das letzte „Universalgenie der Musikgeschichte“<br />
schrieb mit seinen Oratorien Musikgeschichte<br />
auch in <strong>Düsseldorf</strong>! Sein berühmtes Violinkonzert<br />
Nr. 8 in a-Moll, op 47 mit dem Untertitel<br />
„In Form einer Gesangsszene“ hören <strong>Sie</strong> im<br />
November in der Tonhalle im „Sternzeichen-<br />
4-Konzert“, in dessen 2. Teil die „Lobgesang-<br />
Symphonie“ von Felix Mendelssohn Bartholdy<br />
<strong>zu</strong>r Aufführung gelangt. Mit Auszügen aus dieser<br />
Symphonie Nr. 2 B-Dur op. 52 eröffneten die<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker und der Städtische<br />
<strong>Musikverein</strong> am Neujahrsmorgen 2009 das Jubiläumsjahr,<br />
mit der Aufführung dieser großartigen<br />
Symphonie-Kantate unter der Leitung des neuen<br />
Opernchefs Axel Kober beschließen sie es.<br />
Keine drei Wochen vor diesem Konzert erklingt<br />
in der Tonhalle ein weiteres Großwerk<br />
von Georg Lauer<br />
der Musikgeschichte, das<br />
ebenfalls in einem besonderen<br />
Be<strong>zu</strong>g <strong>zu</strong> Felix Men-<br />
delssohn und seiner Zeit als<br />
Städtischer Musikdirektor in <strong>Düsseldorf</strong> steht:<br />
Am Allerheiligenwochenende 2009 können <strong>Sie</strong><br />
in der Tonhalle dreimal Georg Friedrich Händels<br />
Oratorium „Israel in Egypt“ erleben! Unter der<br />
Leitung von Frieder Bernius werden die <strong>Düsseldorf</strong>er<br />
Symphoniker, ein erlesenes Solistenensemble<br />
und der Städtische <strong>Musikverein</strong> dieses<br />
chorreichste Oratorium des großen Jubilars in<br />
englischer Sprache erklingen lassen.<br />
Um der Informationsfülle, die Erich Gelf <strong>zu</strong>m<br />
Komponisten, <strong>zu</strong>r Entstehung seines Werkes<br />
und <strong>zu</strong> den <strong>Düsseldorf</strong>er Aufführungen unter<br />
Mendelssohn <strong>zu</strong>sammengetragen hat, gerecht<br />
<strong>zu</strong> werden, haben wir im Händeljahr 2009 diesem<br />
Thema eine Sonderausgabe unserer Zeitschrift<br />
gewidmet. Sollte diese Sonderausgabe<br />
2a/09 in der Ihnen gerade vorliegenden Ausgabe<br />
2/09 nicht (mehr) enthalten sein, reichen wir<br />
Ihnen diese gerne nach.<br />
Mit zwei Themen, die uns besonders am Herzen<br />
liegen, haben wir diese turnusmäßige Ausgabe<br />
eröffnet: mit der SingPause und mit <strong>Korea</strong>!<br />
Und dass sich Chor und Redaktion auch dem<br />
Jubilar Josef Haydn gewidmet haben, erfahren<br />
<strong>Sie</strong> am Schluss dieses Heftes. Und „unterwegs“,<br />
und zwar genau in seiner Mitte, finden <strong>Sie</strong> erstmals<br />
einen besonderen Service für Konzertbesucher<br />
und -besucherinnen: unseren vielfach<br />
nachgefragten „Falt-Plan“, den <strong>Sie</strong> (vorsichtig!)<br />
heraustrennen und nach dreimaligem Falten Ihrer<br />
Brief- oder Handtasche hin<strong>zu</strong>fügen können.<br />
Außer den Konzertterminen des Chores finden<br />
<strong>Sie</strong> darin auch die Ihnen wichtigen Daten der für<br />
<strong>Sie</strong> handelnden Personen.<br />
Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen wie<br />
immer herzlichst Ihr<br />
NC 2 / 09 3
Musikalisch durch die Grundschule<br />
Das Projekt SingPause von Jens D. Billerbeck<br />
Mittwoch, 10. Juni 2009,<br />
8:30 Uhr: Durch das grüne<br />
Gewölbe betreten klassenweise<br />
rund 1000 Kinder<br />
die Tonhalle. Für viele<br />
von ihnen ist es das erste<br />
mal, dass sie einen großen<br />
Konzertsaal von innen<br />
sehen. Entsprechend<br />
groß und spürbar ist die<br />
Aufregung unter den<br />
Grundschülern. Für die<br />
Saalordner der Tonhalle<br />
keine leichte Aufgabe, die<br />
Besucherströme an die richtigen Aufgänge<br />
<strong>zu</strong> lenken. Doch alles ist minutiös<br />
durchgeplant: Jeder Grundschule,<br />
jeder Klasse ist ein Block im Saal <strong>zu</strong>gewiesen<br />
und so füllt sich der große Saal<br />
bis 9 Uhr mit einer fröhlich schnatternden<br />
Menschenmasse.<br />
Mittwoch 10. Juni 2009 ist SingPause-Tag,<br />
heute werden insgesamt 2000<br />
Kinder aus <strong>Düsseldorf</strong>er Grundschulen<br />
sich selbst und ihren Eltern in zwei<br />
Konzerten beweisen, was sie in diesem<br />
musikalischen Früherziehungsprojekt<br />
gelernt haben. „Jedes Kind kann singen<br />
lernen“ – dies steht als Motto über dem<br />
Projekt SingPause, mit dem der Städtische<br />
<strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong> und<br />
das Kulturamt der Landeshauptstadt<br />
seit Oktober 2006 musikalische Basisarbeit<br />
leisten. Ziel der SingPause: Jedes<br />
Kind soll singen lernen. Und zwar<br />
in der Gemeinschaft mit Mitschülern<br />
unter der fachkundigen Anleitung ausgebildeter<br />
Sängerinnen und Sänger. Ab<br />
August werden 37 Grundschulen mit<br />
insgesamt mehr als 8.000 Schülern am<br />
4 NC 2 / 09<br />
1000 Kinder bei der SingPause in der Tonhalle<br />
Projekt teilnehmen. Und es bewerben<br />
sich immer neue Schulen darum, in das<br />
Projekt aufgenommen <strong>zu</strong> werden.<br />
Höhepunkt des SingPause-Jahres<br />
ist das große Konzert in der Tonhalle.<br />
Hier, wo sich sonst die Größen der<br />
weltweiten Musikszene die Klinke in<br />
die Hand geben, haben jetzt die Kleinen<br />
das Sagen. Und sie schonen den<br />
Saal nicht: Aufgeregt hopsen sie immer<br />
wieder von den Klappsesseln und<br />
stellen die Mechanik des Gestühls auf<br />
eine harte Probe. Der Lärm ist einfach<br />
ohrenbetäubend. Doch dann, kurz<br />
nach 9 Uhr, betreten die Singleiter die<br />
Bühne und binnen weniger Sekunden<br />
ist es im Saal mucksmäuschenstill. In<br />
der nun folgenden Stunde werden die<br />
Kinder nach einer kurzen Begrüßung<br />
und einem kleinen Einsingen zahlreiche<br />
Frühlings- und Sommerlieder <strong>zu</strong>m<br />
Besten geben.
Was ist die SingPause?<br />
Was aber ist das Motiv, das hinter diesem<br />
in seiner Dimension bundesweit<br />
einmaligen Vorhaben steckt? „Wir wollen,<br />
dass Kinder möglichst früh beginnen,<br />
ihr ureigenstes Musikinstrument <strong>zu</strong><br />
entdecken: die Stimme“, sagte <strong>Musikverein</strong>svorsitzender<br />
Manfred Hill auf der<br />
am gleichen Tag stattfindenden gemeinsamen<br />
Pressekonferenz mit der Stadt<br />
<strong>Düsseldorf</strong>. Der <strong>Musikverein</strong> ist organisatorischer<br />
Träger der SingPause.<br />
Die künstlerische Gesamtleitung liegt<br />
in Händen von Marieddy Rossetto. <strong>Sie</strong><br />
erklärte den anwesenden Journalisten<br />
von Presse, Rundfunk und Fernsehen<br />
die Methode: „Zweimal wöchentlich<br />
werden alle Schulklassen für jeweils<br />
20 Minuten von unseren ausgebildeten<br />
Sängerinnen und Sängern betreut.“ Gemeinsam<br />
erarbeiten sie musikalische<br />
Grundkenntnisse und lernen ein breites<br />
internationales Liedrepertoire.<br />
Gearbeitet wird nach der „Ward-Methode“.<br />
<strong>Sie</strong> ist benannt nach der amerikanischen<br />
Musikpädagogin Justine<br />
Bayard Ward (1879-1975). Die Ward-<br />
Methode wurde in Zusammenarbeit mit<br />
der Catholic University of America in<br />
Washington D. C. für den Musikunterricht<br />
entwickelt und in der Praxis stetig<br />
weiter überprüft und verbessert. „Vorrangiges<br />
Ziel der Ward-Methode ist, bei<br />
den Kindern wahre Freude und Begeisterung<br />
für das Singen und Musizieren<br />
<strong>zu</strong> wecken“, erläuterte Rossetto. In<br />
einer kurzen Demonstration zwischen<br />
den beiden Singpause-Konzerten<br />
konnten sich zahlreiche geladene Gäste,<br />
darunter auch Oberbürgermeister<br />
Dirk Elbers und Ex-GMD Bernhard Klee<br />
von der Methode überzeugen, die den<br />
Kindern wirklich spielerisch den siche-<br />
ren Umgang mit ihrer Stimme und den<br />
Tönen beibringt.<br />
Die finanzielle Basis für die SingPause<br />
schafft das Kulturdezernat mit einem<br />
jährlichen Zuschuss von jetzt 90.000<br />
Euro. Mittel in gleicher Höhe wurden in<br />
diesem Jahr aus dem Schuletat beigesteuert.<br />
„Die SingPause“, so Kulturdezernent<br />
Hans-Georg Lohe auf der Pressekonferenz,<br />
„ist ein zentraler Baustein<br />
des städtischen Gesamtkonzepts <strong>zu</strong>r<br />
kulturellen Bildung und Kreativitätsförderung<br />
von Kindern und Jugendlichen.<br />
Ich freue mich, dass wir dieses Projekt<br />
auch dank der beeindruckenden Unterstüt<strong>zu</strong>ng<br />
aus der Bürgerschaft so<br />
ausbauen konnten.“ Und sein Kollege,<br />
Schul- und Jugenddezernent Burkhard<br />
Hintzsche, ergänzte: „Mit der SingPause<br />
haben ganze Schulklassen in <strong>Düsseldorf</strong><br />
die Freude am gemeinsamen<br />
Singen entdeckt. Es macht Spaß <strong>zu</strong> erleben,<br />
wie Kinder mit einfachen Mitteln<br />
und einem attraktiven Vermittlungskonzept<br />
für die Musik begeistert werden<br />
können.“<br />
Neben der musikalischen Basisarbeit<br />
hat die SingPause aber noch einen<br />
weiteren Zweck: <strong>Sie</strong> versteht sich<br />
als sozial-integratives Kulturangebot,<br />
dass sich ganz bewusst an alle Kinder<br />
richtet, egal welcher Herkunft, musikalischer<br />
Vorbildung oder sozialer Schicht<br />
sie angehören.<br />
„Kinder ziehen Selbstbewusstsein<br />
aus der SingPause, ohne in eine Konkurrenzsituation<br />
<strong>zu</strong> gelangen, da ja<br />
gemeinsam gesungen wird“, sagte<br />
Manfred Hill. Lehrer berichten, dass die<br />
Kinder nach einer SingPause ausgeglichener<br />
wirken, dass sich ihre Stimmung<br />
bessert und dass Konflikte zwischen<br />
den Kindern beigelegt werden.<br />
NC 2 / 09 5
Da die Kinder ihr Instrument - die eigene<br />
Stimme - ja stets mit sich tragen<br />
und für eine SingPause außer den ausgebildeten<br />
Mitgliedern des SingPause-<br />
Teams keine weiteren Hilfsmittel gebraucht<br />
werden, ist die Realisierung,<br />
verglichen mit anderen Musikprojekten,<br />
sehr kostengünstig. Dennoch braucht<br />
es natürlich finanzielle Rückendeckung<br />
<strong>zu</strong>m Beispiel für die Sängerdozenten<br />
und deren intensive Weiterbildung.<br />
Deswegen ist Hill auch für die zahlreichen<br />
Spenden von Vereinen, Institutionen<br />
und Privatpersonen dankbar, die<br />
ebenfalls da<strong>zu</strong> beitragen, das Projekt in<br />
seiner heutigen Dimension mit Leben <strong>zu</strong><br />
füllen. Zu diesen Unterstützern gehören<br />
heute die BürgerStiftung <strong>Düsseldorf</strong>, die<br />
Stiftung van Meeteren <strong>Düsseldorf</strong>, die<br />
Heinz-Schmöle-Stiftung, die Dr. Carola<br />
und Dr. Edmund Haffmans-Stiftung, die<br />
Gesellschaft der Freunde und Förderer<br />
der <strong>Düsseldorf</strong>er Tonhalle e.V., die<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong>, der Heimatverein<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Jonges e.V., der Rotary-<br />
Club <strong>Düsseldorf</strong>, der InnerWheel Club<br />
Clara Schumann <strong>Düsseldorf</strong>, der<br />
Industrie-Club <strong>Düsseldorf</strong>, die Victoria<br />
Versicherung AG <strong>Düsseldorf</strong>, die<br />
Hermann Weber Feuerlöscher GmbH<br />
und private Spender.<br />
SingPause am Familientag der<br />
Tonhalle<br />
Am Sonntag, dem 28. Juni, war Familientag<br />
in der Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong>.<br />
Ab 14 Uhr präsentierten dabei 900<br />
„SingPause“-Kinder ihr Liederprogramm<br />
unter der künstlerischen Leitung<br />
von Marieddy Rossetto, mit Günther<br />
Weißenborn als Moderator, Klaus Wallrath<br />
am Flügel und Tobias Liebezeit am<br />
Schlagzeug. Über 1.000 Eltern und Zuhörer<br />
konnten sich von der Qualität des<br />
Gesanges und vom Spaß, den die Kinder<br />
mit den Liedern hatten, überzeugen<br />
und jubelten den jungen Sängerinnen<br />
und Sängern begeistert <strong>zu</strong>. Auch hier<br />
hatten die meisten dieser Kinder die<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong> noch nie von innen<br />
gesehen und waren tief beeindruckt.<br />
Schuldezernent Burghardt Hintzsche, Chordirektorin Marieddy Rossetto und Dieter Schwarz vom Amt<br />
für Kommunikation am 10.06.2009 bei der Pressekonferenz <strong>zu</strong>rm Projekt „SingPause“<br />
6 NC 2 / 09
<strong>Kennen</strong> <strong>Sie</strong> <strong>Korea</strong>?<br />
von Hak-Young Lee und Udo Kasprowicz<br />
<strong>Korea</strong> gehört nicht <strong>zu</strong> den Ländern<br />
Ostasiens, die in der Vergangenheit die<br />
Sehnsucht der Europäer nach fernöstlicher<br />
Exotik gestillt haben, wie es bei<br />
China und Japan der Fall ist. Auch nennt<br />
man in Europa <strong>Korea</strong> nie <strong>zu</strong>erst, wenn<br />
nach asiatischen Wirtschaftszentren gefragt<br />
wird. Hier stehen traditionell Japan<br />
und Singapur, mittlerweile auch China im<br />
Mittelpunkt des europäischen Bewusstseins.<br />
Aus dem Chor des <strong>Musikverein</strong>s sind<br />
sie inzwischen jedoch nicht mehr weg<strong>zu</strong>denken,<br />
die charmanten jungen Damen<br />
mit dem silberhellen Lachen und<br />
die höflichen jungen Männer mit den gewaltigen<br />
Stimmen, die gar nicht <strong>zu</strong> ihrem<br />
körperlichen Erscheinungsbild <strong>zu</strong> passen<br />
scheinen. Und doch sind sie uns trotz<br />
des vertrauten Anblicks ein wenig fremd<br />
geblieben.<br />
Grund genug, sich mit <strong>Korea</strong> <strong>zu</strong> befassen!<br />
Das Land, seine Menschen und<br />
ihre Sprache<br />
Die Nord-Südausdehnung <strong>Korea</strong>s entspricht<br />
mit 1100 km etwa der Deutschlands,<br />
mit seiner Fläche von 221.000km 2<br />
(davon 99.000km 2 Südkorea) ist es deutlich<br />
kleiner. (357.092,90km 2 )<br />
Die Vorfahren der heutigen <strong>Korea</strong>ner<br />
wanderten vermutlich im dritten vorchristlichen<br />
Jahrtausend aus Innerasien<br />
ein. Als mythisches Gründungsdatum gilt<br />
das Jahr 2333 v.Chr, in dem Tangun, ein<br />
Göttersohn, das Land Chošon gründete.<br />
Die Mehrheit der Linguisten hält die<br />
Zugehörigkeit des <strong>Korea</strong>nischen <strong>zu</strong>r altaischen<br />
Sprachfamilie für wahrscheinlich.<br />
Ihr gehören außerdem das Türkische,<br />
Mongolische, Japanische und auch das<br />
Mandschu an. Die enge Verbindung zwischen<br />
<strong>Korea</strong> und dem China der Han-<br />
Dynastie (206 v - 220 n.Chr.) führt <strong>zu</strong> einer<br />
kulturellen Hegemonie der Chinesen,<br />
so dass die <strong>Korea</strong>ner viele Begriffe des<br />
Chinesischen übernahmen. Noch heute<br />
prägt ein Dualismus von Vokabeln beider<br />
Sprachen die Kommunikation. Die koreanische<br />
Schrift stammt aus dem Jahr<br />
1446 n.Chr, und gilt mit 10 Vokalen und<br />
14 Konsonanten wegen ihrer Einfachheit<br />
und Logik in Fernost als einzigartige Kulturleistung.<br />
Müller, Meier, Schulze, Schmidt<br />
Die meisten von uns sind verwirrt von<br />
den Namen unserer koreanischen Mitsänger<br />
und dadurch natürlich bei der Anrede<br />
verunsichert. Tatsächlich tragen trotz<br />
285 existierender Familiennamen 49,6%<br />
der <strong>Korea</strong>ner einen der vier Namen Kim<br />
(21,6%), Lee (14,8%), Park 84,7%) und<br />
Choi (4,7%) Eheschließungen zwischen<br />
partnergleichen Namen sind un<strong>zu</strong>lässig,<br />
wobei allerdings die Zugehörigkeit <strong>zu</strong> unterschiedlichen<br />
Großfamilien das Verbot<br />
aufhebt.<br />
Neben die variationsarmen Nachnamen<br />
tritt ein Vorname, der als Generationskennzeichen<br />
gilt. Alle Angehörigen<br />
einer Familiengeneration, also Geschwister,<br />
Vettern und Basen sollten den gleichen<br />
Zweitnamen führen. Die Individualisierung<br />
schafft der zweite Vorname, bei<br />
NC 2 / 09 7
dem die <strong>Korea</strong>ner eine große Kreativität<br />
entwickeln. Die Eltern wählen hier programmatische,<br />
prophetische, glückverheißende<br />
oder einfach schmückende<br />
Wörter: Perle, Langlebiger, Schönheitsduft.<br />
Man redet sich prinzipiell mit den Nachnamen<br />
an. Im beruflichen Umfeld tritt,<br />
um Verwechslungen vor<strong>zu</strong>beugen, der<br />
Titel oder die Tätigkeitsbezeichnung hin<strong>zu</strong>,<br />
im Familienbereich die im Vergleich<br />
<strong>zu</strong> Europa sehr differenzierte Verwandtschaftsbezeichnung.<br />
So gibt es z.B. für<br />
den älteren, Bzw. jüngeren Bruder oder<br />
die Schwester besondere Anreden. Außerhalb<br />
der Familie heißt es Lee Ssi,<br />
also Herr Lee! Wenn aber zwei Lees<br />
anwesend sind, Lee Jinju Ssi, also Frau<br />
Perle Lee. Die Höflichkeitsformel ist also<br />
geschlechtsneutral.<br />
Daseinsdeutung durch Konfuzius<br />
oder Christus?<br />
Lee Hak Young Ssi, Herr Lee, erzählte<br />
in einer Probenpause, dass er aus einem<br />
evangelischen Elternhause stamme. Seine<br />
Eltern waren Bauern in der Nähe von<br />
Seoul gewesen.<br />
Man vermutet angesichts europäischer<br />
Konfessionsbezeichnungen sofort den<br />
Einfluss englischer oder amerikanischer<br />
Missionare in kolonialen oder imperialistischen<br />
Zeiten. Aber bei Bauern?<br />
Christliche Gemeinden entstanden in<br />
Staaten mit kolonialer Vergangenheit<br />
eher in Städten als auf dem Land. Die<br />
Missionsgeschichte Südamerikas und<br />
auch Chinas liefert dafür Beispiele. Noch<br />
da<strong>zu</strong> wird <strong>Korea</strong> als das konfuzianischste<br />
Land Asiens bezeichnet. (Maull 137)<br />
Tatsächlich prägt die Lehre des Konfuzius<br />
<strong>Korea</strong> bis heute. In deren Mittelpunkt<br />
8 NC 2 / 09<br />
steht die Entsakralisierung des Staates<br />
durch seine Moralisierung. Das bedeutet,<br />
dass <strong>beim</strong> Herrscher nicht seine<br />
Legitimation durch göttliche Berufung<br />
zählt, sondern seine vollkommene Einsicht<br />
in die Gesetze, die den Himmel in<br />
einem dauerhaften Ideal<strong>zu</strong>stand erhalten.<br />
Der Herrscher muss die Menschen<br />
da<strong>zu</strong> anhalten, die Sittengesetze <strong>zu</strong><br />
befolgen, damit es dem Staat ähnlich<br />
wohlergehe wie dem Himmel. Dies geschieht<br />
allerdings nicht durch Zwang,<br />
sondern durch Bildung. Je mehr Menschen<br />
die Schriften weiser Männer studieren<br />
und Einsicht in das Wesen der<br />
Sittengesetze erlangen, desto besser<br />
ergeht es dem Gemeinwesen.<br />
Der erste Kontakt mit dem Katholizismus<br />
war intellektuell, kein Damaskuserlebnis.<br />
Einige konfuzianische Gelehrte<br />
entdeckten am kaiserlichen Hof <strong>zu</strong> Peking<br />
christliche Schriften und versprachen<br />
sich von der Erlösungshoffnung<br />
der Christen einen Ausweg aus den endlosen<br />
Diskussionen über den rechten<br />
Weg im Diesseits. Die erste Taufe eines<br />
konfuzianischen Gelehrten ist 1784 bezeugt.<br />
Zulauf bekamen diese „Ur“-Gemeinden<br />
aus den Reihen der landlosen<br />
Bauern, die vom Erfolg der konfuzianischen<br />
Mittelschichten ausgeschlossen<br />
waren. Trotz blutiger Christenverfolgungen<br />
im 19 Jhdt. gibt es heute 3,2 Mio<br />
Katholiken in <strong>Korea</strong>. Ihnen stehen 8,7<br />
Mio Protestanten gegenüber, so dass<br />
etwas ¼ der 47 Mio Südkoreaner Christen<br />
sind. Die protestantische Mission<br />
wurde von amerikanischen Missionaren<br />
im ausgehenden 19. Jhdt. betrieben,<br />
allen voran den Presbyterianern<br />
und Methodisten, deren pragmatische<br />
Diesseitigkeit die Modernisierung des<br />
Sozialsystems in <strong>Korea</strong> vorantrieb und
damit als tatkräftige Variante der konfuzianischen<br />
Kontemplation galt. Nicht<br />
unterschätzt werden sollte auch die politische<br />
Dimension. Wer sich <strong>zu</strong>m Protestantismus<br />
bekannte, erwies sich als<br />
aufgeschlossen gegenüber der Öffnung<br />
der asiatischen Gesellschaften gegenüber<br />
dem Einfluss der westlichen Moderne.<br />
Im 20. Jhdt. verliehen die Leiden<br />
des <strong>Korea</strong>krieges, die sich nicht mehr<br />
mit Anstrengung <strong>zu</strong>r Erforschung der<br />
rechten Sittenlehre kompensieren ließen,<br />
dem Protestantismus einen gewaltigen<br />
Schub. Zudem sahen viele koreanische<br />
Intellektuelle in der dauerhaften<br />
Teilung des Landes am 38. Breitengrad<br />
eine Niederlage der Weltanschauung<br />
des Konfuzius. Ein geteiltes Reich kann<br />
nicht Abbild der kosmischen Harmonie<br />
und Ordnung sein.<br />
Wirtschaftlicher Wandel in Südkorea<br />
Wie Herr Lee weiter berichtet, hat er<br />
seine Kindheit auf einem Bauernhof verbracht.<br />
Sein Vater produzierte auf seinem<br />
eigenem Bauernhof Reis, Getreide und<br />
Gemüse und gehörte damit <strong>zu</strong> den Nahrungsmittelversorgern<br />
der nahegelegenen<br />
Hauptstadt. Als Herr Lee 16 Jahre alt war,<br />
gab sein Vater den Bauernhof auf und zog<br />
nach Seoul. Damit verkörpert die Familie<br />
unseres Mitsängers offenbar den Strukturwandel<br />
Südkoreas, der Parallelen <strong>zu</strong> der<br />
Entwicklung in Deutschland aufweist. Abgeschnitten<br />
vom Großteil seiner Industrie<br />
stand der südliche Landesteil nach dem<br />
Krieg vor dem Problem, die wenig entwikkelten,<br />
agrarisch geprägten Regionen vor<br />
der Verelendung <strong>zu</strong> bewahren. Die <strong>Korea</strong>ner<br />
beschritten den uns bekannten Weg<br />
weg vom Kleinstbetrieb hin <strong>zu</strong>m Großbetrieb<br />
mit arrondierten Flächen.<br />
Der bäuerliche<br />
Mittelstand<br />
mit seinem<br />
vielfältigen<br />
Angebot<br />
an verbrauchernahwachsendenNahrungsmitteln<br />
schwindet.<br />
An seine<br />
Stelle treten<br />
Monokulturen. Inzwischen ist <strong>Korea</strong> für<br />
die Großproduktion von Nahrungsmitteln<br />
auf Importe angewiesen.<br />
Das Bildungswesen<br />
Mit einer beispiellosen Alphabetisierungskampagne<br />
bereitete die Regierung<br />
nach der Teilung des Landes<br />
1953 die 75% der Bevölkerung, die<br />
nie eine Schule besucht hatten, auf die<br />
Herausforderung einer modernen Industriegesellschaft<br />
vor. Das Schulsystem<br />
verrät deutlich anglo-amerikanische<br />
Einflüsse. Herr Lee erzählt von seinem<br />
Kindergarten, in dem er im Rahmen<br />
der musikalischen Früherziehung<br />
<strong>zu</strong> ersten Mal mit europäischer Musik<br />
in Berührung gekommen ist. Was Herr<br />
Lee Kindergarten nennt, ist eigentlich<br />
eine leistungsorientierte Vorschule, an<br />
die sich eine sechsjährige Grundschule<br />
anschließt.<br />
Die weiterführenden Schulen haben<br />
ihre eigenen Profile entwickelt und<br />
weisen mit ihrem außerordentlich breit<br />
gefächerten Fremdsprachenangebot<br />
auf die Orientierung der koreanischen<br />
NC 2 / 09 9
Wirtschaft weit über die Landesgrenzen<br />
hinaus hin. Herr Lee zählt Englisch,<br />
Japanisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch,<br />
Russisch und Spanisch auf.<br />
Er besuchte ein normales Gymnasium,<br />
hatte dort privaten Musikunterricht und<br />
beendete es mit der Zulassung <strong>zu</strong>r Universität.<br />
Das Sprachenangebot, das<br />
außer Englisch alle romanischen Sprachen<br />
sowie Deutsch umfasste, lässt<br />
darauf schließen, dass ein Europaaufenthalt<br />
<strong>zu</strong>m Bildungsziel gehörte. Herr<br />
Lee wählte Deutsch und Französisch.<br />
Nach der dreijährigen Mittelstufe endet<br />
die Schulpflicht. Die ebenfalls dreijährige<br />
Oberstufe bereitet auf das Studium<br />
an einer der meist privaten Hochschulen<br />
vor. <strong>Korea</strong>nische Eltern seien sehr<br />
ehrgeizig und <strong>zu</strong> großen finanziellen<br />
Opfern bereit, erzählt Herr Lee unter<br />
Zustimmung seiner Kommilitonen.<br />
Deshalb blühen neben dem staatlichen<br />
Schulsystem viele Paukschulen, die an<br />
den hervorragenden Pisaergebnissen<br />
<strong>Korea</strong>s großen Anteil haben.<br />
Die offensive Bildungspolitik wird begleitet<br />
von 5 Fünfjahresplänen, in deren<br />
Folge sich Südkorea vom Reislieferanten<br />
Japans <strong>zu</strong>m weltweit führenden Anbieter<br />
von Infrastruktureinrichtungen,<br />
<strong>zu</strong>m weltgrößten Stahlerzeuger und <strong>zu</strong><br />
Ya-Young Park<br />
Hyun-Jin Lim<br />
Herzlichen Glückwunsch!<br />
10 NC 2 / 09<br />
einem ernsthaften Konkurrenten auf<br />
dem Elektronik und Kraftfahrzeugmarkt<br />
entwickelte. Herrn Lees Bruder arbeitet<br />
als Ingenieur bei Kia Motors.<br />
So ist es dem kleinen ostasiatischen<br />
Land gelungen, ohne vorteilhafte Standortfaktoren<br />
den Industrialisierungsprozess,<br />
der die europäischen Länder 150<br />
Jahre lang prägte, im Zeitraffer von 25<br />
Jahren <strong>zu</strong> durchlaufen.<br />
Herr Lee möchte noch sieben bis<br />
acht Jahre in Deutschland als Sänger<br />
Erfahrung sammeln und dann nach<br />
<strong>Korea</strong> <strong>zu</strong>rückkehren. Welchen Platz er<br />
mit seiner europäischen Ausbildung,<br />
seinem Repertoire und seinen Erfahrungen<br />
im koreanischen Musikleben<br />
anstrebt, wird Thema vieler Gespräche<br />
mit unseren koreanischen Choristen<br />
sein. Eine Anregung vorab: Wir sollten<br />
ihn bei der Gründung eines <strong>Städtischen</strong><br />
<strong>Musikverein</strong>s <strong>zu</strong> Seoul unterstützen.<br />
Grundlagen <strong>zu</strong> diesem Beitrag sind Gespräche<br />
mit Herrn Ha k Yo u n g Le e. Die Angaben<br />
über Geschichte, Land und Leute stammen<br />
aus Ma u L L, Ha n s W. und Iv o M. Ma u L L:<br />
Im Brennpunkt <strong>Korea</strong>. München (Beck) 2004,<br />
<strong>zu</strong>m Konfuzianismus aus sc H o e p s, Ha n s<br />
Jo a c H I M: Religionen. Gütersloh o.J. Einige<br />
Zahlen und Fakten <strong>zu</strong>r Landwirtschaft und<br />
<strong>zu</strong>m Schulsystem sind dem <strong>Korea</strong> Artikel aus<br />
WI k I p e d I a entnommen.<br />
Unsere Gastsängerinnen<br />
verabschieden<br />
sich mit bestandenenKonzertexamen<br />
und<br />
Diplomprüfung!<br />
Bo-Ram Yang
<strong>Kennen</strong> <strong>Sie</strong> <strong>Korea</strong><br />
von Udo Kasprowicz und Hak-Young Lee<br />
NC 2 / 09 11
12 NC 2 / 09
Hak-Young Lee... ...im Gespräch über <strong>Korea</strong> mit... ...Udo Kasprowicz<br />
NC 2 / 09 13
Louis Spohr und die Vokalmusik<br />
Ein Beitrag <strong>zu</strong>m Spohrjahr von Dr. Wolfram Boder<br />
Heide-Marie Spohr ist seit November 2006 Mitglied der Alt-Fraktion<br />
unseres Chores. Im weitverzweigten Stammbaum ihrer Familie taucht<br />
auch irgendwo der Name Louis auf. Und da 2009 nicht nur Händel-,<br />
Haydn- und Mendelssohn- sondern auch Spohrjahr ist, möchten wir hier<br />
die Gelegenheit nutzen, den Musikwissenschaftler und Spohrforscher<br />
Dr. Wolfram Boder <strong>zu</strong> Wort kommen <strong>zu</strong> lassen.<br />
Sein Beitrag erinnert an eines der letzten Universalgenies der Musikgeschichte:<br />
Spohr betätigte sich als Dozent und Musikschriftsteller, er inspirierte<br />
Wagner und Berlioz mit seiner Leitmotividee, als Dirigent war er<br />
bahnbrechend für die moderne Orchesterkultur und als Geigenvirtuose<br />
direkter Konkurrent Paganinis. Seine Violinschule war allseits anerkannt<br />
und seine Oratorien sorgten in Europa für Furore.<br />
Louis Spohr, der <strong>zu</strong> seiner Zeit berühmter als der heute hier<strong>zu</strong>lande<br />
hochgeschätzte Robert Schumann war, verstarb vor 150 Jahren am<br />
22.10.1859 in Kassel.<br />
Lesen <strong>Sie</strong> im Folgenden, was die Öffentlichkeit über ihn dachte und<br />
welche Rolle der Vorfahre von Heide-Marie in den Jahren 1824 bis 1833 im<br />
Musikleben der Stadt <strong>Düsseldorf</strong> spielte.<br />
Ludwig Emil Grimm, der malende<br />
jüngere Bruder von Jacob und Wilhelm<br />
Grimm, machte 1826 seinem Ärger<br />
über das immergleiche Geschwätz einer<br />
Kasseler Mäzenatin mit den folgenden<br />
Worten Luft: „Da ich eigentlich seit<br />
Monaten nicht bei der Malsburg war sie<br />
aber wohl 100 mal bei uns, so kann ich<br />
mich doch noch nicht entschließen hinüber<br />
<strong>zu</strong> ihr <strong>zu</strong> gehn da ich schon ihre<br />
Musick Reise nach Cöln u <strong>Düsseldorf</strong><br />
195 mal gehört u ich sie da noch <strong>zu</strong>m<br />
196 oder wohl 197, 198, 199, 200,<br />
malsten höhren müsste, u ich daß geschwätz<br />
über Musick u den himlischen<br />
Spohr satt habe bis an den Hals. Da sie<br />
nun schon längst gemerkt hat u auch<br />
weis daß ich mir aus dem immerwährenden<br />
Musickspektakel nichts mache,<br />
14 NC 2 / 09<br />
so nimt sie sich in acht so es nur gehn<br />
will aber sie kans nicht über die Seele<br />
bringen u ehe man die Hand umgewendet<br />
sitzt sie wieder in Spohrs himlischen<br />
Compositionen, u das ewige einerlei ist<br />
mir <strong>zu</strong>wieder wie ein Landregen von 6<br />
Monaten.“ 1<br />
Aus diesen Worten lässt sich deutlich<br />
die Popularität ablesen, die der Komponist,<br />
Violinvirtuose, Dirigent und Pädagoge<br />
Louis Spohr Ende der 1820er<br />
Jahre bereits besaß – immerhin war<br />
er offensichtlich ein so häufiges Gesprächsthema<br />
in der Kasseler Bevölkerung,<br />
dass es dem jungen Ludwig Emil<br />
Grimm, der den Musiker Spohr durchaus<br />
schätzte, gehörig auf die Nerven<br />
1 Grimm, Ludwig Emil, Briefe, hrsg. v. Egbert<br />
Koolman, 2 Bde., Marburg 1985, S. 56.
ging. Auch das hier angesprochene<br />
Musikereignis bestätigt das. Caroline<br />
von der Malsburg hatte Spohr im Mai<br />
1826 bei seiner Reise <strong>zu</strong>m rheinischen<br />
Musikfest in <strong>Düsseldorf</strong> begleitet, wo<br />
er sein neues Oratorium Die letzten<br />
Dinge dirigiert hatte. Auch die <strong>Düsseldorf</strong>er<br />
fanden offensichtlich Gefallen<br />
an Spohrs Musik, denn das Oratorium<br />
wurde hier so enthusiastisch aufgenommen,<br />
dass das Musikfest kurzerhand<br />
um einen Tag verlängert wurde,<br />
um eine zweite Aufführung des Werkes<br />
<strong>zu</strong> ermöglichen. In England sollte das<br />
Werk dann sogar noch mehr Furore<br />
machen.<br />
Überhaupt spielt die Vokalmusik in<br />
Spohrs Leben von Anfang an eine<br />
bedeutende Rolle. Kaum dass er seine<br />
ersten erhaltenen Kompositionen,<br />
die drei Violinduos WoO 21, die er als<br />
Zwölfjähriger gemeinsam mit seinem<br />
Geigenlehrer uraufgeführt hatte, vollendet<br />
hatte, wagte er sich inspiriert<br />
von diesem Erfolg an die Komposition<br />
einer Oper. Allerdings realisierte er<br />
nur die Ouvertüre und einen Chor, die<br />
sich leider nicht erhalten haben, bevor<br />
er einsehen musste, dass dieses Unterfangen<br />
doch noch eine Nummer <strong>zu</strong><br />
groß für ihn war. Immerhin führte die<br />
Kritik des Vaters an dem abgebrochenen<br />
Projekt da<strong>zu</strong>, dass Louis von nun<br />
an mit Akribie bemüht war, jedes einmal<br />
begonnene Werk auch tatsächlich<br />
<strong>zu</strong> vollenden.<br />
Mit fünfzehn Jahren entschied er sich<br />
für eine Karriere als Berufsmusiker und<br />
nach dem gescheiterten Versuch einer<br />
Konzertreise nach Hamburg fand<br />
er eine feste Anstellung als Geiger im<br />
herzoglichen Hoforchester seiner Heimatstadt<br />
Braunschweig. Mit 21 Jahren<br />
Abb. 1: Portrait Louis Spohrs, Stahlstich von<br />
Carl Meyer nach einem Gemälde von Johann<br />
Friedrich Wilhelm Roux (1838), nach 1838.<br />
Aus der Sammlung W. Boder.<br />
wurde er dann in Gotha <strong>zu</strong>m jüngsten<br />
Konzertmeister Deutschlands. Hier war<br />
es wieder eine Vokalkomposition, die<br />
einen entscheidenden Wendepunkt im<br />
Leben des Geigers Louis Spohr markieren<br />
sollte. Für die Hofsängerin Susanne<br />
Scheidler komponierte er die<br />
Gesangsszene Oskar! Umsonst! Nicht<br />
ganz ohne Hintergedanken vermutlich,<br />
denn er hatte sich in ihre Tochter, die<br />
begabte Harfenistin Dorette Scheidler<br />
verliebt. Offensichtlich half die Konzertarie<br />
dabei, die („alleinerziehende“)<br />
Hofsängerin von Spohrs Qualitäten als<br />
Schwiegersohn <strong>zu</strong> überzeugen, denn<br />
am 2. Februar 1806 konnte er seine<br />
Angebetete in der Gothaer Hofkapelle<br />
heiraten. Mit ihr gemeinsam begeisterte<br />
er in den folgenden Jahren auf verschiedenen<br />
Konzertreisen das Publikum<br />
in ganz Europa.<br />
NC 2 / 09 15
Die nächste Station seines Wirkens<br />
sollte dann ab 1813 Wien werden. Hier<br />
entstand seine Oper Faust, die neben<br />
E.T.A. Hoffmanns Undine als erste romantische<br />
Oper gilt. <strong>Sie</strong> konnte aufgrund<br />
von Theaterintrigen <strong>zu</strong>nächst<br />
nicht aufgeführt werden und erst Carl<br />
Maria von Weber verhalf ihr 1816 in<br />
Prag <strong>zu</strong>r Uraufführung. Von da an war<br />
ihr <strong>Sie</strong>ges<strong>zu</strong>g aber kaum mehr auf<strong>zu</strong>halten<br />
und schon bald hatte sie sich<br />
einen festen Platz auf den Spielplänen<br />
der Opernhäuser Europas erobert. 1852<br />
bestellte die englische Königin Victoria<br />
sogar eine Umarbeitung des Werks <strong>zu</strong>r<br />
großen Oper, bei der die <strong>zu</strong>vor gesprochenen<br />
Texte ebenfalls in Musik gesetzt<br />
wurden. Nach den wichtigen Wiener<br />
Jahren konnte Spohr sich 1816 endlich<br />
den lang gehegten Wunsch einer<br />
Italienreise erfüllen. Für die Konzerttournee<br />
im Land der Oper ließ sich der<br />
Violinvirtuose etwas ganz besonderes<br />
einfallen. Er komponierte ein Violinkonzert<br />
in Form einer Gesangsszene (Nr.<br />
8 in a-Moll, op 47). Es begeisterte nicht<br />
nur die Italiener und gehört bis heute <strong>zu</strong><br />
seinen beliebtesten Werken.<br />
Zunehmende gesundheitliche Probleme<br />
Dorettes ließen ab 1820 das Leben<br />
als reisende Virtuosen bald unmöglich<br />
werden und so nahm Spohr 1822 die<br />
Stelle als Hofkapellmeister in der kurhessischen<br />
Residenzstadt Kassel an,<br />
in der er den Rest seines Lebens verbringen<br />
sollte. Hier war es wieder ein<br />
Vokalwerk, das diesen wichtigen Einschnitt<br />
markierte und mit dem er gleich<br />
die Herzen (nicht nur) des Kasseler<br />
Publikums eroberte. In seinem ersten<br />
Kasseler Jahr vollendete er die Komposition<br />
seiner Oper Jessonda, die am<br />
16 NC 2 / 09<br />
28. Juli 1823 im Hoftheater uraufgeführt<br />
wurde. Auch sie sollte bald in ganz<br />
Europa Verbreitung finden. Daneben<br />
kümmerte er sich aber auch unermüdlich<br />
um die Förderung der bürgerlichen<br />
Musikkultur und die Kasseler Chorszene<br />
dürfte bis heute von seinem Wirken<br />
profitieren. Schon bald nach seiner Ankunft<br />
gründete er einen Laienchor, dessen<br />
Mitglieder sich aus der Kasseler<br />
Bürgerschaft rekrutierten und der nach<br />
seinem Gründungstag „Cäcilienverein“<br />
genannt wurde. Damit leistete er Entscheidendes<br />
für die Kasseler Musiklandschaft,<br />
denn der Chor wurde nicht<br />
nur <strong>zu</strong>m Hauptakteur der später eingeführten<br />
Karfreitagskonzerte, sondern er<br />
bildete auch die Keimzelle zahlreicher<br />
späterer Kasseler Laienchöre. Hätte<br />
der Kurfürst diese „außerdienstlichen“<br />
Aktivitäten nicht so misstrauisch und<br />
neidisch verfolgt und oft genug auch<br />
nach Kräften boykottiert, so hätte Kassel<br />
sogar die Ehre gehabt, noch vor<br />
Mendelssohns berühmten Konzert <strong>zu</strong>m<br />
Ort der ersten Wiederaufführung der<br />
„Matthäuspassion“ Johann Sebastian<br />
Bachs <strong>zu</strong> werden. Die Idee <strong>zu</strong>r Gründung<br />
eines solchen Chores hatte Spohr<br />
schon am Tag nach seiner Ankunft auf<br />
einer Soirée, wie er in seinen Lebenserinnerungen<br />
schreibt: „Ich traf dort<br />
die Dilettanten der Stadt, die sämtlich<br />
sangen, und zwar in sehr schlechter<br />
Manier. Da aber viele darunter mit guten<br />
Stimmen begabt waren, so brachte<br />
mich das auf die Idee, meine Wirksamkeit<br />
mit der Errichtung eines Gesangsvereins<br />
<strong>zu</strong> beginnen. Ich knüpfte daher<br />
mit einigen der Sänger Bekanntschaft<br />
und teilte ihnen meine Idee mit, und da<br />
sie sich <strong>zu</strong> interessieren schienen, so<br />
beredete ich mit ihnen, dass wir uns
an einem der folgenden Tage versammeln<br />
wollten, um alles Erforderliche <strong>zu</strong><br />
bereden.“ 2<br />
Durch seine gründliche und unermüdliche<br />
Probenarbeit stand ihm mit<br />
diesem Chor schon bald ein Ensemble<br />
<strong>zu</strong>r Verfügung, mit dem er dem Kasseler<br />
Publikum Werke des zeitgenössischen<br />
Repertoires ebenso vorstellen<br />
konnte wie Kompositionen des 17. und<br />
18. Jahrhunderts, etwa Motetten von<br />
Johann Sebastian Bach. Spohr und<br />
seine Sängerinnen und Sänger waren<br />
dabei fest im sozialen und politischen<br />
Leben der Stadt verankert. Als im Jahre<br />
1830 die revolutionäre Stimmung da<strong>zu</strong><br />
führte, dass auch in Kassel die Ständeversammlung<br />
erstmals seit sehr langer<br />
Zeit wieder <strong>zu</strong>sammentrat, war auch<br />
der „Cäcilienverein“ an den Feiern <strong>zu</strong><br />
diesem Ereignis beteiligt. Der Kasseler<br />
Kunstprofessor Friedrich Müller erinnerte<br />
sich später: „Der Gottesdienst<br />
begann mit Absingung des: Herr Gott,<br />
Dich loben wir! durch die Kasseler Gesangsvereine<br />
und unter Mitwirkung des<br />
Opernpersonals und des Orchesters<br />
mit Spohr an der Spitze. Die Execution<br />
ist eine so glänzende gewesen, daß<br />
man nur von ihr und nicht von der ihr<br />
nachfolgenden Festpredigt sprach.“ 3<br />
Auch Louis Spohr erwähnt das Ereignis<br />
in seinen Lebenserinnerungen: „Am<br />
folgenden Tage wurde die Eröffnung<br />
der Ständeversammlung durch einen<br />
feierlichen Gottesdienst in der großen<br />
Kirche begangen und auf Befehl der<br />
Regierung durch einen vom Cäcilien-<br />
2 Louis Spohr, Lebenserinnerungen, hg. von<br />
Volker Göthel, 2. Band, Tutzing 1968, S. 130.<br />
3 Friedrich Müller, Kassel seit siebzig Jahren, 1.<br />
Band, Kassel 1893, S. 227.<br />
vereine mit Begleitung des Orchesters<br />
ausgeführten festlichen Kirchengesang<br />
verherrlicht. Ich wählte da<strong>zu</strong> die Schlußnummer<br />
meiner in Wien komponierten<br />
Kantate: ‘Das befreite Deutschland’ mit<br />
dem darin vorkommenden Soloquartett<br />
und der Schlußfuge: ‘Lasset uns den<br />
Dankgesang erheben’, einen vierstimmigen<br />
Choral, der abwechselnd mit der<br />
Gemeinde gesungen wurde, und das<br />
Halleluja aus Händels ‘Messias’.“ 4<br />
Tatsächlich ging die Initiative <strong>zu</strong> dem<br />
musikalischen Beitrag nicht auf die Regierung<br />
sondern auf eine Petition der<br />
Kasseler Bürgerschaft <strong>zu</strong>rück, der Spohrs<br />
ausgesprochen liberale Gesinnung<br />
nicht entgangen war. Der Hofkapellmeister<br />
hatte sich bei der Regierung lediglich<br />
die Genehmigung für die Teilnahme<br />
einholen müssen. Spohr hatte sich im<br />
Laufe der Zeit <strong>zu</strong> einer Identifikationsfigur<br />
des liberalen Kasseler Bürgertums<br />
entwickelt und der „Cäcilienverein“ hatte<br />
dabei eine nicht unwesentliche Rolle<br />
gespielt. Anlässlich einer Feier dieses<br />
Vereins im November 1831 fasst Friedrich<br />
Müller das mit den folgenden Worten<br />
<strong>zu</strong>sammen, in denen auch das soziale<br />
Engagement Spohrs <strong>zu</strong>m Ausdruck<br />
kommt: „Spohr leitete dieselbe. Durch<br />
seine lebhafte Betheiligung am Dienste<br />
der Bürgerwehr und Kundgebung äußerst<br />
liberaler Gesinnung hatte er sich<br />
inzwischen die Sympathien auch der<br />
nicht musikalischen Kreise erworben.<br />
Er wurde <strong>zu</strong> den bedeutenderen patriotischen<br />
Persönlichkeiten gerechnet.<br />
Zum Vortrag bei der Feier kamen unter<br />
anderem das ‘Vater unser’ von Fesca,<br />
die ‘Hymne an die heilige Cäcilia’ und<br />
4 Louis Spohr, Lebenserinnerungen, hg. von<br />
Volker Göthel, 2. Band, Tutzing 1968, S. 150.<br />
NC 2 / 09 17
Abb. 2: Ludwig Emil Grimm, Louis Spohr dirigiert, Skizze 1850<br />
© Brüder Grimm-Museum, Kassel: Hz 349 (K148)<br />
das ‘Te Deum laudamus’ von Händel;<br />
am Schluß noch ein Streichquintett, bei<br />
dem Spohr die erste Geige vertrat, was<br />
einen solchen Beifallssturm hervorrief,<br />
daß sich das ganze Fest <strong>zu</strong> einer Ovation<br />
für ihn selbst verwandelt <strong>zu</strong> haben<br />
schien. Die eingesammelten, einen hohen<br />
Betrag bildenden Gaben flossen<br />
der in einem hohen Grad <strong>zu</strong>nehmenden<br />
Armuth <strong>zu</strong>.“ 5<br />
Die Kasseler Gesangsvereine profitierten<br />
auch von der gründlichen musikalischen<br />
Ausbildung, die Spohr den jungen<br />
Schülerinnen und Schülern angedeihen<br />
ließ, die schon bald aus ganz Europa<br />
nach Kassel strömten. Spohr verfolgte<br />
in der Ausbildung seiner Schüler näm-<br />
5 Friedrich Müller, Kassel seit siebzig Jahren, 1.<br />
Band, Kassel 1893, S. 231.<br />
18 NC 2 / 09<br />
lich einen bemerkenswert modernen,<br />
ganzheitlichen Ansatz. So bestand er<br />
auf dem Erlernen von mindestens einer<br />
Fremdsprache, geistiger Bildung und<br />
sportlicher Betätigung. Während immer<br />
mehr seiner Kollegen den Weg einer<br />
Spezialisierung auf das virtuose Spiel<br />
einschlugen, mussten Spohrs Schüler<br />
auch auf unterschiedlichen Positionen<br />
in seinem Orchester mitspielen und ein<br />
zweites Orchesterinstrument erlernen.<br />
<strong>Sie</strong> erlangten so wertvolle Erfahrungen,<br />
die ihnen im späteren Berufsalltag<br />
unschätzbare Dienste leisteten. Auch<br />
auf die Pflege der Kammermusik legte<br />
Spohr größten Wert. Er versuchte, den<br />
musikalischen Horizont seiner Schüler<br />
möglichst weit <strong>zu</strong> halten und das Verständnis<br />
für unterschiedliche Musik <strong>zu</strong><br />
wecken, wie er es selbst als Orche
sterleiter vorlebte. Da sie sich auch<br />
als Dirigenten in den Gesangs- und<br />
Orchestervereinen betätigten, standen<br />
diesen dadurch umfassend ausgebildete<br />
Leiter <strong>zu</strong>r Verfügung. Insgesamt<br />
bildete Spohr über 200 Schülerinnen<br />
und Schüler aus, die das europäische<br />
Musikleben in der zweiten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts entscheidend mitprägen<br />
sollten.<br />
Zu ihnen gehören neben vielen anderen<br />
auch der Liederkomponist Karl<br />
Friedrich Curschmann, der Komponist<br />
der finnischen Nationalhymne und „Vater<br />
der finnischen Musik“ Frederik Pacius,<br />
der Begründer der New Yorker<br />
Philharmoniker Ureli Corelli Hill und der<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Komponist Norbert Burgmüller.<br />
Geboren wurde Burgmüller 1810 in<br />
<strong>Düsseldorf</strong>. Sein älterer Bruder Friedrich<br />
ist noch heute vielen Pianisten wegen<br />
seiner Etüden bekannt, während<br />
Norberts Rhapsodie für Klavier in h-<br />
Moll und seine Klaviersonate in f-Moll<br />
Werke von höchster Qualität sind, die<br />
viel <strong>zu</strong> selten gespielt werden. Norbert<br />
Burgmüller kam 1824 <strong>zu</strong> Spohr nach<br />
Kassel. Hier blieb er auch nach dem<br />
Ende seiner Studien 1827 noch bis<br />
1830. Er spielte im Hoforchester und<br />
leitete zeitweise den „Cäcilienverein“.<br />
Unter Spohrs Dirigat spielte er am 14.<br />
Januar 1830 die Uraufführung seines<br />
Klavierkonzerts fis-Moll op.1, das 1834<br />
auch von Mendelssohn in <strong>Düsseldorf</strong><br />
gespielt werden sollte. Bei seiner Tätigkeit<br />
im Theater lernte er die Sopranistin<br />
Sophia Roland kennen, mit der er<br />
sich verlobte. Als diese auf einer Konzertreise<br />
nach Paris im Oktober 1830<br />
starb, stürzte er in tiefe Depressionen.<br />
Er begann <strong>zu</strong> trinken und kehrte nach<br />
<strong>Düsseldorf</strong> <strong>zu</strong>rück. Der von ihm anvisierte<br />
Posten als Musikdirektor wurde<br />
an Mendelssohn vergeben. Dennoch<br />
freundeten sich die etwa gleichaltrigen<br />
Musiker an. Doch auch als Mendelssohn<br />
<strong>Düsseldorf</strong> 1835 wieder verließ,<br />
wurde er bei der Neuvergabe der Stelle<br />
nicht bedacht. Der vermutlich an<br />
manischen Depressionen und Epilepsie<br />
leidende Burgmüller fand in dem<br />
ebenfalls enttäuschten Dietrich Grabbe<br />
einen Leidensgenossen, mit dem er<br />
ausgiebige Zechgelage feierte. 1836<br />
kam er bei einem Kuraufenthalt in Aachen<br />
während eines Bades unter ungeklärten<br />
Umständen <strong>zu</strong> Tode. In seinem<br />
kurzen und tragischen Leben schuf er<br />
bedeutende Werke, die besonders von<br />
Robert Schumann sehr geschätzt wurden.<br />
Dieser unternahm sogar den Versuch,<br />
Burgmüllers Fragment gebliebene<br />
2. Symphonie <strong>zu</strong> vollenden.<br />
Auch Spohr selbst traf übrigens Grabbe<br />
in <strong>Düsseldorf</strong>. Seine Schilderung<br />
dieser Begegnung illustriert anschaulich<br />
den trockenen Humor des Musikers, der<br />
mit seinen 1,92 Metern <strong>zu</strong> den größten<br />
Kasselern seiner Zeit gehörte: „Als ich<br />
von da <strong>zu</strong> Immermann ging, proponierte<br />
mir dieser einen Besuch bei Grabbe,<br />
der sich damals auf Immermanns Einladung<br />
in <strong>Düsseldorf</strong> aufhielt, und so<br />
lernte ich diesen Sonderling noch an<br />
demselben Morgen kennen. Als wir bei<br />
ihm eintraten, und der kleine Mensch<br />
mich Koloß <strong>zu</strong> Gesicht bekam, zog er<br />
sich schüchtern in eine Ecke seines<br />
Zimmers <strong>zu</strong>rück, und die ersten Worte,<br />
die er <strong>zu</strong> mir sprach, waren: ,Es wäre<br />
Ihnen ein leichtes, mich da <strong>zu</strong>m Fenster<br />
hinaus<strong>zu</strong>werfen.’ Ich antwortete:<br />
NC 2 / 09 19
Abb. 3: Der Spohr-Schüler Ureli Corelli Hill<br />
gründete 1842 die New Yorker Philharmoniker<br />
© New York Philharmonic, Archive, mit besonderem<br />
Dank an Barbara Haws, Archiv der New<br />
Yorker Philharmoniker<br />
,Ja, ich könnte es wohl, aber darum bin<br />
ich nicht hierher gekommen.’ Erst nach<br />
dieser komischen Szene stellte mich<br />
nun Immermann dem närrischen, aber<br />
interessanten Menschen vor.“ 6<br />
Ein weiteres Gebiet, auf dem Spohr<br />
vor allem in seiner Kasseler Zeit Furore<br />
machte, war das des Oratoriums, wie<br />
schon <strong>zu</strong> Beginn dieses Artikels angeklungen<br />
ist. Sein erstes Werk in dieser<br />
Gattung war das Oratorium Das jüngste<br />
Gericht gewesen, das er 1812 für das<br />
von ihm geleitete Musikfest in Frankenhausen<br />
geschrieben hatte. Sein zweites<br />
Oratorium, Die letzten Dinge, entstand<br />
in Kassel und wurde hier am Karfreitag<br />
des Jahres 1826 uraufgeführt.<br />
Teile daraus probierte er bereits im November<br />
1825 in einem Konzert mit dem<br />
6 Louis Spohr, Lebenserinnerungen, hg. von<br />
Volker Göthel, 2. Band, Tutzing 1968, S. 165f.<br />
20 NC 2 / 09<br />
„Cäcilienverein“ aus. Dabei bemerkte<br />
er, dass das Werk auf Ausführende und<br />
Zuhörer einen tiefen Eindruck machte.<br />
In einem Brief an Wilhelm Speyer bemerkte<br />
er: „Diese Wahrnehmung war<br />
für mich von größter Wichtigkeit, indem<br />
sie mir die Überzeugung gab, den<br />
rechten Stil für dieses Werk gefunden<br />
<strong>zu</strong> haben. Ich habe mich nämlich bemüht,<br />
recht einfach, fromm und wahr im<br />
Ausdruck <strong>zu</strong> sein und habe alle Künsteleien,<br />
alles Schwülstige und Schwierige<br />
sorgfältig vermieden. Der Gewinn ist:<br />
leichte Ausführbarkeit von Dilettantenvereinen,<br />
für die das Werk doch <strong>zu</strong>nächst<br />
bestimmt ist, und dadurch ein<br />
leichteres Eingehen in meine Ideen<br />
<strong>beim</strong> großen Publikum.“ 7 Der große<br />
Erfolg, den das Werk in den folgenden<br />
Jahren vor allem in Deutschland und<br />
England haben sollte, bestätigte, dass<br />
Spohr mit diesen Überlegungen richtig<br />
lag.<br />
Sein nächstes Oratorium, Des Heilands<br />
letzte Stunden, entstand wieder in<br />
Kassel, zwischen 1833 und 1836. 1839<br />
dirigierte er das Werk bei einem großen<br />
Musikfest in Norwich und festigte damit<br />
den guten Ruf, den er sich auch in England<br />
erworben hatte. Dafür hatte nicht<br />
<strong>zu</strong>letzt eine Aufführung von Die letzten<br />
Dinge bei dem gleichen Musikfest im<br />
Jahr 1830 gesorgt. Der sensationelle<br />
Erfolg wird illustriert von der Reaktion<br />
der berühmten Sopranistin Maria Malibran,<br />
die die Sopranpartie sang und<br />
dermaßen überwältigt wurde, dass sie<br />
das Orchester schluchzend verlassen<br />
musste. Der erneute Erfolg 1839 trug<br />
Spohr den Auftrag ein, für das nächste<br />
Musikfest im Jahr 1842 ein weiteres<br />
Oratorium <strong>zu</strong> komponieren. Da der<br />
7 Ztiert nach: Clive Brown, Louis Spohr, Kassel<br />
2009, S. 210.
Kurfürst ihm den nötigen Urlaub nicht<br />
gewährte, konnte Spohr die Aufführung<br />
von Der Fall Babylons in Norwich 1842<br />
nicht selbst leiten. Als er das Werk aber<br />
1843 in London dirigierte, spielten sich<br />
gerade<strong>zu</strong> unglaubliche Szenen ab. Bei<br />
der Aufführung in Exeter Hall waren<br />
die über dreitausend Sitzplätze restlos<br />
ausverkauft und Marianne Spohr, die<br />
zweite Frau des Komponisten, berichtete<br />
über den tosenden Applaus: „Am<br />
Schluß wußten die Menschen ihrem<br />
Jubel nichts Neues mehr hin<strong>zu</strong><strong>zu</strong>setzen,<br />
erhöhten ihn aber buchstäblich<br />
dadurch, daß sie sich dabei nun Alle<br />
auf die Bänke stellten“ 8 .<br />
Leider gerieten die Qualität der Werke<br />
Spohrs und sein kaum <strong>zu</strong> über-<br />
8 Zitiert nach: Clive Brown, Louis Spohr, Kassel<br />
2009, S. 335.<br />
schätzender Einfluss auf die Entwicklung<br />
der europäischen Musik mit dem<br />
ausgehenden 19. Jahrhundert etwas in<br />
Vergessenheit. Dies gilt in besonderem<br />
Maße auch für seine Vokalmusik. Erst<br />
in jüngster Zeit wird er von einer neuen<br />
Generation von Musikern und Wissenschaftlern<br />
wieder stärker gewürdigt<br />
und es steht <strong>zu</strong> hoffen, dass sich seine<br />
Werke wieder einen festen Platz im Repertoire<br />
erobern. Dabei gibt es auf dem<br />
Gebiet der Vokalmusik viel <strong>zu</strong> entdekken.<br />
Nicht nur die Oratorien, auch die<br />
A-capella-Messe für fünf Solostimmen<br />
und fünfstimmigen Doppelchor, seine<br />
Chorlieder und zahlreiche andere Werke<br />
hätten es mehr als verdient, wieder<br />
stärker gewürdigt <strong>zu</strong> werden.<br />
Abb. 4: Das Spohr-Denkmal in Kassel (Bronzestandbild von Carl Ferdinand Hartzer, errichtet 1883),<br />
Postkarte des frühen 20. Jahrhunderts aus der Sammlung W. Boder<br />
NC 2 / 09 21
Dr. Wolfram Boder<br />
wurde 1971 in Kassel<br />
geboren. Er studierte<br />
Musik- und Theaterwissenschaft<br />
in München<br />
und Berlin. Bei<br />
Prof. Gerd Rienäcker<br />
promovierte er an der<br />
Humboldt-Universität<br />
<strong>zu</strong> Berlin über das Thema<br />
„Entwicklungslinien<br />
in den Kasseler Opern<br />
Louis Spohrs. Musikdramaturgische<br />
Befunde in<br />
ihrem gesellschaftlichen<br />
Kontext“ (erschienen<br />
2007 im Bärenreiter-<br />
Verlag, Kassel). Boder<br />
lebt als freier Musikwissenschaftler<br />
und Publizist<br />
in Kassel. Neben<br />
seiner Tätigkeit für das<br />
Lektorat des Merseburger<br />
Verlags setzt er sich<br />
hauptsächlich mit dem<br />
Leben und Werk Louis<br />
Spohrs auseinander.<br />
Zuletzt aktualisierte und<br />
übersetzte er eine Biographie<br />
Louis Spohrs<br />
aus dem Englischen.<br />
Damit steht der musikinteressiertenÖffentlichkeit<br />
in Deutschland<br />
erstmals eine wissenschaftlich<br />
fundierte,<br />
ausführliche Biographie<br />
Louis Spohrs <strong>zu</strong>r Verfügung.<br />
Das erste und<br />
grundlegende Werk dieser<br />
Art verfasste 1984<br />
der englische Spohr-<br />
Forscher Clive Brown.<br />
Zum 225. Geburtstag<br />
Spohrs überarbeite sie<br />
Boder gemeinsam mit<br />
dem Autor und übersetzte<br />
sie ins Deutsche.<br />
Das Buch schildert<br />
anschaulich das<br />
Leben und Wirken des<br />
großen Komponisten,<br />
Dirigenten, Violinvirtuosen<br />
und Pädagogen,<br />
dessen wegweisende<br />
Bedeutung auch heute<br />
noch weitgehend unterschätzt<br />
wird. Es ist im<br />
Buchhandel oder direkt<br />
22 NC 2 / 09<br />
<strong>beim</strong> Verlag Merseburger<br />
(www.merseburger.<br />
de) erhältlich.<br />
Hinweis<br />
der Redaktion:<br />
Spohrs Violinkonzert in<br />
Form einer Gesangsszene<br />
Nr. 8 in a-Moll,<br />
op 47 wird am 20.,<br />
22. und 23.11.2009 im<br />
Sternzeichen 4 <strong>zu</strong>sammen<br />
mit Mendelssohns<br />
„Lobgesang“ in der<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong> <strong>zu</strong><br />
hören sein.
Der Komponist Sigismund Neukomm<br />
Neues vom Schüler Joseph Haydns von Erich Gelf<br />
Sigismund (Ritter von) Neukomm<br />
(geb. 10.07.1778 in Salzburg - gest.<br />
03.04.1858 in Paris), ein in Salzburg<br />
und Wien ausgebildeter Komponist,<br />
Dirigent, Pianist und Orgelvirtuose,<br />
war <strong>zu</strong> seiner Zeit in ganz Europa und<br />
in Brasilien in seinen musikalischen<br />
Sparten und darüber hinaus als Lehrer,<br />
Theoretiker und Kritiker bekannt und<br />
höchst anerkannt.<br />
Im Vorjahre wäre <strong>zu</strong> seinem 150.<br />
Todestag wenigstens an den Komponisten<br />
Sigismund Neukomm <strong>zu</strong> erinnern<br />
gewesen. Aber selbst in seiner<br />
Geburtsstadt Salzburg reichte es nur<br />
<strong>zu</strong>r Aufführung einer seiner Ouvertüren<br />
<strong>zu</strong>m Auftakt der Sommerakademie der<br />
Universität Salzburg. Und auch das nur<br />
- so darf man mutmaßen - weil der damalige<br />
Dirigent, Lavard Skou-Larsen,<br />
gebürtiger Brasilianer ist. 1<br />
Jede andere Stadt hätte ihrem berühmten<br />
„Sohne“ schon bald nach seinem<br />
Tode ein Denkmal gesetzt. Aber<br />
in der Salzburger Altstadt liegt das Geburtshaus<br />
Sigismund Neukomms im<br />
Eckhaus am Hagenauerplatz schräg<br />
gegenüber von Mozarts Geburtshaus<br />
in der Getreidegasse 9. In der Getreidegasse<br />
9 ist seit 1880 ein Mozart-<br />
Museum eingerichtet, das jährlich von<br />
zehntausenden Touristen besucht wird.<br />
Vielleicht bemerkt der Eine oder die<br />
Andere die Gedenktafel, die an dem<br />
Geburtshaus Neukomms angebracht<br />
wurde. Dabei war es <strong>zu</strong> einem Teil Neukomms<br />
Verdienst, dass Mozarts - und<br />
1 „Geboren Mozart schräg gegenüber“ CD-<br />
Kritiken DrehPunktKultur Salzburg vom 12.05.09<br />
www.drehpunktkultur.at/txt09-05/0327.html<br />
auch J. Haydns 2 - Werke nach deren<br />
Tode weiterhin aufgeführt wurden, weil<br />
er sich mit seiner Berühmtheit erfolgreich<br />
und unermüdlich dafür einsetzte.<br />
Woher kennen wir<br />
Sigismund Neukomm?<br />
Unsere Zeitschrift hat in Ausgabe Nr.<br />
2/07 unter der Überschrift >Fundsache:<br />
Ein „vollendetes“ Mozart-Requiem aus<br />
Brasilien von 1821< über eine zeitgenössische<br />
Ergän<strong>zu</strong>ng der sog. „Süßmayr-Fassung“<br />
durch Sigismund Ritter<br />
von Neukomm berichtet, die das Spezial-Label<br />
K617 aus Sarrebourg/Moselle<br />
auf CD herausgebracht hatte. 3 Diese<br />
Erstveröffentlichung nahmen wir <strong>zu</strong>m<br />
Anlass, umfassend über Sigismund<br />
Neukomm und sein Werk sowie über<br />
den Hintergrund des Labels K617 <strong>zu</strong><br />
berichten.<br />
Bei einem Aufenthalt am damals in<br />
Rio de Janeiro residierenden portugiesischen<br />
Königshofe von 1816 bis 1821<br />
beeinflusste er das klassische Musikleben<br />
Brasiliens auf Dauer maßgeblich.<br />
Für eine Aufführung in Rio de Janeiro<br />
ergänzte er im Geiste Mozarts dessen<br />
Requiem um das für die Messliturgie<br />
erforderliche, aber in der „Süßmayr-<br />
Fassung“ fehlende, Schlussstück „Libera<br />
me, Domine“.<br />
Dieser Beitrag verhalf übrigens unserer<br />
Zeitschrift <strong>zu</strong> Wikipedia-Ehren. Die<br />
2 MGG Digitale Bibliothek Bd. 60, Berlin 2001,<br />
Stichwort: Sigismund Neukomm, letzter Absatz<br />
3 CD: W.A.Mozart, Requiem K.626 (conclu par<br />
Sigismund Neukomm) harmonia mundi, 2005<br />
K617180<br />
NC 2 / 09 23
„Freie Enzyklopädie Wikipedia“ berichtigte<br />
und ergänzte ihren Artikel über<br />
das Mozart-Requiem <strong>beim</strong> Abschnitt<br />
„Neufassungen/Historische Bearbeitungen“<br />
entsprechend den Informationen<br />
in unserer Veröffentlichung. In der Fußnote<br />
da<strong>zu</strong> setzte sie unter Namensnennung<br />
unserer Zeitschrift und des Autors<br />
einen Link auf die Web-Seite des <strong>Städtischen</strong><br />
<strong>Musikverein</strong>s <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong>.<br />
Wer diesen Link schaltet, erreicht den<br />
Text des angeführten Artikels. Versuchen<br />
<strong>Sie</strong> es einmal; der Text ist immer<br />
noch interessant und aktuell. 4<br />
Neue Informationen <strong>zu</strong>m Leben und<br />
Wirken von Sigismund Neukomm<br />
In unserer o. g. ersten Veröffentlichung<br />
über Sigismund Neukomm haben<br />
wir umfangreiche Fakten seiner<br />
Biografie <strong>zu</strong>sammengestellt. Bei einer<br />
heutigen Internet-Recherche über ihn<br />
bekommt man allerdings deutlich mehr<br />
Ergebnisse als bei der Arbeit an dem<br />
ersten Artikel Mitte 2007.<br />
Der Aufenthalt in Brasilien<br />
Die Umstände seiner Reise an den<br />
portugiesischen Hof in Brasilien im<br />
Jahre 1816 werden etwas deutlicher.<br />
Wegen der schlechten Quellenlage<br />
konnte sogar gemutmaßt werden, dass<br />
Neukomm sich ursprünglich als Spion<br />
mit nach Rio de Janeiro einschiffte. Wir<br />
kennen heute aus der Passagierliste<br />
des Seglers, wer als Begleitung mit<br />
dem Herzog von Luxemburg, der als<br />
Botschafter Frankreichs 1816 an den<br />
portugiesischen Hof entsandt wurde,<br />
nach Brasilien übersetzte. 5<br />
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Requiem_(Mozart)<br />
– dort Fußnote 34 anklicken<br />
5 www.musimen.com/neukomm.htm (in<br />
24 NC 2 / 09<br />
Die Aufgabe des Herzogs war es<br />
wohl, das nach der Niederlage Napoleons<br />
politisch (vorübergehend) royalistisch<br />
neu bestimmte Frankreich bei<br />
dem Nachbarland Portugal wieder<br />
„hoffähig“ <strong>zu</strong> machen. Immerhin musste<br />
sich der gesamte portugiesische<br />
Hofstaat 1807 mit Hilfe der englischen<br />
Flotte vor den einmarschierenden Truppen<br />
Napoleons nach Brasilien retten.<br />
Neben seinem Botschaftspersonal<br />
begleiteten den Herzog französische<br />
Wissenschaftler, wie Bergbauingenieure,<br />
Botaniker, Zoologen und Geographen;<br />
unter ihnen der in Paris arbeitende<br />
deutsche Naturforscher Alexander<br />
von Humboldt und sein Pariser<br />
Forschungspartner, der Botaniker Aimé<br />
Bonpland. Der „compositeur de musique“<br />
Sigismund Neukomm, der wegen<br />
seiner musikalischen Verdienste für das<br />
Ansehen Frankreichs <strong>beim</strong> Wiener Kongress<br />
1815 von König Ludwig XVIII. <strong>zu</strong>m<br />
Ritter der Ehrenlegion ernannt worden<br />
war, wird im Kreise der Delegation den<br />
ehrenvollen Auftrag gehabt haben, das<br />
künstlerisch-musikalische Frankreich<br />
<strong>zu</strong> repräsentieren.<br />
Die Mission des Herzogs von Luxemburg<br />
dauerte acht Monate. 6 Neukomm<br />
blieb als Lehrer des Thronfolgers Peter<br />
und seiner Frau Leopoldine von Österreich<br />
in Rio de Janeiro. Erst im Vorfeld<br />
der Unruhen <strong>zu</strong>r Unabhängigkeitserklärung<br />
Brasiliens und der Rückkehr des<br />
französischer Sprache): Auf der Fregatte<br />
L’Hermione (ein Segler mit 44 Kanonen) waren<br />
350 Passagiere; neben der Delegation des<br />
Herzogs von Luxemburg auch Geschäftsleute<br />
und eingeladene Wissenschaftler. Das Schiff<br />
verließ den Hafen von Brest am 2. April 1816<br />
und traf am 31. Mai in der Bucht von Rio de<br />
Janeiro ein.<br />
6 www.musimen.com/neukomm.htm (in<br />
französischer Sprache)
PROBENORT<br />
Die Proben finden i.d.R.<br />
im Helmut-Hentrich-Saal der Tonhalle statt,<br />
Ehrenhof 1, Eingang Rheinseite.<br />
Gehen <strong>Sie</strong> in die 1. Etage,<br />
im Vorraum des Saales finden <strong>Sie</strong> vor den<br />
Proben immer einen Ansprechpartner<br />
oder<br />
vereinbaren <strong>Sie</strong> vorher telefonisch einen<br />
Termin mit Vorstand oder Chorleitung.<br />
PROBENZEITEN<br />
Gemeinschaftsproben<br />
finden i.d.R. dienstags von<br />
19.25 Uhr bis 21.25 Uhr statt.<br />
Stimmbildung mit anschließenden<br />
Einzelproben werden<br />
um 19.00 Uhr angeboten:<br />
für Herren montags und<br />
für Damen donnerstags<br />
Bei Ihrem ersten Besuch sollten <strong>Sie</strong><br />
gegen 19.00 Uhr in der Tonhalle sein.<br />
Aktive Sängerinnen und Sänger:<br />
Sopran: Kaoru Abe-Püschel • Britta Abelmann • Megumi<br />
Akao-Haug • Jutta Bellen • Susanne Bellmann • Annebärbel<br />
Bierbach • Justyna Bokuniewicz • Beatrix E.<br />
Brinskelle • Svetlana Bujanovskaja • Doris Büscherfeld<br />
• Yung-Hi Choi-Michalczyk • Dagmar Clöfers • Sabine<br />
Dahm • Giovanna Di Battista • Wilma Diekmann-Bastiaan<br />
• Monika Egelhaaf • Stefanie Gehle • Anja Gersdorf<br />
• Maria Goebel • Dr. Anna Caroline Gravenhorst •<br />
Heidemarie Hachel • Alexandra Holtz • Barbara Hopf-<br />
Kürten • Susan Jones • Monika Kehren • Gretel Kringe<br />
• Ingeborg Kupferschmidt • Bettina Lange-Hecker •<br />
Hyun-Jin Lim • Claudia Luthen • Chie Mugitani •Nicole<br />
Oehlert • Yeon Joo Park • Sigrid Petrell • Teresa Petrik •<br />
Elisabeth Petrusch • Larisa Rabinovich • Anke Rauber<br />
• Alexandra Romanowski • Ulrike Rotermund • Tanja<br />
Ruby • Karolina Rüegg • Christiane Schmidt • Younghui<br />
Seong • Wanda Skory • Dörte Springorum-Kölfen • Petra<br />
Strömer-Müller • Sabine Vogt • Satoko Yamamoto •<br />
Bo-Ram Yang • Alt: Karen Baasch • Dr. Maria Bauer<br />
• Birgit Biereigel • Angela Bönn-Griebler • Gerlinde<br />
Breidenbach • Ursula Brückner • Astrid Dahm • Ulrike<br />
Eitel • Ursula Eitel • Bettina Caroline Elsche • Helga<br />
Franz • Monika Greis • Renate Heinzig-Keith • Sybille<br />
Hermeling-Krön • Petra Hermes • Irmgard Hill • Alexandra<br />
Jakob • Imke Jürgens • Satomi Kondo • Sabine<br />
Kreidel • Andrea Kugler-Sterzel • Annemarie Küppers-<br />
Seiltgen • Ingrid Lang-Andrée • Young Lee • Angelika<br />
Liedhegener • Renate Madry • Stefanie Meding •<br />
Christine Meißner • Anke Merz • Kristina Maria Miltz<br />
Städtischer <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong><br />
<strong>Düsseldorf</strong> e.V. • Konzertchor der<br />
Landeshauptstadt <strong>Düsseldorf</strong><br />
www.musikverein-duesseldorf.de<br />
Kompakt-Falter-200910-©-GL<br />
• Barbara Mokross-Brisson • Josefine Nitz • Susanne<br />
Obst • Jasmin Pauen • Dr. Astrid Pustolla • Marianne<br />
Rasp • Konstanze Richter • Lucia Ronge • Annegret<br />
Scharpenack • Enikö Schmidt • Ute Schröder • Ulrike<br />
Schulte <strong>zu</strong> Sodingen • Anja Schwarzwalder • Rita<br />
Schwindt • Ingrid Spieckermann • Heide-Marie Spohr •<br />
Dr. Lisette Streefland • Hella Stursberg • Doris Stüttgen<br />
• Christa Terhedebrügge-Eiling • Margaret Thomes •<br />
Margit von Wrisberg •Angelika Weyler • Beate Wieland<br />
• Margit Zuzak • Tenor: Jens D. Billerbeck • Eike Fiedrich<br />
• Georg Fleischhauer • Erich Gelf • Axel Guelich<br />
• Joachim Günther • Thomas Henneke • Hans-Peter<br />
Hill • Karl Hönig • Myung-Ki Jang • Sungwook Jung •<br />
Ki-Hyoung Kim • Kitae Kim • Tae-Hwan Kim • Adam<br />
Kirchner • Horst Meyer • Dr. Thomas Ostermann • Dr.<br />
Jens Petersen • Wolfgang Reichard • Horst Schlechtriemen<br />
• Rolf Schumacher • Dr. Reiner <strong>Sie</strong>ger • Boris<br />
Sorin • Reinhard Spieß • Thomas Whye Leng Stebel<br />
• Klaus-Peter Tiedtke • Ulrich Viehoff • Klaus Walter •<br />
Baß: Dr. Tilmann Bechert • Dr. med. Francesco Bonella<br />
• Manfred Hill • Udo Kasprowicz • Volker Kaul •Johannes<br />
Keith • Minsung Kim • Markus Klausch • Lutz-Uwe<br />
Köbernick • Wolf Koch • Peter Kraus • Dr. Wolfram<br />
Küntzel • Georg Lauer • Hak-Young Lee • Johannes<br />
Meller • Hermann Oehmen • Ralf Oehring • In Taek Oh<br />
• Boris Osipo • Sangywoon Park • Yun-Il Michael Park<br />
• Dr. Wolf-Dietrich Pflugbeil • Dr. Walter Pietzschmann<br />
• Wolfgang Reinartz • Benno Remling • Jochen Schink<br />
• Rüdiger Schink • Ernst-Dieter Schmidt • Rolf Schönberg<br />
• Georg Toth • Christof Wirtz • Klaus Zink
Städtischer<br />
<strong>Musikverein</strong><br />
<strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong> e.V.<br />
Unser<br />
Programm<br />
2009/2010<br />
und andere<br />
wichtige Informationen!<br />
Ein Falt-Plan für Ihre Hand-Tasche!<br />
(bitte heraustrennen und noch dreimal falten:<br />
2-mal längs und einmal quer - vielen Dank!)<br />
Stand August 2009<br />
- Änderungen vorbehalten -<br />
SEPTEMBER 2009<br />
Abschlußkonzert<br />
Altenberger Kultursommer<br />
Freitag 11.9.2009 - 20 Uhr<br />
Dom <strong>zu</strong> Altenberg<br />
Johannes Brahms<br />
« Ein Deutsches Requiem »<br />
Bayer-Philharmoniker<br />
Anke Krabbe, Sopran<br />
Thomas Laske, Bariton<br />
Chor der Konzertgesellschaft<br />
Wuppertal<br />
Städtischer <strong>Musikverein</strong><br />
<strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong><br />
Marieddy Rossetto, Einstudierung<br />
Rainer Koch, Dirigent<br />
OKTOBER 2009<br />
Symphoniekonzert<br />
Sternzeichen 3<br />
Freitag 30.10.2009 - 20 Uhr<br />
Sonntag 01.11.2009 - 11 Uhr<br />
Montag 02.11.2009 - 20 Uhr<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />
Georg Friedrich Händel<br />
« Israel in Egypt »<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker<br />
Joanne Lunn, Sopran<br />
Sarah Wegener, Sopran<br />
Alex Potter, Countertenor<br />
Christian Feichtmeir, Bass<br />
Städt. <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong><br />
Marieddy Rossetto, Einstudierung<br />
Frieder Bernius, Dirigent<br />
NOVEMBER 2009<br />
Symphoniekonzert<br />
Sternzeichen 4<br />
Freitag 20.11.2009 - 20 Uhr<br />
Sonntag 22.11.2009 - 11 Uhr<br />
Montag 23.11.2009 - 20 Uhr<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />
Felix M. Bartholdy<br />
« Lobgesang »<br />
Symphonie Nr. 2 B-Dur op 52<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker<br />
Anna Virovlansky, Sopran<br />
Katarzyna Kuncio, Mezzosopran<br />
Corby Welch, Tenor<br />
Städt. <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong><br />
Marieddy Rossetto, Einstudierung<br />
Axel Kober, Dirigent
KONZERTKARTEN<br />
Konzertkasse Tonhalle:<br />
Ehrenhof 1<br />
40479 <strong>Düsseldorf</strong><br />
Telefon: 0211 - 89 96 123<br />
konzertkasse@tonhalle.de<br />
www.tonhalle-duesseldorf.de<br />
JANUAR 2010<br />
Neujahrskonzert<br />
Freitag 01.01.2010 11 Uhr<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />
Robert Schumann<br />
« Neujahrslied » u.a.<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker<br />
Städt. <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong><br />
Marieddy Rossetto, Einstudierung<br />
Hubert Soudant, Dirigent<br />
FEBRUAR 2010<br />
Symphoniekonzert<br />
Sternzeichen 7<br />
Fr 05.02. / So 07.02. / Mo 08.02.2010<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />
Robert Schumann<br />
« Das Glück von Edenhall op 143 »<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker<br />
Städt. <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong><br />
Marieddy Rossetto, Einstudierung<br />
Alexander Vedernikov, Dirigent<br />
------------------------<br />
Sonnenwind 4<br />
Sonntag 28, Februar 2010 - 16.30 Uhr<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />
Robert Schumann<br />
« Der Königssohn »<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker<br />
Städt. <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong><br />
Marieddy Rossetto, Einstudierung<br />
Gregor Bühl, Dirigent<br />
APRIL 2010<br />
Symphoniekonzert<br />
Sternzeichen 9<br />
Freitag 16.04.2010- 20 Uhr<br />
Sonntag 18.04.2010 - 11 Uhr<br />
Montag 19.04.2010 - 20 Uhr<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />
Robert Schumann<br />
« Szenen aus Goethes Faust »<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker<br />
Simona Saturova, Gretchen<br />
Dietrich Henschel, Faust<br />
Peter Mikulás, Mephisto<br />
Werner Güra, Ariel<br />
Ingeborg Danz, Alt<br />
Städt. <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong><br />
Marieddy Rossetto, Einstudierung<br />
Bernhard Klee, Dirigent<br />
VORSCHAU 2010/2011<br />
NOVEMBER 2010<br />
Fr 26.11. / So 28.11. / Mo 29.11.2010<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />
Robert Schumann<br />
« Manfred »<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker<br />
Städt. <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong><br />
Marieddy Rossetto, Einstudierung<br />
Andrey Boreyko, Dirigent<br />
-------------------------<br />
DEZEMBER 2010<br />
Fr 17.12. / So 19.12. / Mo 20.12.2010<br />
Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />
Robert Schumann<br />
« Adventlied »<br />
<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker<br />
Städt. <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong><br />
Marieddy Rossetto, Einstudierung<br />
Andrey Boreyko, Dirigent
Vorstand Städt. <strong>Musikverein</strong>:<br />
Vorsitzender: Manfred Hill<br />
Kempenweg 12 - 40699 Erkrath<br />
Tel: 02103.94 48 15<br />
eMail: m.hill@musikverein-duesseldorf.de<br />
Schriftführerin: Jutta Bellen<br />
Hildebrandtstr.13 - 40215 <strong>Düsseldorf</strong><br />
Tel: 0211.31 80 557<br />
eMail: j.bellen@musikverein-duesseldorf.de<br />
Schatzmeister I: Ernst-Dieter Schmidt<br />
Lintorfer Str. 75 - 40878 Ratingen<br />
Tel: 02102.2 34 34<br />
eMail: e.d.schmidt@musikverein-duesseldorf.de<br />
Schatzmeister II: Ingeborg Kupferschmidt<br />
Gartenstraße 28 - 40479 <strong>Düsseldorf</strong><br />
Tel: 0211.49 81 783<br />
eMail: i.kupferschmidt@musikverein-duesseldorf.de<br />
Medienreferent: Jens D. Billerbeck<br />
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 33 - 42653 Solingen<br />
Tel: 0212 25 91 712<br />
eMail: j.billerbeck@musikverein-duesseldorf.de<br />
Archivarin: Christiane Schmidt<br />
Deutzer Str. 35 - 41468 Neuss<br />
Tel: 02131.33 533<br />
eMail: c.schmidt@musikverein-duesseldorf.de<br />
Stimmvertreter:<br />
Sopran: Sabine Dahm<br />
Benrather Schlossallee 34 - 40597 Düsseld.<br />
Tel: 0211.70 72 77<br />
eMail: s.dahm@musikverein-duesseldorf.de<br />
Alt: Rita Schwindt<br />
Josef-Kuchen-Straße 7 - 41462 Neuss<br />
Tel: 02131.17 69 595<br />
eMail: r.schwindt@musikverein-duesseldorf.de<br />
Tenor: Hans-Peter Hill<br />
Kempenweg 10 - 40699 Erkrath<br />
Tel: 0204.31 566<br />
Bass: Lutz-Uwe Köbernick<br />
Merowingerstraße 186 - 40225 <strong>Düsseldorf</strong><br />
Tel: 0211.31 45 31<br />
eMail: l.u.koebernick@musikverein-duesseldorf.de<br />
Stimmbildung:<br />
Sopran/Alt: Ulrike Eitel<br />
In der Huppertslaach 25 - 41464 Neuss<br />
Tel: 02131.85 80 39<br />
eMail: ulrike-eitel@hotmail.de<br />
Tenor/Bass: Klaus Walter<br />
Holsteinstr. 8 - 41564 Kaarst<br />
Tel: 02131.63 189<br />
eMail: kwalter-kaarst@t-online.de<br />
Künstlerische Leitung:<br />
Chordirektorin:<br />
Marieddy Rossetto<br />
Stralsunder Straße 15<br />
42109 Wuppertal<br />
Tel: 0202.27 50 132<br />
eMail: m.rossetto@musikverein-duesseldorf.de<br />
Korrepetitor:<br />
Reinhard Kaufmann<br />
Derner Straße 5a<br />
59174 Kamen<br />
Tel: 02307.74 504<br />
Geschäftsstelle:<br />
Städtischer <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong> e.V<br />
Ehrenhof 1<br />
40479 <strong>Düsseldorf</strong><br />
eMail: info@musikverein-duesseldorf.de<br />
Schallarchiv: Rainer Großimlinghaus<br />
Zum Wetterhäuschen 22<br />
14532 Kleinmachnow<br />
Tel: 033203.83 211<br />
eMail: r.grossimlinghaus@musikverein-duesseldorf.de<br />
Redaktion NeueChorszene:<br />
Chefredakteur: Georg Lauer<br />
Dörperweg 33 - 40670 Meerbusch<br />
Tel: 02159. 5912<br />
eMail: g.lauer@musikverein-duesseldorf.de<br />
Jens D. Billerbeck<br />
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 33 - 42653 Solingen<br />
Tel: 0212. 25 91 712<br />
eMail: j.billerbeck@musikverein-duesseldorf.de<br />
Erich Gelf<br />
Niederrheinstraße 2b - 40474 <strong>Düsseldorf</strong><br />
Tel: 0211. 45 94 22<br />
eMail: Erich.Gelf@t-online.de<br />
Udo Kasprowicz<br />
Dresdener Str. 2 - 40670 Meerbusch<br />
Tel: 02159-29 60<br />
eMail: HalteDeinWortnicht<strong>zu</strong>rueck@t-online.de<br />
Dr. Thomas Ostermann<br />
Breidenplatz 14 - 40627 <strong>Düsseldorf</strong><br />
Tel: 0211.15 78 566<br />
eMail: t.ostermann@musikverein-duesseldorf.de<br />
Konstanze Richter<br />
Heinrichstr. 62 - 40239 <strong>Düsseldorf</strong><br />
Tel: 0211. 94 68 944<br />
eMail: k.richter@musikverein-duesseldorf.de
Hofes nach Lissabon kehrte er im Jahre<br />
1821 nach Paris <strong>zu</strong>rück. Die Musikgeschichte<br />
Brasiliens hält die Erinnerung<br />
an die Episode im Wirken Neukomms<br />
bis heute wach, da dessen Bemühungen<br />
um die Vermittlung klassischer europäischer<br />
Musik an das einheimische<br />
Publikum durchaus erfolgreich waren.<br />
Sein bekanntester Mitarbeiter und<br />
Schüler in Brasilien war der 1767 als<br />
Sohn einer Mulattin und eines Sklaven<br />
geborene José Mauricio Nunes Garcia.<br />
Er komponierte zwar schon vor der Ankunft<br />
Neukomms und entwickelte sich<br />
dann unter dessen Einfluss <strong>zu</strong>m „brasilianischen<br />
Mozart“.<br />
Zu Lebzeiten verehrt –<br />
heute vergessen<br />
Ein besonderes Phänomen ist der<br />
Umstand, dass Person und Werk des in<br />
ganz Europa hochgeschätzten, mit Auszeichnungen,<br />
Ehrungen und Kompositionsaufträgen<br />
überhäuften Sigismund<br />
Neukomm so bald nach seinem Tode<br />
in Vergessenheit gerieten. Seine Tragik<br />
war, dass sein hohes Lebensalter weit<br />
in neue Musikepochen hineinragte und<br />
er unbeirrt an dem Stilideal der Wiener<br />
Klassik, genauer an der musikalischen<br />
Sprache und Schreibweise Haydns<br />
und Mozarts, festhielt, so dass seine<br />
Schöpfungen <strong>zu</strong>m Schluss als veraltet,<br />
ja rückständig erschienen. Die künstlerischen<br />
Neuerungen Beethovens oder<br />
Berlioz’ oder die „kühnen Aufbrüche der<br />
Romantik“ berührten Neukomm nur am<br />
Rande. 7 Es war wohl seine Persönlichkeit,<br />
die ihn trotz seiner musikalischen<br />
7 Ulrich Konrad, Vorwort <strong>zu</strong>m<br />
Aufführungsmaterial: Sigismund Neukomm,<br />
Libera me, Domine, liturgische Komplettierung<br />
von Mozarts Requiem KV 626, Breitkopf &<br />
Härtel, Wiesbaden, Winter 1998/1999<br />
NC 2 / 09<br />
„Rückständigkeit“ auch noch in seine<br />
späteren Jahren begehrt und beliebt<br />
machten.<br />
Neukomms breit gefächertes Interesse,<br />
seine umfassenden und hervorragenden<br />
Sprachkenntnisse (er<br />
beherrschte neben griechisch und lateinisch<br />
sechs lebende europäische<br />
Sprachen), seine fundierte Bildung<br />
- weit über die Fachgrenzen hinaus -,<br />
seine europäische Orientierung und<br />
sein Nationalgrenzen überschreitendes<br />
Schaffen machten ihn <strong>zu</strong>m gerngesehenen<br />
Gast des Publikums in den<br />
europäischen Musikmetropolen und<br />
<strong>zu</strong>m Freund berühmter Musiker und<br />
Geisteswissenschaftler wie z. B. Massenet,<br />
Cherubini, Mendelssohn und<br />
Moscheles 8 .<br />
Insbesondere die Romantiker lehnten<br />
die aktuellen Schöpfungen Neukomms<br />
ab. Ignaz Moscheles, der Neukomm<br />
einerseits einmal bewundernd „die Enzyklopädie“<br />
nannte, schreibt 1834 an<br />
Mendelssohn: „Deine Bemerkungen<br />
über Neukomms Musik sind mir aus der<br />
Seele gesprochen; was mich nur wundert,<br />
ist, wie ein sonst so geschmackvoller<br />
und gebildeter Mann nicht auch<br />
in der Musik in Folge dieser beiden Eigenschaften<br />
mehr gewählt und elegant<br />
schreibt; denn ohne von Ideen und von<br />
dem Grunde seiner Compositionen <strong>zu</strong><br />
sprechen, scheinen sie mir oft sorglos,<br />
fast ordinär gemacht <strong>zu</strong> sein. Auch das<br />
viele Blech gehört hierher; schon aus<br />
Berechnung müsste man’s aufsparen,<br />
8 Ignaz Moscheles (1794 Prag-1870 Leipzig)<br />
war böhmisch-österreichischer Komponist,<br />
Klaviervirtuose und –pädagoge. Er war<br />
befreundet mit Beethoven und Mendelssohn.<br />
Auf Wunsch Mendelssohns übernahm er ab<br />
1846 die Leitung der Klavierklasse am 1843<br />
gegründeten Leipziger Konservatorium.<br />
29
von aller Kunst <strong>zu</strong> schweigen.“ 9 In seinen<br />
Tagebüchern schreibt Moscheles über<br />
Neukomm: „Ein edler Charakter, ein<br />
gebildeter Mann, ein Freund, der sicht<br />
treu bewährt, leider aber kein Genie,<br />
sondern nur ein solider, wohldenkender,<br />
gutschreibender Componist...“ 10<br />
In Birmingham – wo er bei seiner ersten<br />
Reise 1830 gefeiert wurde und<br />
danach alljährlich in der Saison große<br />
Erfolge verzeichnete - ließ man Neukomm<br />
schon <strong>zu</strong> Lebzeiten hart empfinden,<br />
dass seine Kompositionen einem<br />
Vergleich beispielsweise mit denen<br />
Mendelssohns nicht Stand hielten. Dies<br />
geschah im Jahre 1837 als Mendelssohns<br />
„Paulus“ bei dem Musikfest erstmals<br />
in England aufgeführt wurde und<br />
einen ungeheuren Erfolg errang. Auch<br />
diesmal war Neukomm als Mitwirkender<br />
gewonnen worden. Seine absichtliche<br />
Zurückset<strong>zu</strong>ng empörte Mendelssohn,<br />
der darüber an seine Mutter aus<br />
Birmingham folgendes schreibt. „Du<br />
weißt, wie sie ihn sonst verehrt und<br />
wirklich überschätzt haben, wie alle<br />
seine Sachen dort gesucht und gepriesen<br />
wurden, so dass ihn die Musiker<br />
immer „King of Birmingham“ nannten;<br />
und diesmal haben sie ihn auf so unziemliche<br />
Art <strong>zu</strong>rückgesetzt, nur ein<br />
kurzes Stück von ihm am ersten (dem<br />
allerschlechtesten) Morgen gegeben,<br />
und ihn selbst ohne die geringste Aufmerksamkeit<br />
im Publicum aufgenommen,<br />
dass es wirklich eine Schande für<br />
die Menschen war, die vor drei Jahren<br />
nichts Höheres oder Besseres kannten,<br />
als Neukomms Musik. Das Einzige,<br />
was ihm vor<strong>zu</strong>werfen ist, ist eben, dass<br />
9 ADB: Neukomm, Sigismund über www.<br />
de.wikisource.org<br />
10 a.a.O. wie 9<br />
30 NC 2 / 09<br />
er vor drei Jahren ein Oratorium fürs<br />
Musikfest schrieb, was recht auf Effect<br />
berechnet war. Die große Orgel, die<br />
Chöre, die Soloinstrumente, alles kam<br />
darin vor, damit es den Leuten gefiele,<br />
und so was merken die Leute, und<br />
es tut nicht gut. Dass sie ihn aber <strong>zu</strong>m<br />
Dank diesmal so behandelten, ist eben<br />
wieder eine Zeichen, was von all ihrem<br />
Gefallen <strong>zu</strong> halten ist, und was man<br />
davon hat, wenn man’s sucht.“ Und an<br />
Ferdinand Hiller schreibt Mendelssohn<br />
aus diesem Anlass: „Du wirst mir sagen,<br />
seine Musik sei auch nichts wert<br />
– da stimmen wir wohl überein, - aber<br />
das wissen doch Jene (das Publicum)<br />
nicht, die damals entzückt waren und<br />
jetzt vornehm tun. Empört hat mich die<br />
ganze Geschichte, und Neukomms ruhiges,<br />
ganz gleichmäßiges Benehmen<br />
ist mir doppelt vornehm und würdig<br />
gegen die Andern erschienen, und ich<br />
habe ihn viel lieber gewonnen durch<br />
diese entschiedene Haltung.“ 11<br />
Diese Zitate belegen, dass Neukomm<br />
<strong>zu</strong>letzt nur wegen seiner Persönlichkeit<br />
Aufmerksamkeit und Anerkennung<br />
als eine Figur der Musikgeschichte<br />
erfuhr. Sein musikalischen<br />
Schaffen dagegen wurde abgewertet.<br />
Nachdem nach seinem Tode die persönliche<br />
Präsenz entfiel, wurden der<br />
Komponist Neukomm und sein Werk<br />
bald vergessen.<br />
Neukomms Jugend und Familienverhältnisse<br />
Auch über die familiären Verhältnisse<br />
Sigismund Neukomms finden sich<br />
neue Angaben 12 .<br />
Sein Vater, David, war ein wissen-<br />
11 a.a.O. wie 9<br />
12 www.musicologie.org/Biographies/
schaftlich gebildeter Mann und Lehrer<br />
an der Zentral-Normalschule in Salzburg.<br />
Er achtete darauf, dass sein<br />
Sohn Sigismund <strong>zu</strong> guten Lehrern kam.<br />
Schon als Kind von sieben Jahre beginnen<br />
seine musikalischen Studien bei<br />
dem Salzburger Kathedral-Organisten<br />
Franz-Xaver Weissenauer. Seit seinem<br />
zwölften Lebensjahr studierte er bei<br />
Michael Haydn, dem Bruder von Joseph,<br />
Musiktheorie. In Pierers Universal-<br />
Lexikon von 1857 wird auf eine Verwandtschaft<br />
Neukomms mit Hadyn hingewiesen.<br />
In musikalisch-technischer<br />
Hinsicht ließ der Vater dem Sohn Sigismund<br />
wohl seinen freien Willen. Jedenfalls<br />
erwarb der Sohn auf fast jedem<br />
Instrument einige Fertigkeit, von Flöte<br />
bis Orgel, so dass er in den Salzburger<br />
Kirchenorchestern eine gesuchte<br />
Persönlichkeit war, die überall helfend<br />
einspringen konnte. Beim Orgelspiel<br />
entwickelte er überdurchschnittliche<br />
Fähigkeiten; vierzehnjährig wurde er<br />
Titularorganist der Universitätskirche<br />
<strong>zu</strong> Salzburg. Gleichzeitig studierte er<br />
auch Philosophie und Mathematik.<br />
1797 wechselte Sigismund Neukomm<br />
nach Wien und studierte dort bei Joseph<br />
Haydn, der ihn wie einen Sohn<br />
aufnahm. In Wien widmete er sich außerdem<br />
dem Studium der Naturwissenschaften<br />
und der Medizin.<br />
Sigismund Neukomm hatte 14 Schwestern<br />
und Brüder.<br />
Eine Schwester, Elise Neukomm<br />
(1789-1816) war eine berühmte Sopranistin<br />
in Wien; eine andere, Elisabeth,<br />
war ebenfalls Sängerin, sie lebte in<br />
Rouen.<br />
Sein Bruder Anton (1793-1873) unter-<br />
richtete als Professor am Konservatorium<br />
in Rouen und war dort Organist an<br />
der großen gotischen Abteikirche Saint-<br />
Ouen. Anton wurde übrigens in Paris<br />
an der Seite seines Bruders Sigismund<br />
auf dem Friedhof von Montmartre beerdigt.<br />
Das Grab existiert allerdings nicht<br />
mehr; es wurde von der Friedhofsverwaltung<br />
1988 eingezogen.<br />
Bekannt wurde noch Sigismund Neukomms<br />
Neffe, Edmond, geboren 1840<br />
in Rouen und gestorben 1903, ein Sohn<br />
Antons. Er war Musikredakteur bei dem<br />
Verlag L’année musicale und schrieb<br />
Kritiken in renommierten Pariser Musikzeitungen.<br />
Außerdem ist er als Autor<br />
verschiedener musikwissenschaftlicher<br />
Publikationen hervorgetreten. Er bewahrte<br />
die Manuskripte seines Onkels<br />
und vermachte sie schließlich 1896<br />
der Pariser Bibliothèque du Conservatoire.<br />
13<br />
Sigismund Neukomm war nicht verheiratet<br />
und hatte keine Nachkommen.<br />
Das geht aus den jetzt veröffentlichten<br />
notariellen Urkunden über seine Hinterlassenschaft<br />
bei seinem Tode hervor. 14<br />
Seit 1810 in Paris lebte er - mit Unterbrechung<br />
seiner Zeit in Brasilien - als<br />
Pianist und Musikdirektor im Hause des<br />
Fürsten Talleyrand bis <strong>zu</strong> dessen Tode<br />
1838; jenes Talleyrand, der in diesen<br />
Jahren als Außenminister, Politiker und<br />
Diplomat durch alle politischen Veränderungen<br />
hindurch an der Geschichte<br />
Frankreichs beteiligt war.<br />
Der Fürst nahm Neukomm 1814 mit<br />
<strong>zu</strong>m Wiener Kongress, wo dieser ein<br />
französisches, musikalisches Beipro-<br />
13 a. a. O. wie 6<br />
14 a. a. O. wie 6<br />
NC 2 / 09 31
gramm organisierte. Mit Talleyrand<br />
reiste Neukomm ebenfalls 1830 -1834<br />
in einer diplomatischen Mission nach<br />
London. In England wurde Neukomm<br />
so gefeiert, dass er sich danach noch<br />
einige Jahre in der musikalischen Saison<br />
dort aufhielt und London seine<br />
zweite Heimat nannte. Am Ende seines<br />
Lebens wohnte er, wenn er nicht auf<br />
Reisen war, in Paris. Gelegentlich pendelte<br />
er zwischen Rouen, dem Wohnsitz<br />
seines Bruders Anton und seiner<br />
Schwester Elisabeth, und Paris hin und<br />
her.<br />
Neukomm inspiriert die „französische“<br />
Orgel von Cavaillé-Coll<br />
Eine interessante Entdeckung am<br />
Rande ist, dass Neukomm ein Freund<br />
des berühmten Orgelbauers Aristide<br />
Cavaillé-Coll (1811-1899) war.<br />
Cavaillé-Coll kreierte einen neuen typisch<br />
französischen Orgeltyp, der die<br />
orchestral-symphonische Orgelmusik<br />
in Frankreich des 19. Jahrhunderts ermöglichte.<br />
Neukomm hat ihn bei der<br />
Disposition bedeutender Orgelbauten<br />
in den Jahren nach 1840 beraten. 15<br />
Neukomm und das Metronom<br />
Johann Nepomuk Mälzel (1772-<br />
1838), ein erfolgreicher Konstrukteur<br />
mechanischer Musikinstrumente in<br />
Wien, meldete 1816 einen mechanischen<br />
Taktmesser in Paris <strong>zu</strong>m Patent<br />
an, der dort alsbald auch fabrikmäßig<br />
hergestellt wurde. Beethoven interessierte<br />
sich sehr für die Herstellung<br />
des „Metronom“ genannten Gerätes<br />
und hat in seinen Kompositionen auch<br />
nach diesem Instrument Taktzahlen<br />
angegeben, jedenfalls solange, bis er<br />
15 www.musimem.com/neukomm.htm<br />
32 NC 2 / 09<br />
mit Mälzel in einen unsäglichen Urheberstreit<br />
über eine Musik für dessen<br />
mechanischen Trompeter geriet. Alle<br />
zeitgenössischen Komponisten bedienten<br />
sich für die Präzisierung der Tempoangaben<br />
der Möglichkeit dieses neuen<br />
Instrumentes. So auch Sigismund<br />
Neukomm. Schon in unserem Bericht<br />
über Neukomms Vervollständigung<br />
des Mozart-Requiems (siehe oben)<br />
haben wir auf eine Liste Neukomms<br />
mit Metronomenangaben bei seinem<br />
ergänzenden „Libera me, Domine“ hingewiesen,<br />
durch die die musikwissenschaftliche<br />
Forschung Hinweise über<br />
die mozartschen Tempi aufgrund eines<br />
„Ohrenzeugen“ und epochentreuen<br />
Zeitzeugen gewinnen könnte. Bei den<br />
neuerlichen Recherchen stoßen wir<br />
darauf, dass Neukomm in seinem zweiten<br />
Klavieraus<strong>zu</strong>g <strong>zu</strong> Joseph Haydns,<br />
Die Schöpfung, bei jeder Nummer Metronomenangaben<br />
macht. „Demnach<br />
nahm Haydn nicht die allerschnellsten<br />
Tempi“: so resümiert Georg Feder in<br />
seiner Bärenreiter Werkeinführung <strong>zu</strong><br />
Haydns ,Die Schöpfung‘ aufgrund der<br />
Angaben Neukomms 16 . Da Neukomm<br />
genau in dem Zeitraum Schüler und<br />
Vertrauter Haydns war, in dem Haydn<br />
an der Komposition arbeitete, die ersten<br />
Aufführungen vorbereitete und<br />
selbst leitete, dürften seine Angaben<br />
mit den Tempi-Vorstellungen des Komponisten<br />
genau übereinstimmen. Georg<br />
Feder macht es durch seine Arbeit<br />
den heutigen Interpreten leicht, sich<br />
mit den Originaltempi Haydns auseinander<br />
<strong>zu</strong> setzen, denn er vermerkt bei<br />
seiner Beschreibung und Analyse des<br />
16 Georg Feder, Joseph Haydn, Die Schöpfung,<br />
Kassel usw., Bärenreiter 1999 (Bärenreiter<br />
Werkeinführungen) ISBN 3-76118-1253-1, Seite<br />
119 Zeilen 14 - 17
Werkes <strong>zu</strong> jeder Nummer die Metronomenzahlen<br />
aus dem Klavieraus<strong>zu</strong>g<br />
17 18<br />
Neukomms.<br />
Aufnahmen von Werken<br />
Sigismund Neukomms<br />
Alter Bestand der Aufnahmen<br />
Zu einer einigermaßen vorläufigen,<br />
geschweige denn einer abschließenden<br />
Beurteilung des musikalischen und<br />
literarischen Werkes Sigismund Neukomms<br />
fehlen uns immer noch Aufnahmen,<br />
Notenausgaben und die Erschließung<br />
der teilweise fremdsprachlichen<br />
Quellen. Bei der Internet-Recherche<br />
bei einem führenden Versandhaus finden<br />
wir nur 23 Angebote über neue<br />
und gebrauchte CDs mit Werken Sigismund<br />
Neukomms. Ein großer Musikalien-Spezialversand<br />
bietet 13 lieferbare<br />
originalverpackte CDs an, auf denen<br />
teilweise einzelne Werke Neukomms<br />
mit anderen zeitgenössischen Kompositionen<br />
<strong>zu</strong>sammengefasst sind (insbesondere<br />
Lieder und Orgelmusik). Interessant<br />
unter den älteren Aufnahmen ist<br />
eine ‚Messe de Requiem‘ mit großem<br />
Orchester aus einer japanischen Produktion<br />
des Jahres 2003, bei der u. a.<br />
17 wie 16 abweichend davon Abschnitt:<br />
„Werkbetrachtung: Die einzelnen Teile, Bilder<br />
und Nummern“, Seiten 31 - 108<br />
18 Wie 17 <strong>zu</strong>sätzlich: Abschnitte<br />
„Aufführungsdauer und Pausen“, „Tempi“, Seiten<br />
118 und 119<br />
Aufgrund seiner wissenschaftlichen Arbeit<br />
stehen Feder Dokumente über abweichende<br />
Tempi bei zeitgenössischen Aufführungen<br />
der Schöpfung unter anderen Dirigenten<br />
als Haydn selbst <strong>zu</strong> Verfügung. Dies teilt er<br />
mit. Insbesondere die <strong>zu</strong> einigen Nummern<br />
überlieferten Metronomangaben Salieris, die<br />
abweichend von Neukomm schnellere Tempi<br />
vorsehen, stellt er den Angaben Neukomms<br />
gegenüber.<br />
Edith Matthis und Ernst Haefliger unter<br />
der Leitung von Jörg Ewald Dähler mitwirken<br />
19 . Bei einem Werk von ca. 2000<br />
Kompositionen sind diese wenigen Tondokumente<br />
ein verschwindend geringer<br />
Teil des Nachlasses.<br />
Neue Aufnahmen<br />
Umso erfreulicher ist es, das im Zeitraum<br />
von Oktober 2008 bis Mai 2009,<br />
vier neue CDs mit Werken von Sigismund<br />
Neukomm herausgekommen<br />
sind. Und offengestanden ist dieser<br />
Umstand der Anlass dafür, dass wir das<br />
Thema „Sigismund Neukomm“ wieder<br />
aufgenommen haben.<br />
Drei CDs hat das Label K617 (Vertrieb<br />
harmonia mundi), das von dem Centre<br />
International des Chemins du Baroque<br />
im Couvent St. Ulrich Sarrebourg/Moselle<br />
getragen wird, herausgebracht.<br />
Der Couvent St. Ulrich verpflichtete<br />
Jean-Claude Malgoire und sein auf die<br />
Musik des 17. und 18. Jahrhunderts<br />
spezialisiertes Kammerorchester „La<br />
Grande Écurie et la Chambre du Roy“<br />
um bei seinem Barockmusikfestival in<br />
Sarrebourg/Moselle 2005 in der Kirche<br />
<strong>zu</strong> Sarrebourg das Mozart Requiem<br />
mit der Vervollständigung durch Sigismund<br />
Neukomm auf<strong>zu</strong>führen und auf<strong>zu</strong>nehmen.<br />
Damals fanden wir <strong>zu</strong>fällig<br />
diese CD bei Internet-Recherchen und<br />
19 Camerata Tokyo, CM-555 / Dähler<br />
(geb.1933) ist ein Berner Dozent, Dirigent,<br />
Chorleiter, Cembalist und Komponist. Er<br />
leitet den Berner Kammerchor und die<br />
Kammerkonzerte in der Rathaushalle Bern.<br />
Er unternimmt weltweite Konzertreisen und<br />
gibt Meisterkurse. Regelmäßig jedes Jahr<br />
leitet er Symphoniekonzert und Festivalchöre<br />
in Japan. Die Noten <strong>zu</strong>r ‚Messe de Requiem‘<br />
hat er im Selbstverlag herausgebracht - www.<br />
bernerkammerchor.ch<br />
NC 2 / 09 33
erichteten darüber in unserer Ausgabe<br />
2/07 (siehe oben). Diese CD wurde<br />
das meistverkaufte Produkt des Labels.<br />
Jetzt hat es eine „Ré-Edition“ dieser<br />
Version des Mozart Requiems <strong>zu</strong> einem<br />
äußerst günstigen Preis aufgelegt. 20<br />
Jean-Claude Malgoire hat offensichtlich<br />
gefallen an der Musik Sigismund<br />
Neukomms gefunden, denn die beiden<br />
(echten) Neuerscheinungen mit Werken<br />
dieses Komponisten bei dem Label<br />
K617 entstanden ebenfalls unter seiner<br />
Leitung.<br />
Am 13. 2. 2009 erschien eine CD „Sigismund<br />
Neukomm, Messe de Requiem<br />
suivie d’une marche funèbre“. 21<br />
Auch hierbei handelt es sich um einen<br />
Mitschnitt vom 6. Juli 2008 <strong>beim</strong> Festi-<br />
20 harmonia mundi K617208<br />
21 harmonia mundi K617210<br />
34 NC 2 / 09<br />
val International de Sarrebourg, diesmal<br />
aus der Kirche des <strong>zu</strong> Sarrebourg<br />
eingemeindeten alten Ortes Hoff. Die<br />
Komposition ist 1838 entstanden. Die<br />
Noten sind wiederum durch Zufall in<br />
einer Mappe unter dem Nachlass Neukomms<br />
in der Bibliothèque nationale de<br />
France gefunden worden, wo der von<br />
Neukomms Neffen 1896 abgegebene<br />
Nachlass jetzt lagert.<br />
Die <strong>zu</strong> Beginn des 19. Jahrhunderts<br />
aufgekommene Frage, ob ein Requiem<br />
für die Kirche oder für den Konzertsaal<br />
komponiert werden soll, stellte sich<br />
für den tiefgläubigen Neukomm nicht.<br />
Seine Totenmessen sind für die Kirche<br />
bestimmt. Für den Theater- oder Konzertsaal<br />
hatte er seine Oratorien vorgesehen.<br />
Aus dieser Vorgabe ergibt sich<br />
die Dauer und die Beset<strong>zu</strong>ng der Komposition<br />
für den kirchlichen Gebrauch.<br />
Die vorliegende Requiem-Aufnahme<br />
dauert 37 Minuten mit ihrer Fortset<strong>zu</strong>ng<br />
durch den Trauermarsch kommt sie auf<br />
eine Gesamtdauer von 59 Minuten.<br />
Die dramatische Wucht großer<br />
Schwesterwerke des 19. Jahrhunderts<br />
(allen voran die Totenmesse von Berlioz)<br />
ist dem Werk vollkommen fremd.<br />
<strong>Sie</strong> nähert sich an die Vorbilder früherer<br />
Kirchenmusik an und wirkt dadurch getragen,<br />
liturgisch erhaben und entrückt.<br />
Das Orchester besteht ausschließlich<br />
aus Blechbläsern. Gelegentlich wirkt<br />
die Orgel mit. Die Instrumente haben<br />
kaum eine eigenständig Funktion, sondern<br />
sie dienen der Unterstüt<strong>zu</strong>ng der<br />
Stimmgruppen des Chores. Die Aufführung<br />
wird fast ausschließlich vom Chor<br />
bestritten; er wird nur von kurzen solistischen<br />
Einwürfen unterbrochen.<br />
Der gleichzeitig komponierte Trauermarsch<br />
besteht aus instrumentalen
Passagen, in das das Miserere des<br />
Chores an mehreren Stellen eingefügt<br />
ist. Bei diesem Marsch kommen originelle<br />
Klangfarben ins Spiel: Neukomm<br />
setzt zwei ungewöhnliche Instrumente<br />
ein: die Ophikleide, ein auch von Mendelssohn,<br />
Berlioz, Verdi und Wagner<br />
verwendetes, 1817 in Paris erfundenes,<br />
dem Horn verwandtes, tiefes Blechblasinstrument,<br />
das später im Orchester<br />
durch die Ventiltuba ersetzt wurde,<br />
und das Tam-Tam, eine Schlagtrommel<br />
chinesisch-malayischen Ursprungs mit<br />
70 cm Durchmesser, das in Frankreich<br />
seit Ende des 18. Jahrhunderts bei<br />
Trauermusiken und Trauerzügen Verwendung<br />
fand.<br />
Einen exotischen Touch erhält die gesamte<br />
Aufnahme durch die Mitwirkung<br />
des Chores Cantaréunion, Ensemble<br />
vocal de l’Océan Indien (Tahiti, Réunion).<br />
Der Chor singt etwas <strong>zu</strong>rückgenommen,<br />
in einer Art Anlehnung an den<br />
Gemeindegesang. Damit kommt seine<br />
besondere Klangfarbe nicht genügend<br />
<strong>zu</strong>m Zuge. Leider ist der Gesamtklang<br />
des Live-Mitschnittes aus der Kirche etwas<br />
„muffig“. Das Werk ist ein Leckerbissen<br />
für Liebhaber von Kirchenmusik<br />
im getragenen Duktus, für Neukomm-<br />
Spezialisten und wegen seines Repertoirewertes<br />
für Sammler.<br />
Am 15.05.2009 schließlich ist bei<br />
K617 die CD „Sigismund Neukomm,<br />
Missa Solemnis Pro Die Acclamationi<br />
Johannis VI“ erschienen. Um es vorweg<br />
<strong>zu</strong> sagen, über diese CD kann man in<br />
jeder Beziehung nur jubeln. Die Komposition<br />
Neukomms, 1818 in Rio de Janeiro<br />
für die Feier der Thronbesteigung<br />
als Königs von Portugal und Brasilien<br />
durch König Joao VI fertiggestellt, ist<br />
ein monumentales Werk mit schöner<br />
Musik, die sich - allen späteren Unkenrufen<br />
<strong>zu</strong>m Trotz - neben den Werken<br />
Mozarts und Haydns behaupten kann.<br />
Die ebenfalls aus der Bibliothéque<br />
nationale in Paris<br />
stammenden Noten<br />
wurden von dem französischenBarock-Urgestein<br />
Jean-Claude<br />
Malgoire für Konzerte<br />
am 3. und 5. Oktober<br />
2008 in der Kirche Notre<br />
Dame des Anges in<br />
Tourcoing für ein dreifaches<br />
Gedächtnis<br />
ausgesucht: dem 150.<br />
Todestage Sigismund<br />
Neukomms in 2008,<br />
Ophikleide<br />
dem 200. Todestage<br />
seines Lehrers Joseph Haydn in 2009<br />
und dem 200jährigen Gedächtnis der<br />
Flucht des portugiesischen Hofes vor<br />
den Truppen Napoleons nach Brasilien<br />
1808. Auf dem Programm dieses ersten<br />
Konzerts der Saison 2008 – 2009 des<br />
von Malgoire geleiteten „Atelier Lyrique<br />
de Tourcoing“ stand außerdem das Te<br />
Deum von Joseph Haydn.<br />
Malgoire führt sein 1966 gegründetes<br />
Kammerorchester „La Grande Ecurie<br />
et la Chambre du Roy“, das auf historischen<br />
Instrumenten spielt, den seit<br />
NC 2 / 09 35
1987 bestehenden stilsicheren Choeur<br />
de Chambre de Namur und die hervorragenden<br />
Solisten: Marie-Camille<br />
Vaquié, Sopran; Camille Poul, Sopran;<br />
Gemma Coma-Alabert, Mezzo-<br />
Sopran; Daniel Auchincloss, Tenor,<br />
und Jonathan Gunthorpe, Bariton, <strong>zu</strong><br />
Höchstleistungen. Dem Aufnahmeteam<br />
unter Olivier Lautem, gelingt eine Live-<br />
Einspielung, die durch eine gerade<strong>zu</strong><br />
naturalistische Abbildung der Stimmen<br />
und Instrumente, Durchhörbarkeit,<br />
Ausgewogenheit der Klangkörper und<br />
solistische Präsenz allen Anforderung<br />
gerecht wird. Kaufempfehlung für Alle!<br />
Zum Schluß sei noch hingewiesen<br />
auf eine am 1. 10. 2008 erschienene<br />
CD der Ars Produktion, Ratingen, in der<br />
Reihe „Forgotten Treasures“ - Musik<br />
auf historischen Instrumenten - VOL 8<br />
mit Werken von Sigismund Neukomm,<br />
die seinem 150. Todestag gewidmet<br />
ist 22 . Die „Kölner Akademie“, die Pianisten<br />
Riko Fukuda und Marianne Beate<br />
Kielland, Mezzosopran, musizieren unter<br />
der Leitung von Michael Alexander<br />
Willens Werke aus der frühen Schaffensphase<br />
(1804 –1808) Neukomms.<br />
22 ArsProduktion Schumacher, ARS 38030<br />
36 NC 2 / 09<br />
Ausführung und Aufnahme in der<br />
Immanuelskirche Wuppertal am 4. bis<br />
6.1.2008 verdienen einhelliges Lob und<br />
große Anerkennung.<br />
Gerade<strong>zu</strong> exemplarisch aus den verschiedenen<br />
Werkgruppen Neukomms<br />
werden geboten:<br />
- Fantasie c-moll für großes Orchester<br />
op. 11 Neukomm Verzeichnis (NV) 25, ein<br />
neues Musikgenre, das Neukomm erfand,<br />
- Konzertarie „Misera, dove son“ NV 12, die<br />
durchaus neben der Vertonung desselben Textes<br />
durch Mozarts –KV 369- bestehen kann,<br />
- Großes Klavierkonzert C-Dur op. 12 NV<br />
7, mit noblen musikalischen Einfällen<br />
- Arianna a Naxos, Kantate für Solostimme,<br />
komponiert von Joseph Haydn(1789)<br />
und von Neukomm orchestriert 1808.<br />
Das Beiheft ist knapp formuliert, jedoch<br />
umfassend, übersichtlich und informativ,<br />
auch das sei lobend erwähnt,<br />
Auch diese CD, die in Multichannel<br />
Hybrid SACD-Technik aufgenommen<br />
wurde, aber auch auf CD- und audio<br />
auch auf DVD-Spielern ohne Abstriche<br />
gehört werden kann, ist nachdrücklich<br />
<strong>zu</strong> empfehlen.<br />
Ausblick<br />
Man möchte hoffen, dass die grandiose<br />
Live-Aufnahme Malgoires und die<br />
vorbildlichen Aufnahmen unter Michael<br />
Alexander Willens für ein interessiertes<br />
Publikum und in der Fachwelt Anlässe<br />
sind, sich der einst berühmten und faszinierenden<br />
Persönlichkeit Neukomms<br />
<strong>zu</strong> erinnern und um Impulse <strong>zu</strong> setzen<br />
für eine Wiederentdeckung seines bedeutenden<br />
Schaffens. Schüchterne Ansätze<br />
für eine Renaissance in Konzert-<br />
und Radioprogrammen gibt es schon<br />
hier und da.
Selten gehörte Chorwerke<br />
Carl Loewes Oratorien von Dr. Michael Wilfert<br />
Der 140. Todestag Carl Loewes<br />
am 20. April 2009 ist uns Anlass,<br />
die Reihe „Selten gehörte Chorwerke“<br />
fort<strong>zu</strong>setzen. Unser Gastautor<br />
Dr. Michael Wilfert befasst<br />
sich im nachstehend abgedruckten<br />
Beitrag mit dem Oratorienschaffen<br />
des vor allem als Lied-<br />
und Balladenkomponist bekannten<br />
Carl Loewe.<br />
Carl Loewe (1796-1869) war von<br />
1820-1866 in Stettin tätig als Organist<br />
und Kantor der Jacobi-Kirche, als<br />
Lehrer am Marienstiftsgymnasium und<br />
Lehrerausbildungs-Seminar. Bis heute<br />
weltbekannt wurde er als Komponist<br />
von Balladen für Gesang und Klavier.<br />
Über zwei Dutzend von ihnen müssen<br />
als Meisterleistungen ersten Ranges<br />
gelten, so z.B. „Der Erlkönig“, „Herr<br />
Oluf“, „Elvershöh“, „Prinz Eugen“, „Der<br />
Totentanz“, „Archibald Douglas“, „Hochzeitslied“<br />
oder „Edward“; die Vertonung<br />
der mehrteiligen Legende „Gregor auf<br />
dem Stein“ hat in der romantischen Musik<br />
nicht ihresgleichen.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt in Loewes<br />
Tätigkeit lag in der Komposition von<br />
Liedern, vor allem aber von Oratorien,<br />
mit denen er <strong>zu</strong> Lebzeiten durchaus Erfolg<br />
hatte, die später aber immer mehr<br />
in Vergessenheit gerieten. Erst seit<br />
etwa 20 Jahren werden sie in <strong>zu</strong>nehmendem<br />
Maß wieder aufgeführt, nicht<br />
wenige sind auch auf CDs veröffentlicht<br />
worden.<br />
Abb. 1: Büste des Komponisten CarI Loewe<br />
(1796-1869) aus dem Jahre 1896 von Fritz<br />
Schaper (1841-1919).<br />
Schaper zählte um 1900 <strong>zu</strong> den gefragtesten<br />
Bildhauern der Zeit. Original im Stadtarchiv<br />
Unkel, Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung<br />
von Stadtarchivar Rudolf Vollmer.<br />
Foto: M. Wilfert.<br />
Von Loewe sind 17 Oratorien bekannt<br />
1 ; ein weiteres ist verschollen, von<br />
dem nur einige Gesänge erhalten sind.<br />
Loewe ging in seinem Oratorienschaffen<br />
vielfältige, oft auch neue Wege.<br />
Mit vielen Werken näherte er sich der<br />
Oper; er griff auf Stoffe aus Legenden<br />
<strong>zu</strong>rück oder nahm nichtbiblische<br />
Themen als Vorlage. Und schließlich<br />
war er der Erste, der Oratorien nur für<br />
Männerstimmen ohne Instrumental-<br />
Begleitung schrieb. Die wichtigsten und<br />
bedeutendsten all dieser Werke sollen<br />
im Folgenden vorgestellt werden.<br />
NC 2 / 09 37
Das Sühnopfer des Neuen Bundes<br />
(1847), ein Passions-Oratorium<br />
Da seit 1894 dieses Werk als Partitur<br />
oder Klavieraus<strong>zu</strong>g gedruckt vorliegt –<br />
inzwischen auch in neuen Ausgaben<br />
– hat das „Sühnopfer“ von allen Loewe-<br />
Oratorien am meisten Verbreitung gefunden<br />
2 . In unseren Tagen wurde es z.B.<br />
in <strong>Düsseldorf</strong>, Kiel, Karlsruhe oder Mettmann<br />
aufgeführt. Wilhelm Telschow, der<br />
Textdichter, schrieb ein Passions-Oratorium,<br />
dessen Textgrundlage das Johannes-Evangelium<br />
sowie weitere Stellen<br />
aus der Bibel bilden. Die Darstellung<br />
beginnt bei der Salbung in Betanien,<br />
führt über das letzte Abendmahl <strong>zu</strong>r Gefangennahme<br />
Christi; Jesus muss sich<br />
vor Kaiphas und Pilatus verantworten;<br />
Judas bereut seinen Verrat, Jesus trägt<br />
das Kreuz, wird gekreuzigt und ins Grab<br />
gelegt. Loewes Musik ist sehr abwechslungsreich<br />
gestaltet: Rezitative, die unbegleitet<br />
oder mehrstimmig sind, Wechsel<br />
von Solo- und Chorstellen, Choräle,<br />
Arien und Fugen sowie Kanons. Manches<br />
erinnert an ein Volkslied, manches<br />
an Loewes Balladenstil. Besonders eindringlich<br />
und qualitätsreich sind die Alt-<br />
Arie „Ach seht, der allen wohlgetan“, die<br />
Bass-Arie des völlig verzweifelten Judas<br />
„Wehe mir“, ein homophoner Chorsatz<br />
der Zionstöchter, „Fließet ihr unaufhaltsamen<br />
Tränen“ und der große Schlusschor<br />
„Es wird gesäet verweslich“.<br />
Als musikalische Begleitung sieht<br />
Loewe Streichinstrumente und Orgel<br />
vor; sein Bestreben, auch kleineren<br />
Gemeinden eine Aufführung <strong>zu</strong> ermöglichen,<br />
zeigt sich darin, dass das Werk<br />
auch allein durch eine Streichquartett-,<br />
Orgel- oder sogar Klavierbegleitung dargestellt<br />
werden könnte.<br />
38 NC 2 / 09<br />
Die Festzeiten (1825-1836)<br />
Loewe hat das Oratorium als mehrteilige<br />
Kantate angelegt, die in drei<br />
große Abschnitte gegliedert ist: Advent<br />
und Weihnachten; Fastenzeit, Karfreitag<br />
und Ostern; Himmelfahrt, Pfingsten<br />
und Trinitatis. So könnte das Werk nicht<br />
nur als Ganzes, sondern auch in Teilen<br />
<strong>zu</strong> den jeweiligen kirchlichen Festen<br />
aufgeführt werden; Loewe wollte Gemeinden<br />
ganz offenbar „Gebrauchsmusik“<br />
<strong>zu</strong> den jeweiligen Abschnitten<br />
des Kirchenjahres bieten. Solostellen<br />
und Chorpartien sind bewusst nicht<br />
übermäßig schwer angelegt; als Begleitung<br />
sind Streicher und die Orgel<br />
vorgesehen. Textgrundlage sind Zitate<br />
aus der Bibel, sich daran anlehnende<br />
gedichtete Verse sowie Choräle.<br />
Loewes Musik ist abwechslungsreich<br />
und gut verständlich, sie verbindet Anklänge<br />
an alte Meister wie Palestrina,<br />
Bach oder Händel mit neuen musikalischen<br />
Gedanken, ohne im Epigonalen<br />
oder Eklektischen stecken <strong>zu</strong> bleiben.<br />
„Der Reichtum der Riesenpartitur ist<br />
unerschöpflich, und man wird nicht<br />
müde, die Phantasie <strong>zu</strong> bewundern,<br />
mit der Loewe, ohne je über die Disposition<br />
der unzähligen kleinen Textabschnitte<br />
in Verlegenheit <strong>zu</strong> sein, immer<br />
neue Gedanken ausspielt“, würdigt<br />
Arnold Schering dieses Werk. 3 Loewe<br />
schließt seine Vorbemerkung <strong>zu</strong>m Oratorium<br />
mit dem eindrucksvollen Satz:<br />
„Die Gnade des Herrn sei mit mir und<br />
denen, welche dieses Werk ausführen<br />
und hören“.<br />
Hiob (1848)<br />
Für den Loewe-Biographen und Pfar-
Abb. 2: Chorstelle aus dem dritten Teil des Oratoriums „Hiob“, in dem Jehova aus dem<br />
Wetter heraus mit Hiob spricht.<br />
rer Karl Anton war der „Hiob“ Loewes<br />
bedeutendstes Oratorium, und es gelang<br />
ihm, 1908 das Werk in Worms aufführen<br />
<strong>zu</strong> lassen; für kurze Zeit wurde<br />
dadurch größeres Interesse auch für<br />
anderen Oratorien Loewes geweckt.<br />
Der Text Wilhelm Telschows lehnt sich<br />
eng an das alttestamentliche Buch Hiob<br />
an und zeichnet den Lebensweg eines<br />
frommen Mannes nach, der auch im<br />
Unglück an Gott festhält und ein Ende<br />
in Segen und Gnade erleben darf.<br />
Loewes Komposition zeichnet sich<br />
durch eingängige, melodisch reiche<br />
musikalische Erfindung aus, ist eine<br />
„romantische“ Musik im besten Sinne<br />
– vielleicht kann man aber ihr <strong>zu</strong>m<br />
Vorwurf machen, dass sie dadurch<br />
dem unerhörten Geschehen – Hiobs<br />
Versuchungen und Qualen – innerlich<br />
nicht ganz gerecht wird. Erfolgreiche<br />
Aufführungen in neuester Zeit in Bad<br />
Dürkheim und Greifswald belegen jedoch,<br />
dass Loewes Werk noch heute<br />
tragfähig ist. Höhepunkt ist zweifellos<br />
der Teil, in dem Jehova aus einem Gewitter<br />
heraus – durch Pauken symbolisiert<br />
– <strong>zu</strong>erst unisono, dann kanonisch<br />
spricht; der sich <strong>zu</strong>r Sechstimmigkeit<br />
steigernde Satz wird von hymnischen<br />
Sanctus-Rufen der Chöre der Engel<br />
unterbrochen und wirkungsvoll von Posaunen<br />
untermalt. 4<br />
Die sieben Schläfer (1832/33)<br />
Mit diesem Oratorium hatte Loewe <strong>zu</strong><br />
Lebzeiten den größten Erfolg; es gab<br />
Ende des 19. Jahrhunderts sogar Aufführungen<br />
in Amerika. Die Textvorlage<br />
Ludwig Giesebrechts hat als Vorlage<br />
die Erzählung von sieben Brüdern, die<br />
sich als verfolgte Christen in eine Höhle<br />
flüchten und dort eingemauert werden.<br />
Fast 200 Jahre später, nachdem das<br />
Christentum sich durchgesetzt hatte,<br />
wollen Bewohner aus Ephesus vor der<br />
Höhle der Märtyrer gedenken und ent-<br />
NC 2 / 09 39
decken dabei die sieben Brüder. Diese<br />
meinen, nur eine Nacht geschlafen <strong>zu</strong><br />
haben, schicken den Jüngsten in die<br />
Stadt, wo er überall Symbole des Christentums<br />
findet, seinerseits aber durch<br />
seltsame Kleidung und altertümliches<br />
Geld Aufsehen erregt. In Gesprächen<br />
klärt sich das Wunder auf, die Städter<br />
kehren mit dem jüngsten Bruder <strong>zu</strong>r<br />
Höhle <strong>zu</strong>rück, in der alle Brüder bis <strong>zu</strong><br />
ihrem Tod, der dann auch eintritt, bleiben<br />
wollen.<br />
Loewes Musik vermag noch heute<br />
<strong>zu</strong> überzeugen. Der erste Chor „Rüstig<br />
schwingt eure Hämmer“ zeichnet naturalistisch-tonmalerisch<br />
die Arbeit von<br />
Hirten nach; er taucht noch mehrmals<br />
im Folgenden auf. Duette passen sich<br />
formvollendet und textgemäß den jeweiligen<br />
Situationen an, eine Arie „Aber<br />
die Tage der Trübsal schwanden“ geht<br />
über in einen prächtigen Chor „Theodosius<br />
herrschet“ – ungewöhnlich für<br />
einen Triumphgesang im 6/8-Takt geschrieben.<br />
Einer der Brüder beginnt<br />
die Verse des 90.Psalms <strong>zu</strong> singen,<br />
von Strophe <strong>zu</strong> Strophe tritt ein weiterer<br />
Bruder hin<strong>zu</strong>, Loewe gelingt es in<br />
Melodie und Notation das Altertümliche<br />
der Brüder und das Ehrwürdige des<br />
Textes deutlich werden <strong>zu</strong> lassen. Auf<br />
die Melodie des christlichen Chorals<br />
„Erschienen ist der herrlich‘ Tag“ treten<br />
die Brüder aus der Höhle. Im zweiten<br />
Teil, der in Ephesus spielt, passt sich<br />
Loewes Musik den vielen kleinen dargestellten<br />
Szenen an: Chöre, Arien und<br />
Duette gipfeln in einer großangelegten<br />
Fuge. Der dritte Teil wird mit einem<br />
Sextett eröffnet, beeindruckend ist der<br />
Teil, in dem geschildert wird, wie die<br />
Brüder sanft nacheinander entschlafen,<br />
„bis einst die Posaune des Richters der<br />
40 NC 2 / 09<br />
Toten sie und uns in die Wolken entrückt“<br />
– vertont in Form einer großen<br />
Fuge, wie sie auch Loewe nicht immer<br />
gelungen ist.<br />
Die Einwände gegen das Oratorium<br />
beziehen sich vor allem auf <strong>zu</strong> viel theatralische<br />
Effekte in Einzelszenen und<br />
eine <strong>zu</strong> starke Nähe <strong>zu</strong>r Oper; Modeß<br />
macht daher den interessanten Vorschlag<br />
„Die sieben Schläfer“ einmal als<br />
Film <strong>zu</strong> inszenieren. 5<br />
Männerchor-Oratorien (1834, 1835)<br />
Seit etwa 1820 waren im deutschen<br />
Sprachbereich immer mehr Männerchöre<br />
entstanden, die <strong>zu</strong>mindest bis<br />
<strong>zu</strong>m Ende des Kaiserreichs 1914 eine<br />
wesentliche Rolle im deutschen Musikleben<br />
spielten. Es war daher durchaus<br />
kein Wagnis, wenn der Dichter<br />
Ludwig Giesebrecht und Carl Loewe<br />
sich da<strong>zu</strong> entschlossen, Oratorien nur<br />
für Männerstimmen ohne Instrumentalbegleitung<br />
<strong>zu</strong> schaffen. Das erste Oratorium<br />
dieser Art, „Die eherne Schlange“,<br />
entstand 1834.<br />
Als Vorlage dienten Giesebrecht der<br />
biblische Bericht im 4. Buch Mose und<br />
zwei Verse aus dem dritten Kapitel des<br />
Johannes-Evangeliums. Die Israeliten<br />
sind von Ägypten aus auf dem Weg<br />
ins gelobte Land und sind <strong>zu</strong>hehmend<br />
un<strong>zu</strong>frieden mit ihrer Situation: Hunger<br />
und Durst sowie schlechte Wege<br />
setzen ihnen <strong>zu</strong> und führen <strong>zu</strong> Wut,<br />
Verzweiflung und Rebellion. Da erscheinen<br />
im Lager Unmengen giftiger<br />
Schlangen, die durch Bisse viele töten.<br />
Das Volk wendet sich an Mose, der von<br />
Gott den Auftrag erhält, eine eherne<br />
Schlange, d.h. eine aus Bronze oder<br />
Kupfer, her<strong>zu</strong>stellen und an einem Holz
auf<strong>zu</strong>richten. Jeder von Schlangen Gebissene,<br />
der <strong>zu</strong> diesem Bild aufschaut,<br />
wird geheilt und muss nicht mehr sterben.<br />
Giesebrecht nimmt am Schluss<br />
die Worte aus dem Johannes-Evangelium<br />
auf, in denen Christus selbst an die<br />
eherne Schlange erinnert: „Auch des<br />
Menschen Sohn muss erhöht werden,<br />
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht<br />
verloren werden“.<br />
Loewes Musik beginnt mit der stimmungsvollen<br />
Darstellung eines Sabbatmorgens,<br />
in den hinein Aufruhr und<br />
Empörung fallen: „Nehmt die Schwerter<br />
... hin <strong>zu</strong> Mose“, von Loewe als Fuge<br />
vertont. Die Ältesten versuchen Mose<br />
<strong>zu</strong> schützen, ihrem Text wird der Melodie<br />
des christlichen Chorals „Dies sind<br />
die heil’gen zehn Gebote“ unterlegt.<br />
Der Angriff der Schlangen wird in einer<br />
großen Fuge tonmalerisch dargestellt:<br />
„Was ist das? Gewalt’ge Schlangen<br />
winden ringelnd sich heran“. Das mutlos<br />
gewordenen Volk sieht sein sündiges<br />
Verhalten ein und fleht Mose um<br />
Hilfe an. Die eherne Schlange wird ins<br />
Lager gebracht; in choralartiger Weise<br />
vertont Loewe die Worte „Heilung hat<br />
dir Gott erfunden“. Den Schlussstrophen<br />
unterlegt Loewe die Melodie des<br />
Passionsliedes „O Haupt voll Blut und<br />
Wunden“ und bekräftigt damit Giesebrechts<br />
Vergleich zwischen der Schlange<br />
am Stab und Christus am Kreuz.<br />
Diese Sichtweise, die letztlich ja nur<br />
rückblickend vom Neuen Testament<br />
möglich ist, ist von vielen Rezensenten<br />
bemängelt worden, fand aber auch ihre<br />
Befürworter.<br />
Die Erstaufführung 1834 in Jena wurde<br />
ein großer Erfolg, Loewe notierte in<br />
seiner Selbstbiographie: „Ich glaube,<br />
dies ist meine beste Composition“. 6 Ein<br />
Oratorium nur für Männerstimmen ohne<br />
Alt- und Sopranstimmen und ohne eine<br />
differenzierende Instrumentalbegleitung<br />
ist und war sicher ein Wagnis,<br />
aber schon Arnold Schering stellte 1911<br />
fest, dass „Loewe das Problem eines acappella-Oratoriums<br />
vorzüglich gelöst<br />
habe“. 7 Vom „Schubertbund Essen“ ist<br />
der Mitschnitt eines Vortrags des Werkes<br />
erhältlich, der zeigt, dass Loewes<br />
Komposition heute noch lebensfähig ist.<br />
Das zweite Männerchor-Oratorium<br />
„Die Apostel von Philippi“, 1835 unter<br />
Loewes Leitung in Jena erfolgreich uraufgeführt,<br />
schildert die Befreiung von<br />
Paulus und zwei seiner Jünger aus<br />
dem Gefängnis durch ein Erdbeben.<br />
Römer und Christen stehen sich gegenüber,<br />
dargestellt in wirkungsvollen<br />
Chören oder in Form eines Doppelchors;<br />
Loewe verlangt den Einsatz von<br />
fünf Chorgruppen und acht Solisten.<br />
Das Oratorium ist noch stärker als „Die<br />
eherne Schlange“ szenisch gedacht<br />
und stellt an die Sänger weit größere<br />
gesangliche Anforderungen. Bulthaupt<br />
meint, das die Heranziehung eines Orchesters<br />
dem Werk „einen <strong>Sie</strong>geslauf<br />
vermutlich bis auf unsere Zeit gebracht“<br />
hätte. 8<br />
Johann Huss (1841)<br />
Das Libretto <strong>zu</strong> diesem Oratorium<br />
stammt von Johann August Zeune,<br />
damaligem Leiter der Berliner Blindenanstalten.<br />
Er gliedert die Handlung in<br />
einen Prolog und sechs Szenen. Huss<br />
wird 1415 vor das Konzil <strong>zu</strong> Costnitz<br />
geladen, Prager Studenten versuchen<br />
seine Abreise <strong>zu</strong> verhindern. Doch<br />
Huss vertraut auf das ihm <strong>zu</strong>gesagte<br />
freie Geleit, bei seinem Abschied erläu-<br />
NC 2 / 09 41
tert er seine reformatorischen Thesen.<br />
Unterwegs trifft er Zigeuner und Wanderer,<br />
die ihn auch <strong>zu</strong>r Rückkehr bewegen<br />
wollen. Die nächste Szene zeigt im<br />
Schloss <strong>zu</strong> Costnitz König <strong>Sie</strong>gmund im<br />
Gespräch mit der Königin, hier bereits<br />
äußet der König, sich nicht an die Zusage<br />
des freien Geleist halten <strong>zu</strong> müssen.<br />
Die Königin berichtet von einem Unheil,<br />
das ihr im Traum widerfuhr und warnt<br />
vor dem Bruch des Versprechens. In<br />
einer Gerichtsverhandlung wird Huss<br />
als Ketzer <strong>zu</strong>m Tode verurteilt, auf dem<br />
Weg <strong>zu</strong>m Scheiterhaufen weist er prophetisch<br />
auf den hin, der sein Vorhaben<br />
und sein Werk in hundert Jahren vollenden<br />
wird.<br />
Allgemein wird Loewes Musik der<br />
Vorwurf gemacht, dass sie im Genrehaften<br />
und in kleinen Szenen steckenbleibt.<br />
Einzelne Chöre und Arien mögen<br />
für sich genommen noch akzeptabel<br />
sein, doch fügen sie sich nicht <strong>zu</strong> einer<br />
großen Komposition mit innerem Zusammenhang.<br />
Bulthaupt weist darauf<br />
hin, dass in einem Oratorium, dass von<br />
Glaubensauseinanderset<strong>zu</strong>ngen, Qualen<br />
und Martyrium handelt, liebliche<br />
Pastoralweisen oder „winzige Einfälle“<br />
wie <strong>zu</strong>m Chor der Studenten nicht am<br />
Platze sind. 9 Auch die Instrumentierung<br />
wird als „stilistisch bunt“ angesehen,<br />
ebenso der „ernüchternde Wechsel der<br />
Formen“. 10 Huss‘ Schlussworten <strong>beim</strong><br />
Tod in den Flammen unterlegt Loewe<br />
die Melodie des Luther-Chorals „Ein<br />
feste Burg“ und weist so auch musikalisch<br />
auf den später kommenden Reformator<br />
hin.<br />
Gutenberg (1835-1836)<br />
Anlass <strong>zu</strong>r Komposition dieses Orato-<br />
42 NC 2 / 09<br />
riums war die Einweihung einer Bildsäule<br />
Johann Gutenbergs in Mainz, Loewe<br />
erhielt den Auftrag 1835 vom Mainzer<br />
Stadtrat, 1837 wurde das Werk nach<br />
einem Text von Ludwig Giesebrecht<br />
uraufgeführt. Gutenberg, Erfinder des<br />
Buchdrucks mit beweglichen Lettern,<br />
will seine Neuerung nur für Drucke<br />
geistlicher Werke nutzen, Druckergehilfen<br />
aber haben einen Trutzbrief gegen<br />
Papst und Adel gedruckt. Ihr Anführer<br />
ist Faust, der <strong>zu</strong>m Gefolge des<br />
im Bann stehenden Kurfürsten Diether<br />
gehört. Dessen Mainzer Bürgerheer<br />
wird von den Truppen Adolph von Nassaus<br />
besiegt. Vor Gericht kommen der<br />
Trutzbrief und die neue Drucktechnik<br />
<strong>zu</strong>r Sprache, auch Gutenberg muss<br />
sich verantworten. Dieser versichert<br />
nochmals, dass das neue Verfahren<br />
allein <strong>zu</strong>r Verbreitung göttlicher Worte<br />
erfunden sei; er wird von Adolph von<br />
Nassau verpflichtet, jeden Missbrauch<br />
des Druckerhandwerks <strong>zu</strong> verhindern.<br />
So können die Anwesenden eine alle<br />
<strong>zu</strong>friedenstellende Einigkeit feiern.<br />
Die Musik lebt von den unterschiedlichen<br />
Chören der Drucker, Lehrlinge<br />
und Bürger, die sich auch in einer<br />
„Trichorie“ vereinigen, und der Kennzeichnung<br />
der handelnden Personen<br />
mit ihren so unterschiedlichen Wesenszügen<br />
und Anschauungen. Die<br />
Chöre sind <strong>zu</strong>m Teil vier- oder sogar<br />
sechsstimmig, eine große Tripelfuge<br />
beendet das Werk. Die Arien verlangen<br />
oft einen großen Tonumfang und die<br />
Beherrschung längerer Melismen oder<br />
umfangreicher Koloraturen. Anlässlich<br />
des Festes „Gutenberg 2000“ wurde<br />
das Oratorium im Mainzer Dom wieder<br />
aufgeführt; ein Konzertmitschnitt ist als<br />
CD erhältlich. 11
Abb. 3: Titelblatt des 1832 erschienenen Klavieraus<strong>zu</strong>gs von Loewes Oratorium “Die Zerstörung<br />
von Jerusalem”. Den Gepflogenheiten der Zeit entsprechend sind die Namen von Dichter und<br />
Komponist weniger auffallend gedruckt als der Name des Widmungsträgers, des preußischen<br />
Königs Friedrich Wilhelm III<br />
Die Zerstörung von Jerusalem (1829)<br />
Sicherlich das imposanteste und<br />
mitreißendste von Loewes Oratorien!<br />
Bereits die Beset<strong>zu</strong>ng zeigt größte<br />
Ausmaße: Zehn Solisten, acht unterschiedliche<br />
Chöre und ein umfangreiches<br />
Orchester. Die Musik wird beherrscht<br />
von gegeneinander gesetzten<br />
Kontrasten, vorwärts drängenden, von<br />
Leidenschaft geprägten Arien und einer<br />
für die damalige Zeit durchaus neuartigen<br />
Instrumentation. So fragt Reinhard<br />
Dusella, ob Loewe mit der „Zerstörung“<br />
nicht seine beste Oper geschrieben<br />
habe. 12<br />
Der Text von Gustav Nicolai behandelt<br />
die Zerstörung Jerusalems durch Titus<br />
im Jahre 70 n. Chr. Die Juden fühlen<br />
sich durch den römischen Statthalter<br />
Gessius Florus unterdrückt, versuchen<br />
ihm <strong>zu</strong> schmeicheln, doch dieser weist<br />
sie <strong>zu</strong>rück. In Gessius‘ Gefolge ist auch<br />
der jüdische König Agrippa mit seiner<br />
Schwester Berenice, die bei Gessius<br />
um Gnade für das jüdische Volk bitten.<br />
Agrippa findet auch <strong>beim</strong> Volk kein<br />
Gehör; Gessius ist entschlossen Jerusalem<br />
<strong>zu</strong> vernichten. Die Widerstandskämpfer<br />
in der Stadt sind <strong>zu</strong>nächst zerstritten,<br />
finden sich aber unter Einfluss<br />
des Hohenpriesters <strong>zu</strong>sammen. In Je-<br />
NC 2 / 09 43
usalem gibt es auch die ersten Christen,<br />
die sich ihres Glaubens wegen von<br />
den Ereignissen nicht berührt fühlen<br />
und sich nach Golgatha <strong>zu</strong>rückziehen.<br />
Titus hat sich in Berenice verliebt und<br />
will das Volk, sofern es Reue zeigt, vor<br />
der Vernichtung bewahren. Da dieses<br />
nicht <strong>zu</strong>r Buße bereit ist, befiehlt Titus<br />
den Angriff. Die Römer triumphieren,<br />
die Juden wünschen sich den Tod, aber<br />
die eigentlichen <strong>Sie</strong>ger sind die Christen,<br />
deren Glaube sich gegen den der<br />
Juden durchsetzt.<br />
Rezitative und Chorszenen gehören<br />
<strong>zu</strong> den beeindruckendsten Abschnitten<br />
des Oratoriums. Loewe verwendet auch<br />
christliche Choräle, sehr wirkungsvoll<br />
eingesetzte a-cappella-Chöre, Fugen<br />
(auch Doppelfugen) und wiederholt an<br />
geeigneten Stellen Themen, so dass<br />
der Eindruck einer Arbeit mit Leitmotiven<br />
entsteht.<br />
1996 wurde in Bad Urach „Die Zerstörung<br />
von Jerusalem“ erfolgreich aufgeführt.<br />
Das Hohelied Salomonis (1855)<br />
Als Textgrundlage verwendet Wilhelm<br />
Telschow das alttestamentliche Buch,<br />
das er recht geschickt in eine Rahmenhandlung<br />
eingliedert: Die Hirtin Sulamith<br />
sehnt sich nach ihrem Bräutigam;<br />
Salomo begegnet ihr und wirbt um sie.<br />
Sulamiths Liebeslied bezieht der König<br />
fälschlicherweise auf sich, Sulamith<br />
aber kann entkommen und <strong>zu</strong> ihrem<br />
Hirten gelangen. Salomo kann das<br />
Mädchen nicht vergessen und eilt ihr<br />
samt Gefolge nach. Sulamith gesteht<br />
Salomo, wen sie wirklich liebt, und sie<br />
kann ihren Bräutigam heiraten.<br />
Loewe versuchte, mit einem erweiter-<br />
44 NC 2 / 09<br />
ten Instrumentarium die Musik des Orients<br />
dar<strong>zu</strong>stellen: Triangel, Trommeln,<br />
Tamburin und Glockenspiel vervollständigen<br />
das Orchester; die meisten durchaus<br />
qualitätvollen Gesangsstücke sind<br />
aber von einem orientalisch-jüdischen<br />
Kolorit weit entfernt, der sich nur an<br />
einigen Stellen finden lässt. Die Arien<br />
verlangen von den Ausführenden große<br />
Fertigkeiten, die Melodien sind bisweilen<br />
stark am italienischen Opernstil<br />
der Zeit orientiert. Dem Inhalt des Oratoriums<br />
entsprechend gibt es nur relativ<br />
wenige Chorsätze, am eindrucksvollsten<br />
sind die Hirtenchöre „Der Winter ist<br />
vergangen“ und „Komm wieder, o Sulamith“.<br />
Nachdem „Das Hohelied“ einige<br />
Jahre nach seiner Entstehung in Stettin<br />
und Berlin aufgeführt wurde, scheint es<br />
in den Jahrzehnten danach keine Aufführungen<br />
mehr gegeben <strong>zu</strong> haben.<br />
Palestrina (1841)<br />
Der Textdichter Ludwig Giesebrecht<br />
greift auf die Erzählung <strong>zu</strong>rück, dass<br />
der Komponist Palestrina durch die<br />
Aufführung seiner „Missa papae Marcelli“<br />
vor dem Tridentiner Konzil im 16.<br />
Jh. die Mehrstimmigkeit für die Kirchenmusik<br />
gerettet haben soll. Giesebrecht<br />
führt um diese Handlung eine bunte Mischung<br />
von Winzern, nach Japan ziehenden<br />
Jesuiten, päpstlichen Kriegern,<br />
ausgewanderten Lutheranern, Palestrinas<br />
Frau, den Kardinälen und dem<br />
Papst ein – ein durchaus theatralischbühnenmäßig<br />
gedachter Stoff, dessen<br />
gegensätzlichen Figuren und Situationen<br />
Loewe mit seiner Musik nicht immer<br />
gerecht wurde. Christliche Choräle<br />
stehen etwas unvermittelt gegen Palestrinas<br />
eigene Messe, Palestrina ist in
seinen Arien <strong>zu</strong> wenig der Kämpfer für<br />
seine Sendung, die Einführung seiner<br />
Frau Fiametta in die Handlung wirkt<br />
– trotz durchaus gelungener Arien für<br />
sie – gekünstelt und die in bewusst<br />
altertümlichem Ton gehaltene Instrumentaleinleitung<br />
bleibt recht eintönig.<br />
13<br />
Der Meister von Avis (1843)<br />
Ludwig Giesebrechts Dichtung beruht<br />
auf dem Schauspiel „Der standhafte<br />
Prinz“ des spanischen Dichters<br />
Calderón de la Barca. Der portugiesische<br />
Prinz Fernando wird in Fez<br />
als Geisel gehalten. Der König von<br />
Fez hofft, im Austausch gegen den<br />
Prinzen die Stadt Ceuta <strong>zu</strong> erhalten;<br />
für die Christen ist der Prinz jedoch<br />
eine Hoffnung auf Befreiung von ihrem<br />
Sklavendasein. Der Vorsteher<br />
des Ordens von Avis trifft in Fez ein<br />
und stimmt dem Tausch des Prinzen<br />
gegen die Stadt <strong>zu</strong>, die <strong>zu</strong>m Teil auch<br />
dem Orden gehört. Prinz Fernando als<br />
Meister des Ordens muss daher dieser<br />
Vereinbarung <strong>zu</strong>stimmen. Er ruft aber<br />
da<strong>zu</strong> auf, um Ceuta <strong>zu</strong> kämpfen. Dadurch<br />
wird er seiner bisher privilegierten<br />
Gefangenenstellung beraubt und<br />
<strong>zu</strong>m Sklaven gemacht. Der Prinz wird<br />
in der Haft immer matter, bei einem<br />
Zusammentreffen mit der Prinzessin<br />
von Fez und deren Bräutigam stirbt er.<br />
Sein Geist leitet das in Fez gelandete<br />
portugiesische Heer und fordert von<br />
ihm, das Brautpaar gefangen <strong>zu</strong> nehmen<br />
und gegen die christlichen Sklaven<br />
aus<strong>zu</strong>lösen. Die Prinzessin bringt<br />
ihren Vater da<strong>zu</strong>, den Tausch durch<strong>zu</strong>führen;<br />
alle preisen den Frieden;<br />
die Prinzessin vermag sich aber mit<br />
der christlichen Lehre nicht <strong>zu</strong> identifizieren,<br />
am Schluss macht der Chor<br />
deutlich, dass der Tod des Meisters ihr<br />
das Leben gebracht habe.<br />
Die Bibliothek Ksiaznica Pomorska<br />
in Stettin besitzt, wie erst seit einiger<br />
Zeit bekannt ist, eine handschriftliche<br />
Abschrift der Partitur des Werkes 14 ,<br />
das musikalisch in neuerer Zeit noch<br />
nicht ausgewertet wurde und von<br />
dem nur einige Arien gedruckt in der<br />
17bändigen Gesamtausgabe der Lieder<br />
und Balladen Loewes durch Max<br />
Runze (1899-1904) bekannt sind.<br />
Arnold Schering lobt die Chöre 15 ;<br />
eindrucksvoll ist vor allem der ariose<br />
Gesang des sterbenden Meisters,<br />
dessen Worte dem „Stabat mater“<br />
entnommen sind. Nahe<strong>zu</strong> alle Kommentatoren<br />
stören sich an der Einordnung<br />
des Werkes als „Oratorium“; es<br />
stehe auf der Grenze zwischen Oper<br />
und Oratorium und sei weder das eine<br />
noch das andere.<br />
Weitere kleinere Oratorien<br />
„Polus von Atella“ (1856-1859)<br />
scheint über eine einzige Aufführung<br />
1860 in Stettin nicht hinaus gekommen<br />
<strong>zu</strong> sein. Giesebrecht als Textdichter<br />
stellt die Bekehrung des Komödianten<br />
Polus dar. Bei seiner Taufe<br />
im Tiber durch den greisen Bischof erwarten<br />
die Besucher wieder eine lustig-fröhliche<br />
Inszenierung voller Spott,<br />
Polus aber steigt bekehrt als Paulus<br />
aus dem Wasser auf. Der römische<br />
Kaiser, wütend über das entgangene<br />
Schauspiel, lässt ihn <strong>zu</strong> sich kommen<br />
und überantwortet ihn dem Feuer.<br />
Mutter, Schwester und Bischof segnen<br />
Polus im festen Glauben an den<br />
NC 2 / 09 45
kommenden <strong>Sie</strong>g des Christentums.<br />
Loewes Musik zeichnet sich aus durch<br />
lebendige Chöre, deren Melodien oft<br />
den Charakter italienischer Volkstänze<br />
haben, durch geschickte Benut<strong>zu</strong>ng<br />
von Chorälen (vor allem von „Wie schön<br />
leuchtet der Morgenstern“), durch eine<br />
differenzierende Instrumentation sowie<br />
eine anspruchsvolle Harmonisierung<br />
der Melodien. Die Arien sind entweder<br />
schlicht gehalten oder virtuos angelegt.<br />
Sicher hat das Werk auch Schwächen,<br />
ist aber doch den Versuch einer Neuinszenierung<br />
wert!<br />
In seinen letzten Lebensjahren nach<br />
1860 schuf Loewe drei Vokaloratorien,<br />
bei denen als Begleitung nur Orgel oder<br />
auch Klavier vorgesehen sind. Auch<br />
die Zahl der Solisten bleibt klein, und<br />
jeweils nur ein Chor mit 4-5 Stimmen<br />
tritt auf.<br />
„Die Auferweckung des Lazarus“<br />
(1863) liegt in einer einstündigen CD-<br />
Aufnahme des Labels Capriccio (Nr. 10<br />
581) vor. Loewe stellte den Text nach<br />
Worten des Johannes-Evangeliums<br />
selbst <strong>zu</strong>sammen. Wie in barocken<br />
Oratorien gibt es einen Evangelisten,<br />
dessen Stimme ungewöhnlicherweise<br />
einem Alt <strong>zu</strong>geteilt ist. Die Melodien<br />
sind recht einprägsam, gelegentlich etwas<br />
opernhaft; die Anforderungen an<br />
den Chor nicht all<strong>zu</strong> hoch, und kleine<br />
Passagen auf der Orgel sorgen für Abwechslung.<br />
In „Johannes der Täufer“<br />
(1861), wieder von Loewe nach Texten<br />
aus den Evangelien <strong>zu</strong>sammengestellt,<br />
wird die Stimme des Erzählers einem<br />
Sopran übertragen. Das Oratorium enthält<br />
überdurchschnittlich viele und auch<br />
anspruchsvolle Chorszenen, die Or-<br />
46 NC 2 / 09<br />
gelbegleitung entwickelt recht oft eine<br />
Unabhängigkeit von der Melodiestimme,<br />
während die Arien <strong>zu</strong>meist schlicht<br />
gehalten sind. Der Text <strong>zu</strong> „Die Heilung<br />
des Blindgebornen“ (1860/61) wurde<br />
von Loewe nach dem Johannes-Evangelium<br />
gestaltet und offenbar bewusst<br />
in Richtung einer nicht all<strong>zu</strong> schweren<br />
Ausführung komponiert. Die Chorsätze<br />
sind dramatisch angelegt, während die<br />
Arien ausgesprochen sanften Charakter<br />
haben. Der Orgel sind am Anfang<br />
und an anderen Stellen kleine solistische<br />
Aufgaben <strong>zu</strong>gewiesen.<br />
Eine Schlussbemerkung<br />
Die Übersicht macht deutlich, dass<br />
Loewe sich nicht an eine feste Form<br />
des Oratoriums gebunden fühlte. Wie<br />
auch in seinen Klaviersonaten versuchte<br />
er sich immer wieder in neuen Darstellungen.<br />
Die Grenzüberschreitung<br />
zwischen Oper und Oratorium wurde<br />
ihm oft <strong>zu</strong>m Vorwurf gemacht, letztlich<br />
mag die Diskussion darüber akademischer<br />
Natur sein, wenn nur das Werk<br />
als solches die Hörer anspricht und<br />
überzeugt. Nicht genug <strong>zu</strong> loben ist<br />
sein Sinn für Aufführungen durch Gemeinden<br />
mit geringeren musikalischen<br />
Mitteln; dies gilt vor allem für die <strong>zu</strong>letzt<br />
entstandenen Vokaloratorien, aber<br />
auch für die Wiedergabe des „Sühnopfers“<br />
mit Orgel- oder Klavierbegleitung.<br />
Der <strong>zu</strong>nächst etwas befremdlich<br />
wirkende Versuch, Oratorien nur für<br />
Männerstimmen <strong>zu</strong> komponieren, hatte<br />
<strong>zu</strong>r Entstehungszeit der Werke seine<br />
Berechtigung; heute ist die Zahl der<br />
Männergesangvereine stark <strong>zu</strong>rück gegangen,<br />
so dass man nur die Hoffnung<br />
haben kann, dass der eine oder andere
Verein auf die durchaus bedeutsamen<br />
beiden Oratorien dieser Richtung aufmerksam<br />
wird. Die Legenden-Oratorien<br />
mit mehr oder minder starkem<br />
christlichem Be<strong>zu</strong>g oder die weltlich<br />
ausgerichteten Werke bilden eine gute<br />
Abwechslung <strong>zu</strong> den rein biblischen<br />
Oratorien, die heut<strong>zu</strong>tage im Vordergrund<br />
an christlichen Festen stehen.<br />
Die Aufführungen von Loewe-Oratorien<br />
in den letzten 20 Jahren und die CD-<br />
Einspielungen zeigen, dass Oratorien<br />
nicht nur von den immer gleichen<br />
Komponisten wie Bach, Händel, Haydn<br />
oder Mendelssohn Bartholdy gegeben<br />
werden müssen; mag Loewes schöpferisches<br />
Talent auch mehr oder minder<br />
weit unter ihnen stehen, so hat er doch<br />
neben seinen Balladen auch Aufmerksamkeit<br />
für dieses Schaffensgebiet verdient.<br />
Dr. Michael Wilfert<br />
Geboren 1944 in Hemer (Kreis Iserlohn),<br />
1963 Abitur in Baden-Baden,<br />
danach Studium der Zoologie an<br />
der FU Berlin und an der Universität<br />
<strong>Düsseldorf</strong>. Promotion 1972 <strong>zu</strong>m Dr.<br />
rer. nat., Lehrer an einer Schule in<br />
<strong>Düsseldorf</strong>. Mitglied des Redaktionsbeirats<br />
der Zeitschrift „Pommern".<br />
Zahlreiche Veröffentlichungen <strong>zu</strong>r<br />
Musikgeschichte Pommerns, über<br />
Komponisten aus Pommern und<br />
<strong>zu</strong>m Werk von Carl Loewe.<br />
www.carl-loewe-gesellschaft.de<br />
1 Überblick bei R. Dusella, Die Oratorien Carl<br />
Loewes. Bonn, 1991.<br />
2 Die Partitur erschien in der Edition<br />
Hänssler, der Klavieraus<strong>zu</strong>g im Carus-Verlag;<br />
CD-Aufnahmen bei FSM (FCD 97755) und<br />
Naxos (hier vollständiger!), Nr. 8.557635-36.<br />
3 A, Schering, Geschichte des Oratoriums,<br />
S.406-424. Leipzig, 1911.<br />
4 Einspielung durch die Kantorei der<br />
Schlosskirche Bad Dürkheim; dort ist die CD<br />
erhältlich.<br />
5 J.A. Modeß, Carl Loewes Oratorium Die<br />
sieben Schläfer op. 46. In E. Ochs, L. Winkler<br />
(eds.): Carl Loewe. Beiträge <strong>zu</strong> Leben, Werk<br />
und Wirkung. S. 297-308. Frankfurt a. M.,<br />
Berlin,1998.<br />
6 C.H. Bitter: Dr. Carl Loewes Selbstbiographie,<br />
S. 204. Berlin, 1870.<br />
7 Vgl. Anm. 3.<br />
8 H. Bulthaupt, Carl Loewe. Berlin, 1898.<br />
9 Ebenda.<br />
10 Vgl. Anm 3.<br />
11 „Gutenberg“, Philharmonisches Orchester<br />
des Staatstheaters Mainz, Leitung: Mathias<br />
Breitschaft; Stadt Mainz, ACO CD 111 00.<br />
12 R. Dusella: Loewes erfolgreichste Oper?<br />
Das Oratorium Die Zerstörung von Jerusalem.<br />
In: E. Ochs, L. Winkler (eds.), Carl<br />
Loewe. Beiträge <strong>zu</strong> Leben, Werk und Wirkung,<br />
S. 391-395. Frankfurt a. M. und Berlin,<br />
1998.<br />
13 Arien aus „Palestrina“ und anderen Loewe-<br />
Oratorien auf der CD: Carl Loewe, Arien und<br />
Duette aus Opern und Oratorien. Koch Schwann,<br />
Nr. 3-5054-8.<br />
14 W. Dziechciowska, Musikdrucke und<br />
Handschriften von Carl Loewe im Bestand<br />
der Ksiaznica Pomorska in Szczecin. In: E.<br />
Ochs, L. Winkler (eds.), Carl Loewe. Beiträge<br />
<strong>zu</strong> Leben, Werk und Wirkung. S. 375-378.<br />
Frankfurt a.M. und Berlin, 1998.<br />
15 Vgl. Anmerkung 3.<br />
NC 2 / 09 47
Buchrezension: Beethovens 10. Sinfonie<br />
von Dr. Thomas Ostermann<br />
Vielleicht gehören <strong>Sie</strong> auch <strong>zu</strong>r Gruppe<br />
derjenigen NeueChorszene-Leser,<br />
die sich in Internet-Plattformen tummeln.<br />
Auf einigen von Ihnen kann man<br />
dann feststellen, über welche Kontakte<br />
man mit einer Person verbunden ist, die<br />
man gerade auf dem Bildschirm vorfindet.<br />
Meistens braucht man, ausgehend<br />
von seinen eigenen Kontakten dafür<br />
nur weniger als fünf Stationen. Bereits<br />
1967 hat Stanley Milgram diesen Zusammenhang<br />
mit dem Begriff „Kleine-<br />
Welt-Phänomen“ (engl. „small world<br />
paradigm“) bezeichnet.<br />
Was hat das nun mit dem aktuell <strong>zu</strong><br />
besprechenden Buch <strong>zu</strong> tun? Nun, offensichtlich<br />
gilt dieser Zusammenhang<br />
auch für manche neu auf dem Markt<br />
erschienenen Bücher. Der aufmerksame<br />
Leser hat vielleicht noch die letzten<br />
Ausgabe der Neuen Chorszene griffbereit<br />
oder kann sich trotz des regelmäßigen<br />
Abtransports von Altpapier<br />
an die Artikel erinnern. Aktuell wurden<br />
dort Chorsinfonien mit den Numerierungen<br />
1-9 behandelt. Da<strong>zu</strong> eine Rezension<br />
über „Das Grauen der Nacht“<br />
in dem Bachs Goldberg-Variationen<br />
auftauchen. Einge Ausgaben vorher<br />
gab es Rezensionen <strong>zu</strong> einem Roman,<br />
der eine verschollene Partitur Vivaldis<br />
<strong>zu</strong>mThema hatte (den Titel dieses Romans<br />
wiederhole ich aus guten Gründen<br />
nicht). Etwas älteren Datums war<br />
ein Beitrag <strong>zu</strong>r Musiktherapie meines<br />
Kollegen Lutz Neugebauer.<br />
Und nun habe ich gerade die letzten<br />
Seiten des Romans „Die 10. Symphonie“<br />
von Joseph Gelinek auf dem Rück-<br />
48 NC 2 / 09<br />
flug von Wien nach <strong>Düsseldorf</strong> gelesen.<br />
Bei diesem Autor handelt es sich um<br />
ein Pseudonym eines spanischen Musikwissenschaftlers,<br />
der echte Joseph<br />
Gelinek stammte aus Böhmen und war<br />
<strong>zu</strong> Mozarts und Beethovens Zeit ein<br />
begehrter Klavierlehrer und Hauspianist<br />
und lebte von 1758 bis 1825.<br />
In diesem Roman nun tauchen wie in<br />
dem von Milgram beschriebenen „Kleine-Welt-Phänomen“<br />
nun viele direkte<br />
Kontakte <strong>zu</strong> den bisherigen Artikeln der<br />
NC auf. Natürlich handelt es sich, wie<br />
der Leser im Laufe des Romans erfährt,<br />
bei der verschollenen Partitur um eine<br />
Chorsinfonie. Und auch Wien, genauer,<br />
die spanische Hofreitschule spielt hier<br />
eine nicht unwichtige Rolle. Ebenfalls<br />
wird hier, allerdings nur als Nebenstrang<br />
die Musiktherapie aufgegriffen.<br />
Und leider sind der Erzählstil und die<br />
Charaktere von Gelinek oft recht oberflächlich<br />
und erinnern manchmal an<br />
den oben genannten Roman über Vivaldis<br />
verschollene Partitur.<br />
Warum also sollte man dieses Buch<br />
lesen? Nun, es enthält im Gegensatz <strong>zu</strong><br />
vielen auf dem Markt befindlichen Werken<br />
einen wahren Kern: <strong>zu</strong>r 10. Sinfonie<br />
existiert von Beethoven eine große Anzahl<br />
von Skizzen (siehe Abb. 1)<br />
Der Roman von Gelinek bietet nun<br />
dem Leser die Möglichkeit, die historischen<br />
Fakten eingebettet in einen<br />
durchaus nicht unspannenden Szenario<br />
kennen <strong>zu</strong> lernen.<br />
Der Musikwissenschaftler, Dozent<br />
und Beethovenfan Daniel Paniagua bekommt<br />
die Möglichkeit, die Rekonstruk-
Abb1.<br />
tion von Beethovens erstem Satz der<br />
10. Symphonie im Rahmen einer privaten<br />
Aufführung <strong>zu</strong> Gehör <strong>zu</strong> bekommen.<br />
Während der Aufführung bekommt er<br />
bereits Zweifel an der „Rekonstruktion“<br />
und glaubt vielmehr, es handele sich<br />
um das komplett fertiggestellte Autograph<br />
von Beethoven.<br />
Er sucht den Dirigenten noch am Aufführungsabend<br />
auf, dieser hat jedoch<br />
keine Zeit und wird leider kurze Zeit<br />
später ermordet aufgefunden.<br />
Und nun kommen neben den üblichen<br />
Verdächtigen (Freimaurer, Illuminaten)<br />
auch noch (und dies wird meinen frankophilen<br />
Chorszene-Autor Erich Gelf<br />
sicherlich freuen) die Nachfahren von<br />
Napoleon und ein mysteriöses Porträt<br />
des Komponisten ins Spiel. Natürlich<br />
dürfen auch Zahlencodes und eine Liebesgeschichte<br />
nicht fehlen, vor allem<br />
letztere ist allerdings nicht unbedingt<br />
ein Gewinn für den Roman. Zum Ende<br />
hin gibt es dann noch einen Schwenk<br />
<strong>zu</strong> Beethovens unsterblicher Geliebter.<br />
<strong>Sie</strong>ht man also von diesen eher nicht<br />
so gelungenen Elementen ab, so hat<br />
der Leser, der sich durch 424 Seiten<br />
gelesen hat, einiges über Beethoven<br />
erfahren. Für mich hat es für ca. vier<br />
Stunden Flugzeit gereicht. Allerdings<br />
hat es entgegen dem Klappentext<br />
schon Thriller gegeben, die „besser geklungen“<br />
haben.<br />
Hintergrundmaterial:<br />
Leser, die die Rekonstruktion der<br />
Zehnten hören möchten, können dies<br />
hypothetisch tun: Barry Cooper veröffentlichte<br />
1988 einen Sinfonie-Satz mit<br />
der Tempobezeichnung Andante - Allegro<br />
- Andante als Sinfonie Nr. 10 in<br />
Es-Dur, der auf Beethovens Skizzen<br />
<strong>zu</strong> seiner 10. Sinfonie aus den Jahren<br />
1822-1825 beruht. Dieser Sinfonie-Satz<br />
wurde schon mehrfach auf CD eingespielt.<br />
Leider konnte ich bisher keine<br />
Be<strong>zu</strong>gsquelle in Erfahrung bringen.<br />
Daneben gibt es noch eine CD<br />
des Trans-Siberian Orchestras <strong>zu</strong><br />
„Beethoven´s Last Night“, in der im<br />
Stile eines Musicals ein Dialog von<br />
Beethoven und Mephistopheles über<br />
die Zehnte gesponnen wird.<br />
Joseph Gelinek: Die 10.<br />
Symphonie (Broschiert);<br />
Knaur Verlag, 14,95 €<br />
NC 2 / 09 49
Wuppertaler Singpause...<br />
...auch ein Beitrag <strong>zu</strong>m Haydn-Jahr von Udo Kasprowicz<br />
Zwischen zwei Skriabin Konzerten<br />
lockte uns der Chor der Konzertgesellschaft<br />
Wuppertal <strong>zu</strong>r Probe ins Bergische<br />
Land. Nach dem Prinzip „Eine<br />
Hand wäscht die andere“ oder „Skriabin<br />
Männer von Euch gegen Haydn Sänger<br />
von uns“, hatte man uns die Mitwirkung<br />
an der „Schöpfung“ in der Wuppertaler<br />
Konzerthalle angeboten. Ist es schon<br />
verlockend genug <strong>zu</strong> Pfingsten „<strong>zu</strong><br />
Ehre Gottes und seiner Hände Werk“<br />
<strong>zu</strong> singen, so erhebt die Doppelung<br />
der Ereignisse - Pfingsten und der 200.<br />
Todestag Joseph Haydns fallen <strong>zu</strong>sammen<br />
- das Konzert in den Rang des<br />
Einzigartigen.<br />
Aber ohne Proben kein Konzert!<br />
Also brechen wir - zwei Getreue aus<br />
dem Linksrheinischen - dem Mittagessen<br />
schnöde entsagend auf in die<br />
Stadt der Schwebebahn, <strong>zu</strong>r Wiege der<br />
deutschen Industrialisierung, in die Heimatstadt<br />
Friedrich Engels, Else Lasker<br />
Schülers und immerhin noch 356.420<br />
lebender Menschen, um dort in der Burgunder<br />
Str. (wahrscheinlich hatte <strong>Sie</strong>gfried<br />
auf dem Weg von Xanten nach<br />
Worms hier sein berühmtes Schwert<br />
Balmung bestellt, denn in Deutschland<br />
wird keine Straße grundlos benannt!)<br />
<strong>zu</strong> proben.<br />
Inmitten eines Raumes von industriegeschichtlichem<br />
Charme unterstreicht<br />
ein Flügel aus der ältesten Klavierfabrik<br />
der Welt gleich um die Ecke in<br />
Schwelm das Selbstbewusstsein des<br />
hier beheimateten Chores. Freundliche<br />
Begrüßung, Einsingen und los: Schon<br />
die ersten Takte entlarvten mein Vorhaben,<br />
in vier Proben ein so riesiges Werk<br />
50 NC 2 / 09<br />
wie die Schöpfung aus den versteckten<br />
Hirnwindungen wieder hervor<strong>zu</strong>zaubern<br />
und aufführungsreif auf<strong>zu</strong>frischen,<br />
als Hybris. Umgeben von absolut sicheren<br />
Nachbarn können meine falschen<br />
Töne nicht verborgen bleiben.<br />
Dennoch kein scheeler Blick, kein bissiger<br />
Kommentar, sondern freundliche<br />
Aufmunterung.<br />
Nach einer Stunde sind wir und das<br />
halbe Werk geschafft. Also: Singpause!<br />
Hinter einer Tür erwartet uns eine<br />
Überraschung. Die ruhmreichen Bergischen<br />
wissen <strong>zu</strong> leben. Die verschiedensten<br />
Obstkuchen, einer köstlicher<br />
als der andere, Schokoladentorten,<br />
kleine pikante Häppchen mit erlesenem<br />
Aufstrich, gefüllte Blätterteigtörtchen,<br />
Obst und Gemüserohkost für die<br />
Kalorienfeinde und Kaffee aus riesigen<br />
Kannen, die still vor sich hin dröppeln<br />
und der Chorjause etwas von einem<br />
verschwenderischen Gelage geben. Im<br />
Nu ist der Raum mit Menschen gefüllt,<br />
die sich blendend unterhalten und den<br />
guten Gaben kräftig <strong>zu</strong>sprechen. Der in<br />
dieses Ritual nicht eingeführte Chronist<br />
muss nicht lange gebeten werden und<br />
lässt es sich wohl sein. Auf der Rückfahrt<br />
beschließen wir, auch im <strong>Musikverein</strong><br />
für ein kulinarisches Verständnis<br />
von „Singpause“ <strong>zu</strong> werben.<br />
Nichts eignet sich da<strong>zu</strong> besser als<br />
Barbaras 1/2 Pfund Kuchen:<br />
½ Pfund Butter<br />
½ Pfund Zucker<br />
½ Pfund Mehl<br />
½ Pfund gemahlene Nüsse<br />
4 Eier<br />
1 Päckchen Backpulver
Rosinen, Zimt, Zitronensaft und etwas<br />
geriebene Zitronenschale nach<br />
Geschmack und (nur?) 3 Esslöffel Rum<br />
<strong>zu</strong> einem Rührteig verarbeiten, in eine<br />
vorbereitete Kastenform geben und 60<br />
Minuten bei 160 0 bis 180 0 backen.<br />
Die Hüterin des Rezeptes ließ es dabei<br />
nicht bewenden, sondern gewährte<br />
bei nächster Probengelegenheit in<br />
wenigen Zeilen Einblick in ihre kulinarische<br />
Erfahrungswelt. Wir wollen sie<br />
selbst <strong>zu</strong> Wort kommen lassen:<br />
„Ich hatte Bio Dinkelmehl genommen,<br />
ca. 200gr. Butter und nur 150 gr. Zukker,<br />
statt Backpulver Natron, außer Zimt<br />
noch <strong>Korea</strong>nder und Kardamom und<br />
etwas geraspelte Schokolade. Eventuell<br />
etwas Milch oder Wasser, so dass<br />
der Teig geschmeidig ist. 20 Minuten<br />
quellen lassen! Weitere Varianten, z.B.<br />
Sonnenblumenkerne(?) selbst ausprobieren.“<br />
Ob es die Köstlichkeiten der Singpause<br />
waren oder ob sich der Genius<br />
Haydns in der Aufführung auf uns herabsenkte,<br />
man weiß es nicht! Veronika<br />
Pantel schwelgte jedoch in der Westdeutschen<br />
Zeitung vom 4. Juni: „Die<br />
aufwändigen fugalen Partien meistert<br />
der Chor sicher, er glänzt mit präzisen<br />
Einsätzen und folgt den extremen<br />
Dynamik-Anweisungen des Dirigats<br />
bedingungslos. So gelingen fesselnde<br />
Darstellungen.(...) „Vollendet ist<br />
das große Werk“ - so jubelt der Chor<br />
am Ende des zweiten Teils.(…) Von<br />
Soli durchsetzt klingt es machtvoll auf:<br />
„Singt dem Herrn alle Stimmen“.“<br />
Vielen Dank dafür, dass wir dabei sein<br />
durften!<br />
Pfingstsonntag 31.05.2009 und 200. Todestag Josef Haydns: in der Historischen Stadthalle<br />
Wuppertal erklingt unter der Gesamtleitung von Andreas Spering «Die Schöpfung»<br />
mit dem Sinfonieorchester Wuppertal, Elena Fink, Sopran, Cornel Frey, Tenor, Kay Stiefermann,<br />
Bass, dem Chor der Konzertgesellschaft Wuppertal und Mitgliedern des <strong>Städtischen</strong><br />
<strong>Musikverein</strong>s <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong>, Einstudierung Marieddy Rossetto. Foto Gerhard Bartsch<br />
NC 2 / 09 51
Der Städtische <strong>Musikverein</strong><br />
probt jeweils um 19.25 Uhr<br />
im Helmut-Hentrich-Saal der Tonhalle, Eingang Rheinseite.<br />
Marie-Colinet-Straße 14<br />
40721 Hilden<br />
Ruf: +49 (0)2103-9448-0<br />
Fax: +49 (0)2103-32272<br />
E-Mail: info@weber-feuerloescher.de<br />
Gemeinschaftsproben für alle<br />
Stimmen finden i.d.R.<br />
dienstags statt. Proben mit<br />
chorischer Stimmbildung werden<br />
montags für die Herren und<br />
donnerstags für die Damen<br />
um 19 Uhr angeboten.<br />
Tel.: 02103-944815<br />
(Manfred Hill, Vorsitzender) oder<br />
Tel.: 0202-2750132<br />
(Marieddy Rossetto, Chordirektorin)<br />
Aus Anlass von Händels 250.<br />
Todestag gibt der Städt. <strong>Musikverein</strong><br />
- in leicht verringerter<br />
Auflage - eine Sonderausgabe<br />
seiner Zeitschrift NeueChorszene<br />
heraus. <strong>Sie</strong> kann auf telefonische<br />
Anfrage oder über<br />
info@musikverein-duesseldorf.de<br />
angefordert werden<br />
Hermann Weber<br />
Feuerlöscher GmbH<br />
Feuerlöscherfabrik<br />
ISSN-Nr. 1861-261X