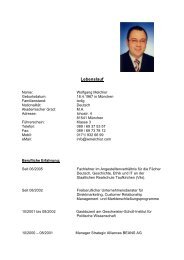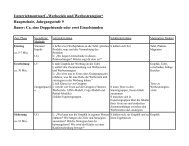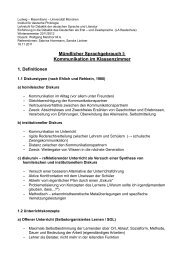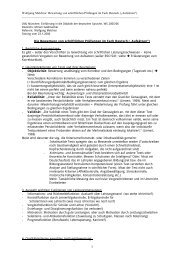Rawls - Wolfgang Melchior
Rawls - Wolfgang Melchior
Rawls - Wolfgang Melchior
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Melchior</strong>: John <strong>Rawls</strong>’ Theorie der Gerechtigkeit<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
selbst ändern. Der Kooperator soll jetzt ein Recht besitzen, Kooperation von seinem Mitspieler zu<br />
verlangen (ein Forderungsrecht). Ich möchte dies auf zwei Weisen interpretieren:<br />
- einmal im Sinne eines Rechtssicherheits- oder Kooperationspostulats, welches das Dilemma zum<br />
Verschwinden bringen soll: jetzt wird behauptet, so wie das <strong>Rawls</strong>´ Fairneßprinzip auch nahelegt,<br />
daß der Kooperator ein Risiko auf sich nimmt, wenn er einseitig kooperiert. Das Risiko besteht<br />
darin, daß er wegen der Defektion als dominanter Strategie als „Gelackmeierter“ (sucker) dastehen,<br />
also die niedrigste Auszahlung (Payoff) erhalten wird. Nun wird in das Spiel die Bedingung<br />
eingebaut, daß das Risiko auf Seiten des Kooperators „bezahlt“ wird in Form eines<br />
Forderungsrechts gegenüber dem Mitspieler. Auf solche gegenseitigen Forderungen einigen sich<br />
zuvor die Spieler. Defektion wird entweder bestraft oder Kooperation belohnt, unabhängig davon,<br />
was der Gegner wählt. Damit entstehen zwar externe Kosten, jedoch wird ein Vertragstheoretiker<br />
argumentieren können, diese seien auf lange Sicht denjenigen vorzuziehen, die aus einem Zustand<br />
dauernder Rechtsunsicherheit und beständiger Defektion entstünden. In dieser Sichtweise ist das<br />
Fairneßprinzip eine Art Belohnungs- oder Bestrafungsprinzip. 50<br />
immer noch innerhalb der vom Gefangenendilemmaspiel eng gesteckten Grenzen.<br />
Wir bewegen uns damit aber<br />
- oder es wird schlicht behauptet, es sei sinnlos, die „Quadratur des Kooperationsproblems“ zu<br />
versuchen, und die Kooperation unter möglichst schwachen Annahmen aus eigennutzorientierten<br />
Strategien mit Hilfe von gemeinsamen Strategien (joint strategies) oder Optimierungsverfahren<br />
herzuleiten. Dann wird das Fairneßprinzip als Prinzip eingeführt, welches das Scheitern oder die<br />
Sinnlosigkeit dieser Versuche konstatiert. Jetzt hat man das Spiel endgültig verlassen und fragt sich,<br />
wie Rahmenverträge aussehen sollen, die die Einhaltung der inneren Verträge (Kooperationen)<br />
garantieren.<br />
<strong>Rawls</strong> scheint zur letzten Interpretation zu neigen. <strong>Rawls</strong> hat in seinen späteren Schriften das<br />
Fairneßprinzip als nicht ableitbar, sondern als eine freistehende Sichtweise (free-standing view)<br />
bezeichnet. In PL diskutiert er das als These von der Unabhängigkeit des Vernünftigen (reasonable)<br />
vom Verstandesmäßigen (rational). Das reasonable bezeichnet das Kooperationsprinzip, welches<br />
die Verpflichtung zu einem Schema des gegenseitigen Vorteils verlangt. Das rational bezeichnet<br />
die individuelle Rationalität gemäß dem Nutzenmaximierungsprinzip.<br />
In justice as fairness the reasonable and the rational are taken as two distinct and independent basic<br />
50 In der Spieltheorie wird dies durch kooperative ultimatum games bewerkstelligt, in denen die Spieler sich<br />
im voraus auf bestimmte Forderungen gegeneinander festlegen. Jeder Bruch der Verpflichtung hat eine Strafe zur<br />
Folge, die mindestens so groß sein muß, daß sie den Vertragsbruch unprofitabel macht. Man kann auch Defektion von<br />
vorneherein besteuern (Vgl. Clarke (1980)). Kooperativ heißt dabei, daß eine sog. pre-play negotiation möglich ist. Die<br />
Spieler können vorher also Absprachen und Vereinbarungen treffen.<br />
- 40 -