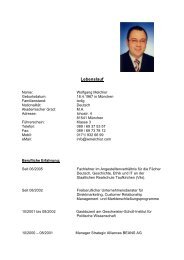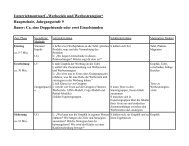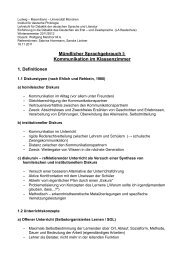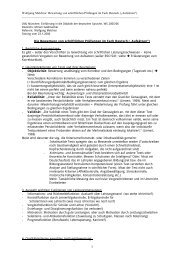Rawls - Wolfgang Melchior
Rawls - Wolfgang Melchior
Rawls - Wolfgang Melchior
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Wolfgang</strong> <strong>Melchior</strong>: John <strong>Rawls</strong>’ Theorie der Gerechtigkeit<br />
_______________________________________________________________________________________<br />
In diesem Sinne könnte sich herausstellen, daß jede Moraltheorie zwangsläufig metaphysisch sein<br />
muß oder die Maßstäbe, die <strong>Rawls</strong>´ Ansatz als metaphysisch brandmarken, aus seiner Sicht nicht<br />
zum Instrumentarium von Moralphilosophie gehören.<br />
So scheint es mir angebrachter, komparativ vorzugehen und die Nachteile und Vorteile von <strong>Rawls</strong>´<br />
Theorie mit den Nachteilen und Vorteilen anderer Theorien zu vergleichen und dann erst zu<br />
entscheiden, ob die Nachteile der <strong>Rawls</strong>schen Theorie schwerer wiegen.<br />
Die Vorteile der Kantischen Theorie à la <strong>Rawls</strong> sind aus meiner Sicht dort zu sehen, wo zugegeben<br />
wird, daß das Humesche Gesetz nicht zu umgehen sei. Danach ist es nicht möglich, ein Sollen aus<br />
einem Sein abzuleiten. Das Bestehen von Fakten kann keinen Grund darstellen, daß etwas<br />
moralisch bindend ist. 56 <strong>Rawls</strong> betont immer wieder, daß seine Theorie normativ in eben diesem<br />
solche Fehlschlüsse vermeidenden Sinne sei: sie versuche nicht moralische Prinzipien aus<br />
irgendwelchen Faktizitäten abzuleiten; der Urzustand sei nicht moralisch indifferent, sondern<br />
enthalte mit dem Fairneßprinzip ein moralisches Prärogativ. 57 Für <strong>Rawls</strong> ist es unplausibel, die<br />
Pflicht, Versprechen zu halten, aus dem bloßen Bestehen von Institutionen und der Anrufung<br />
derselben abzuleiten.<br />
Ein Gegenansatz zu dieser antinaturalistischen Auffassung versucht, den Unterschied zwischen<br />
Sollen und Sein zu kassieren. 58<br />
folgendermaßen aus:<br />
Er stammt von Searle. Sein Schema des Versprechens sieht<br />
(1) Jones hat geäußert, „Hiermit verspreche ich, dir, Smith, fünf Dollar zu zahlen.“<br />
(2) Jones hat versprochen, Smith fünf Dollar zu zahlen.<br />
(3) Jones hat sich der Verpflichtung unterworfen (sie übernommen), Smith fünf Dollar zu bezahlen.<br />
(4) Jones ist verpflichtet, Smith fünf Dollar zu zahlen.<br />
(5) Jones muß [ought to] Smith fünf Dollar zahlen. 59<br />
Für Searle sind die Schritte (1) bis (5) auseinander ableitbar, wobei mit ableitbar im<br />
aussagenlogischen Sinne ableitbar gemeint ist. Jedoch müssen dazu eine Reihe von<br />
Zusatzprämissen eingeführt werden, die Regeln illokutionärer Akte und speziell solche für den<br />
illokutionären Akt des Versprechens enthalten. Ich kann aus verständlichen Gründen hier nicht die<br />
ganze Theorie illokutionärer Akte ausbreiten. 60 Ich werde mich deswegen auf die wesentliche Form<br />
beschränken, in der Searle seine Ableitung verstanden wissen will. Für Searle sind zwei Dinge<br />
56 Siehe Hume, Treatise of Human Nature, Book III, Part I, Sec.I, S. 469.<br />
57 Zugegeben, auch <strong>Rawls</strong> neigt dazu den Urzustand als device of representation irgendwie objektiver<br />
erscheinen zu lassen, jedoch steht fest: das Fairneßprinzip ist ein Beschreibungsinstrument des Urzustandes und enthält<br />
bereits Normen.<br />
58 Siehe dazu: Searle (1967), S. 101-114 , sowie ders., (1990[1969]), Kap. 8. Ebenso Hare (1967), S. 115-127.<br />
59 Searle (1990[1968]), S. 264.<br />
- 46 -