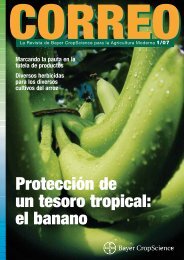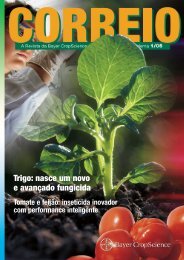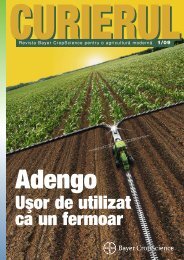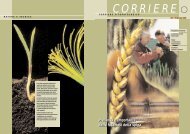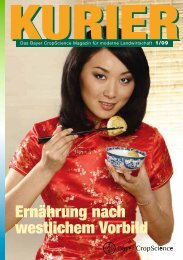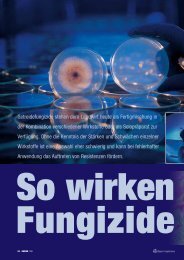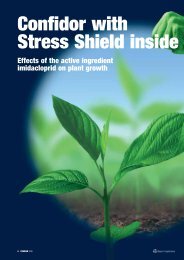Genau auf Kurs!
Genau auf Kurs!
Genau auf Kurs!
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der November gilt von Alters her als der nebelreichste<br />
Monat. „Nebelmond" oder „Nebelung" hat man ihn<br />
deshalb früher genannt. Dabei tut man dem November<br />
ganz und gar unrecht.<br />
Blättert man die Aufzeichnungen der<br />
Wetterstationen in Deutschland durch, so<br />
wird man feststellen, dass nicht der<br />
November, sondern der „Goldene Oktober“<br />
die meisten Nebeltage <strong>auf</strong>weist. Allerdings<br />
sind die Oktobernebel normalerweise<br />
längst nicht so zäh und ausdauernd wie die<br />
oft tage- oder sogar wochenlang anhaltenden<br />
Nebel im November. Und eine andere<br />
Ursache haben die Novembernebel in den<br />
meisten Fällen auch.<br />
Nebelbildung<br />
Die Luft enthält immer eine mehr oder<br />
weniger große Menge an Wasserdampf –<br />
auch wenn sich der Himmel wolkenlos und<br />
strahlend dunkelblau über uns wölbt. Das<br />
kann man mit einem kleinen Experiment<br />
schnell beweisen: Gießen Sie eine Flasche<br />
Bier – frisch aus dem Kühlschrank – in ein<br />
Glas. Noch beim Einschenken können Sie<br />
beobachten, wie das Glas rundum<br />
beschlägt (bei sehr trockener Luft oder in<br />
einem geheizten Raum kann der Versuch<br />
allerdings misslingen!). Das kalte Bier hat<br />
das Glas und das wiederum die an ihm vorbei<br />
streichende Luft abgekühlt. Der<br />
Wasserdampf kondensiert. Verantwortlich<br />
ist die Physik, wonach kalte Luft weniger<br />
Wasserdampf mit sich führen kann als<br />
warme. Die Konsequenz: Wird wasserdampfhaltige<br />
Luft immer weiter abgekühlt,<br />
erreicht man irgendwann die<br />
Temperatur, unterhalb derer sich die Luft<br />
eines Teils des in ihr enthaltenen Wasserdampfes<br />
entledigen muss. Das erreicht sie,<br />
indem sie ihn in Form von winzigen<br />
Tröpfchen ausscheidet. Man braucht also<br />
Luft nur tief genug abzukühlen, um eine<br />
Kondensation des Wasserdampfes zu<br />
erzwingen. Die Temperatur, ab der<br />
Wasserdampf zu kondensieren beginnt,<br />
heißt „Taupunktstemperatur" oder kurz<br />
„Taupunkt", da mit ihr die Taubildung einsetzt.<br />
In der Natur kühlen sich nachts insbesondere<br />
die Pflanzenoberflächen sehr<br />
stark ab, so dass sie bis zum Morgen oft<br />
mit Tau bedeckt sind.<br />
Enthält die Luft sehr viel Wasserdampf<br />
und/oder dauert die nächtliche Abkühlung<br />
sehr lang an, wie das besonders in den Spätherbstmonaten<br />
der Fall ist, dann bleiben<br />
viele der entstehenden Tröpfchen in der<br />
Luft schweben und verringern die Sichtweite.<br />
Zunächst spricht man lediglich von<br />
„Dunst“, bei einer Sichtweite unter 1.000<br />
Metern dann von „Nebel“.<br />
In der Natur gibt es viele Vorgänge, die<br />
zur Abkühlung der Luft unter den Taupunkt<br />
und damit zur Nebelbildung führen.<br />
Zunächst ist dabei an die ganz normale<br />
nächtliche Abkühlung zu denken. Sie<br />
beginnt am Erdboden und setzt sich mit<br />
fortschreitender Nacht in die Höhe fort.<br />
Deshalb bilden sich in vielen Fällen<br />
zunächst flache Nebelbänke, die während<br />
der Nacht höher und höher werden und<br />
gegen Sonnen<strong>auf</strong>gang ihre größte Mächtigkeit<br />
erreichen. Normalerweise reichen sie<br />
kaum höher als einige hundert Meter. Ist<br />
die Luft nur mäßig feucht, dann entstehen<br />
flache Nebelbänke, die kaum über die<br />
Höhe von Sträuchern und Bäumen hinauswachsen.<br />
Und darüber spannt sich der klare,<br />
blaue Himmel. Im Licht der Morgensonne<br />
können solche flache Nebelschichten in<br />
prächtigem Gold und Rot erstrahlen.<br />
Wenn vorhin gesagt wurde, dass Nebel<br />
besonders dann entsteht, wenn die Luftfeuchtigkeit<br />
hoch ist oder die nächtliche<br />
Abkühlung besonders lang dauert, müsste<br />
man eigentlich erwarten, dass die meisten<br />
Nebel im Winter um die Zeit der Sonnenwende<br />
(21. Dezember) <strong>auf</strong>treten, wenn die<br />
Flache Wiesennebel in einer Auenlandschaft.<br />
Nächte am längsten sind. Das ist überraschenderweise<br />
nicht der Fall. Vielmehr ist<br />
um diese Jahreszeit die Luft schon so weit<br />
abgekühlt, dass sie kaum noch Wasserdampf<br />
enthält, der zu Nebel führen könnte.<br />
Damit ergibt sich zwangsläufig, dass nicht<br />
der Winter, sondern der Spätherbst die<br />
besten Voraussetzungen für die Entstehung<br />
von Nebel bietet: Einerseits ist die Luft<br />
vom Sommer her noch warm genug, um<br />
entsprechend viel Wasserdampf mit sich<br />
zu führen, andererseits sind die Nächte<br />
schon lang genug, um die erforderliche<br />
Abkühlung zu ermöglichen.<br />
Moor- und Wiesennebel<br />
Moore sind bekannt für ihren Nebelreichtum.<br />
Der Grund dafür ist aber nicht etwa<br />
der nasse Boden – die tagsüber mit Wasserdampf<br />
angereicherte Luft hat der Wind bis<br />
zum Abend längst fort geblasen und durch<br />
trockenere Luft aus der Umgebung ersetzt.<br />
Ausschlaggebend ist, dass Moorböden aus<br />
bodenphysikalischen Gründen nachts<br />
besonders kalt werden und deshalb die<br />
Temperaturen häufig unter den Taupunkt<br />
sinken. Auch über Wiesen bilden sich oft<br />
zähe Nebel aus. Sie verdanken ihre Entstehung<br />
dem dichten Wurzelgestrüpp des<br />
Grases, das – ähnlich wie der lockere,<br />
torfige Moorboden – nachts besonders kalt<br />
wird. Auch alle Stellen im Gelände, an denen<br />
2/05 KURIER 27