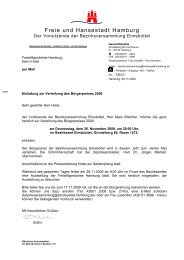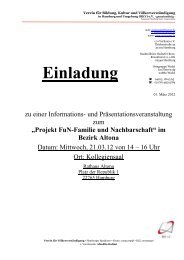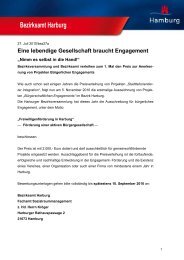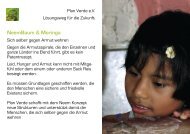Bildungssituation und Bildungsverhalten migrantischer Gruppen in ...
Bildungssituation und Bildungsverhalten migrantischer Gruppen in ...
Bildungssituation und Bildungsverhalten migrantischer Gruppen in ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
statische Größe zu betrachten. Das könnte dazu verführen, alle mit der Migration<br />
verb<strong>und</strong>enen Vorgänge nur e<strong>in</strong>seitig als Anpassungsleistungen der Migrant<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Migranten an das zeitlich gerade Vorgegebene der Gesellschaft zu verstehen. „Ist es aber<br />
überhaupt möglich, dass die e<strong>in</strong>heimische Bevölkerung vom Prozess der Migration unberührt<br />
bleibt? Kann man der ausländischen Bevölkerung e<strong>in</strong>fach sagen, dass sie sich an die Werte<br />
des Aufnahmelandes bed<strong>in</strong>gungslos anpassen muss, da sie <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Gastland lebt, oder ihr<br />
mit großer Gleichgültigkeit sagen, dass sie ansonsten <strong>in</strong> ihre Heimat zurückkehren sollte,<br />
wenn sie nicht bereit wäre, e<strong>in</strong>e solche Anpassung zu akzeptieren?“, 4 fragt z. B. Nuran<br />
Dönmez.<br />
Zuwanderung f<strong>in</strong>det statt <strong>in</strong> den gesellschaftlichen Raum e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>wanderungsgesellschaft<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> dessen Dynamik. Die hier zugr<strong>und</strong>e gelegte Vorstellung von Zuwanderung versucht,<br />
Zuwanderung als E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en gesellschaftlichen Raum <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e gesellschaftliche Zeit zu<br />
verstehen. In diese Eigendynamik treten migrantische <strong>Gruppen</strong> e<strong>in</strong> <strong>und</strong> bee<strong>in</strong>flussen diese<br />
Dynamik ihrerseits als Subjekte, als handelnde Menschen. Vom Theorieverständnis der<br />
sozialen Innovation her könnte man sagen, dass sie E<strong>in</strong>fluss nehmen auf bestehende<br />
spezifische Pfadabhängigkeiten der E<strong>in</strong>wanderergesellschaft. Pfadabhängig me<strong>in</strong>t, dass die<br />
bestehenden Verhältnisse den Weg der Gesellschaft <strong>in</strong> die Zukunft h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> eher <strong>in</strong> die e<strong>in</strong>e<br />
oder eher die andere Richtung bee<strong>in</strong>flussen, ohne dass diese Richtung dadurch <strong>in</strong> Gänze<br />
vorherbestimmt oder <strong>in</strong> Gänze prognostizierbar wäre. 5 E<strong>in</strong>e ganz allgeme<strong>in</strong>e, aber treffende<br />
Def<strong>in</strong>ition von Innovation <strong>und</strong> sozialer Innovation 6 lautet: „Do<strong>in</strong>g new th<strong>in</strong>gs or do<strong>in</strong>g th<strong>in</strong>gs<br />
<strong>in</strong> a new way“ (Alois Schumpeter). Neues kann also auch durch Rekomb<strong>in</strong>ation z. B.<br />
bestehender Regeln, bestehender Beziehungsmuster usw. entstehen, mit der neue, bisher nicht<br />
vorhandene Perspektiven h<strong>in</strong>sichtlich gesellschaftlicher Entwicklung gebildet werden. Dies<br />
braucht notwendiger Weise die Kommunikation <strong>und</strong> Interaktion der gesellschaftlichen<br />
<strong>Gruppen</strong> untere<strong>in</strong>ander. Voraussetzung gel<strong>in</strong>gender Kommunikationsvorgänge ist auch die<br />
Bereitschaft, <strong>in</strong> der Argumentation nicht die Macht- <strong>und</strong> Dom<strong>in</strong>anzgefälle, die aus den<br />
gesellschaftlichen Strukturen resultieren, auszuspielen. Nach Jürgen Habermas ist<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Dönmez, Nuran, „Kultur <strong>und</strong> Integration“. In: Gümrükcü, Harun; Gutmann, Rolf (Hg.), Januar 2003:<br />
Globalisierung. Zuwanderung <strong>und</strong> Interkulturelle Kompetenz, ITES-Jahrbuch 2002-2003, Schriften des<br />
Instituts für Türkisch-Europäische Studien Bd. 16, Hamburg, S. 236-237.<br />
Vgl. Zapf, Wolfgang, 1989: „Über soziale Innovationen“. In: Soziale Welt, 40. Jg., H. 1-2. Dort S. 177: Nach<br />
Zapf s<strong>in</strong>d soziale Innovationen „neue Wege [um] Ziele zu erreichen, <strong>in</strong>sbesondere neue<br />
Organisationsformen, neue Regulierungen, neue Lebensstile, die die Richtung des sozialen Wandels<br />
verändern, Probleme besser lösen als frühere Praktiken <strong>und</strong> die deshalb wert s<strong>in</strong>d, nachgeahmt <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong>stitutionalisiert zu werden“.<br />
E<strong>in</strong>e systematische E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> Begriff <strong>und</strong> Theorie der sozialen Innovation gibt Katr<strong>in</strong> Gillwald, 2000:<br />
Konzepte sozialer Innovation. Wissenschaftszentrum Berl<strong>in</strong> für Sozialforschung WZB, Abteilung<br />
Sozialstruktur <strong>und</strong> Sozialberichterstattung des Wissenschaftszentrum Berl<strong>in</strong>. L<strong>in</strong>k:<br />
http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2000/p00-519.pdf, Zugriff: 04.12.09.<br />
8