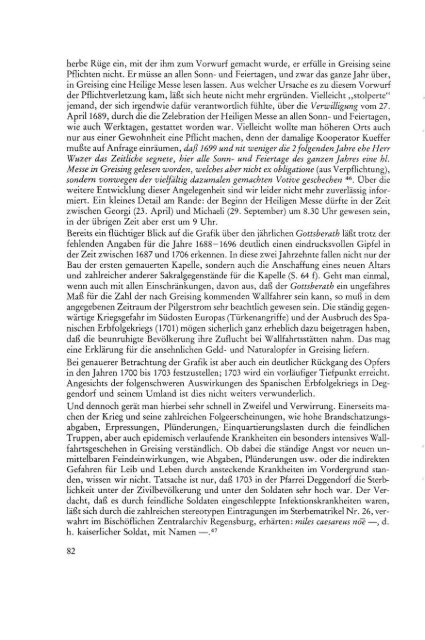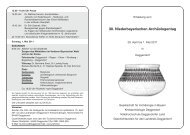r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
herbe Rüge ein, mit der ihm zum Vorwurf gemacht wurde, er erfülle in Greising seine<br />
Pflichten nicht. Er müsse an allen Sonn- und Feiertagen, und zwar das ganze Jahr über,<br />
in Greising eine Heilige Messe lesen lassen. Aus welcher Ursache es zu diesem Vorwurf<br />
der Pflichtverletzung kam, läßt sich heute nicht mehr ergrün<strong>den</strong>. Vielleicht „stolperte"<br />
jemand, der sich irgendwie da<strong>für</strong> verantwortlich fühlte, über die Verwilligung vom 27.<br />
April 1689, durch die die Zelebration der Heiligen Messe an allen Sonn- und Feiertagen,<br />
wie auch Werktagen, gestattet wor<strong>den</strong> war. Vielleicht wollte man höheren Orts auch<br />
nur aus einer Gewohnheit eine Pflicht machen, <strong>den</strong>n der damalige Kooperator Kueffer<br />
mußte auf Anfrage einräumen, daß 1699 und nit weniger die 2 folgen<strong>den</strong> Jahre ehe Herr<br />
Wuzer das Zeitliche segnete, hier alle Sonn- und Feiertage des ganzen Jahres eine hl.<br />
Messe in Greising gelesen wor<strong>den</strong>, welches aber nicht ex obligatione (aus Verpflichtung),<br />
sondern vonwegen der vielfältig dazumalen gemachten Votive geschechen 46 . Über die<br />
weitere Entwicklung dieser Angelegenheit sind wir leider nicht mehr zuverlässig informiert.<br />
Ein kleines Detail am Rande: der Beginn der Heiligen Messe dürfte in der Zeit<br />
zwischen Georgi (23. April) und Michaeli (29. September) um 8.30 Uhr gewesen sein,<br />
in der übrigen Zeit aber erst um 9 Uhr.<br />
Bereits ein flüchtiger Blick auf die Grafik über <strong>den</strong> jährlichen Gottsherath läßt trotz der<br />
fehlen<strong>den</strong> Angaben <strong>für</strong> die Jahre 1688—1696 deutlich einen eindrucksvollen Gipfel in<br />
der Zeit zwischen 1687 und 1706 erkennen. In diese zwei Jahrzehnte fallen nicht nur der<br />
Bau der ersten gemauerten Kapelle, sondern auch die Anschaffung eines neuen Altars<br />
und zahlreicher anderer Sakralgegenstände <strong>für</strong> die Kapelle (S. 64 f). Geht man einmal,<br />
wenn auch mit allen Einschränkungen, davon aus, daß der Gottsherath ein ungefähres<br />
Maß <strong>für</strong> die Zahl der nach Greising kommen<strong>den</strong> Wallfahrer sein kann, so muß in dem<br />
angegebenen Zeitraum der Pilgerstrom sehr beachtlich gewesen sein. Die ständig gegenwärtige<br />
Kriegsgefahr im Südosten Europas (Türkenangriffe) und der Ausbruch des Spanischen<br />
Erbfolgekriegs (1701) mögen sicherlich ganz erheblich dazu beigetragen haben,<br />
daß die beunruhigte Bevölkerung ihre Zuflucht bei Wallfahrtsstätten nahm. Das mag<br />
eine Erklärung <strong>für</strong> die ansehnlichen Geld- und Naturalopfer in Greising liefern.<br />
Bei genauerer Betrachtung der Grafik ist aber auch ein deutlicher Rückgang des Opfers<br />
in <strong>den</strong> Jahren 1700 bis 1703 festzustellen; 1703 wird ein vorläufiger Tiefpunkt erreicht.<br />
Angesichts der folgenschweren Auswirkungen des Spanischen Erbfolgekriegs in <strong>Deggendorf</strong><br />
und seinem Umland ist dies nicht weiters verwunderlich.<br />
Und <strong>den</strong>noch gerät man hierbei sehr schnell in Zweifel und Verwirrung. Einerseits machen<br />
der Krieg und seine zahlreichen Folgeerscheinungen, wie hohe Brandschatzungsabgaben,<br />
Erpressungen, Plünderungen,- Einquartierungslasten durch die feindlichen<br />
Truppen, aber auch epidemisch verlaufende Krankheiten ein besonders intensives Wallfahrtsgeschehen<br />
in Greising verständlich. Ob dabei die ständige Angst vor neuen unmittelbaren<br />
Feindeinwirkungen, wie Abgaben, Plünderungen usw. oder die indirekten<br />
Gefahren <strong>für</strong> Leib und Leben durch ansteckende Krankheiten im Vordergrund stan<strong>den</strong>,<br />
wissen wir nicht. Tatsache ist nur, daß 1703 in der Pfarrei <strong>Deggendorf</strong> die Sterblichkeit<br />
unter der Zivilbevölkerung und unter <strong>den</strong> Soldaten sehr hoch war. Der Verdacht,<br />
daß es durch feindliche Soldaten eingeschleppte Infektionskrankheiten waren,<br />
läßt sich durch die zahlreichen stereotypen Eintragungen im Sterbematrikel Nr. 26, verwahrt<br />
im Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg, erhärten: miles caesareus nöe —, d.<br />
h. kaiserlicher Soldat, mit Namen —, 47<br />
82