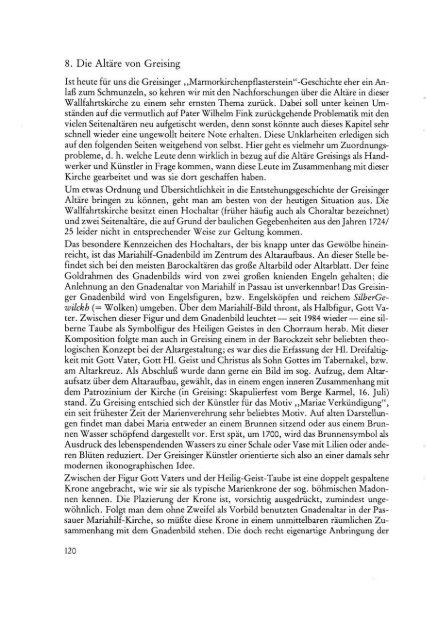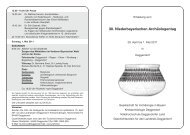r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8. Die Altäre von Greising<br />
Ist heute <strong>für</strong> uns die Greisinger ,,Marmorkirchenpflasterstein"-Geschichte eher ein Anlaß<br />
zum Schmunzeln, so kehren wir mit <strong>den</strong> Nachforschungen über die Altäre in dieser<br />
Wallfahrtskirche zu einem sehr ernsten Thema zurück. Dabei soll unter keinen Umstän<strong>den</strong><br />
auf die vermutlich auf Pater Wilhelm Fink zurückgehende Problematik mit <strong>den</strong><br />
vielen Seitenaltären neu aufgetischt wer<strong>den</strong>, <strong>den</strong>n sonst könnte auch dieses Kapitel sehr<br />
schnell wieder eine ungewollt heitere Note erhalten. Diese Unklarheiten erledigen sich<br />
auf <strong>den</strong> folgen<strong>den</strong> Seiten weitgehend von selbst. Hier geht es vielmehr um Zuordnungsprobleme,<br />
d. h. welche Leute <strong>den</strong>n wirklich in bezug auf die Altäre Greisings als Handwerker<br />
und Künstler in Frage kommen, wann diese Leute im Zusammenhang mit dieser<br />
Kirche gearbeitet und was sie dort geschaffen haben.<br />
Um etwas Ordnung und Übersichtlichkeit in die Entstehungsgeschichte der Greisinger<br />
Altäre bringen zu können, geht man am besten von der heutigen Situation aus. Die<br />
Wallfahrtskirche besitzt einen Hochaltar (früher häufig auch als Choraltar bezeichnet)<br />
und zwei Seitenaltäre, die auf Grund der baulichen Gegebenheiten aus <strong>den</strong> Jahren 1724/<br />
25 leider nicht in entsprechender Weise zur Geltung kommen.<br />
Das besondere Kennzeichen des Hochaltars, der bis knapp unter das Gewölbe hineinreicht,<br />
ist das Mariahilf-Gna<strong>den</strong>bild im Zentrum des Altaraufbaus. An dieser Stelle befindet<br />
sich bei <strong>den</strong> meisten Barockaltären das große Altarbild oder Altarblatt. Der feine<br />
Goldrahmen des Gna<strong>den</strong>bilds wird von zwei großen knien<strong>den</strong> Engeln gehalten; die<br />
Anlehnung an <strong>den</strong> Gna<strong>den</strong>altar von Mariahilf in Passau ist unverkennbar! Das Greisinger<br />
Gna<strong>den</strong>bild wird von Engelsfiguren, bzw. Engelsköpfen und reichem SilberGewilckh<br />
(= Wolken) umgeben. Über dem Mariahilf-Bild thront, als Halbfigur, Gott Vater.<br />
Zwischen dieser Figur und dem Gna<strong>den</strong>bild leuchtet— seit 1984 wieder— eine silberne<br />
Taube als Symbolfigur des Heiligen Geistes in <strong>den</strong> Chorraum herab. Mit dieser<br />
Komposition folgte man auch in Greising einem in der Barockzeit sehr beliebten theologischen<br />
Konzept bei der Altargestaltung; es war dies die Erfassung der Hl. Dreifaltigkeit<br />
mit Gott Vater, Gott Hl. Geist und Christus als Sohn Gottes im Tabernakel, bzw.<br />
am Altarkreuz. Als Abschluß wurde dann gerne ein Bild im sog. Aufzug, dem Altaraufsatz<br />
über dem Altaraufbau, gewählt, das in einem engen inneren Zusammenhang mit<br />
dem Patrozinium der Kirche (in Greising: Skapulierfest vom Berge Karmel, 16. Juli)<br />
stand. Zu Greising entschied sich der Künstler <strong>für</strong> das Motiv „Mariae Verkündigung",<br />
ein seit frühester Zeit der Marienverehrung sehr beliebtes Motiv. Auf alten Darstellungen<br />
findet man dabei Maria entweder an einem Brunnen sitzend oder aus einem Brunnen<br />
Wasser schöpfend dargestellt vor. Erst spät, um 1700, wird das Brunnensymbol als<br />
Ausdruck des lebenspen<strong>den</strong><strong>den</strong> Wassers zu einer Schale oder Vase mit Lilien oder anderen<br />
Blüten reduziert. Der Greisinger Künstler orientierte sich also an einer damals sehr<br />
modernen ikonographischen Idee.<br />
Zwischen der Figur Gott Vaters und der Heilig-Geist-Taube ist eine doppelt gespaltene<br />
Krone angebracht, wie wir sie als typische Marienkrone der sog. böhmischen Madonnen<br />
kennen. Die Plazierung der Krone ist, vorsichtig ausgedrückt, zumindest ungewöhnlich.<br />
Folgt man dem ohne Zweifel als Vorbild benutzten Gna<strong>den</strong>altar in der Passauer<br />
Mariahilf-Kirche, so müßte diese Krone in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang<br />
mit dem Gna<strong>den</strong>bild stehen. Die doch recht eigenartige Anbringung der<br />
120