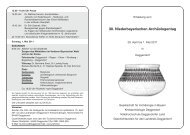r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
r1 - Geschichtsverein für den Landkreis Deggendorf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
auch der Verdienst einschließlich der Materialkosten abgerechnet. Seidl schließlich erhielt<br />
dann <strong>für</strong> die von ihm geleistete Arbeit von seinem Vetter die entsprechende Vergütung.<br />
So brauchte man mit Miller einen bestehen<strong>den</strong> Vertrag nicht rückgängig zu machen<br />
und mit Seidl keinen neuen zu schließen. Beide Maler scheinen ohnehin in finanziellen<br />
Belangen recht eng verbun<strong>den</strong> gewesen zu sein. Dies geht aus dem o. g. Übergabevertrag<br />
{Cedirte Maller Kunst) vom 14. September 1725 hervor. Er enthält u. a. die<br />
Bedingung, daß Miller an allen grossen Arbeiten, als altär und dergleichen, die sein Vetter<br />
Seidl anfertigte, mit einem Drittel am Gewinn beteiligt sein sollte. Nach dem Tode<br />
Millers sollte Seidl der verwittibten Frau Cammererin Jährlichen 15 fl VerRaichen: dises<br />
aber nur in solang dauern solle als Lange die Frau Camererm im Wittibenstandt Verbleiben.<br />
Bei einer eventuellen Wiederverheiratung ihrerseits sollte diese Pauschalzahlung<br />
erlöschen.<br />
Der Verfasser kann auf Grund des Übergabetermins nicht einmal mehr ausschließen,<br />
daß auch noch andere Arbeiten, die die Rechnung No. 82 des Jahres 1726 ausweist, aus<br />
der Hand Johann Sigmund Seidls stammen. Inwieweit heute noch von <strong>den</strong> Originalfassungen<br />
der Altäre Reste vorhan<strong>den</strong> sind, seien sie jetzt von Miller oder von Seidl, läßt<br />
sich auf Grund der Literalienlage nicht mehr angeben. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts<br />
mußten von einem Niederaltaicher Maler die Antependien und die Kanzel auf<br />
Grund des sehr desolaten Zustandes neu gefaßt wer<strong>den</strong>. Eine umfassende Restaurierung<br />
des Hochaltars um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts dürfte schließlich von<br />
<strong>den</strong> Originalfarben kaum mehr etwas übrig gelassen haben. U. U. könnte aber die heutige<br />
Fassung der vier Säulen am Hochaltar noch aus dem Jahr 1725 (oder 1726) stammen.<br />
Davon aber später.<br />
9. Greisings Gna<strong>den</strong>bilder<br />
Es ist sicherlich keine alltägliche und häufige Erscheinung, daß an einem Wallfahrtsort,<br />
von wenigen kurzen Zeitspannen abgesehen, stets zwei Gna<strong>den</strong>bilder vorhan<strong>den</strong> waren<br />
bzw. sind. Da war zunächst das von Franz Reischl geschaffene Mariahilfbild an der von<br />
ihm gestifteten Säule aus dem Jahre 1673. Als sich 1677 (oder 1678) zu dieser Bildsäule<br />
die erste Holzkapelle gesellte, wurde bekanntlich vom Pfleger Hans Christoph von<br />
Asch in diese ein neues Mariahilfbild verehrt. Reischls Bild fand wohl nicht das entsprechende<br />
Wohlgefallen. Über <strong>den</strong> Verbleib des Reischlschen Bildes ist nichts bekannt.<br />
Als dann in <strong>den</strong> Jahren 1691/92 an die Stelle der ersten Holzkapelle die gemauerte Kapelle<br />
gesetzt wurde, übernahm man das Mariahilfbild des Pflegers ebenfalls nicht in <strong>den</strong><br />
Neubau, sondern setzte wiederum ein neues Bild in diesen Sakralbau. In seinem Gutachten<br />
(Comihsion) wies Abt Bonifacius Hiltprant 1689 zwar deutlich darauf hin, daß<br />
die Bevölkerung wohl nichts gegen einen Abbruch der Holzkapelle haben könnte, aber<br />
rückblickend sollte <strong>den</strong>noch der Unwillen der Khirchfahrter über diese wohlgemeinte<br />
Maßnahme nicht ganz ausgeschlossen wer<strong>den</strong>. Nur allzu schnell hatte man sich um einen<br />
„Ersatz" <strong>für</strong> die alte Kapelle neben dem nun neuen, schöneren Gotteshaus bemüht.<br />
Entweder gleichzeitig oder doch sehr bald danach errichtete man eine „neue<br />
alte" Holzkapelle, in die dann das Pflegersche Mariahilfbild kam. Das gläubige Wallfahrervolk<br />
ließ es offensichtlich nicht zu, daß „sein" Mariahilfbild auf Grund einer ob-<br />
13C